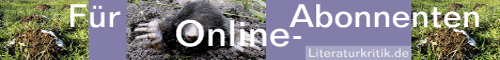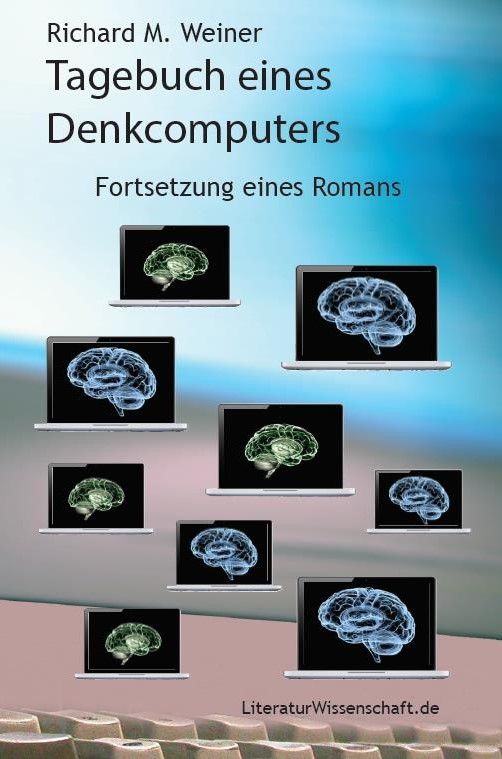Jan Christoph Meister schrieb uns am 24.05.2006
Thema: Harald Weilnböck: Der Mensch - ein Homo Narrator
Vorbemerkung: dies ist eigentlich eine Replik - ich weiß also nicht, ob ich hier in der richtigen Kategorie gelandet bin ...
--------------------------
„Empirisches a priori?“ Zu Harald Weilnböck „Der Mensch – ein Homo Narrator (…)“ in: literaturkritik.de (April 2006)
Ein Referat der jüngeren, am Phänomen der Narration wie seiner individual- und sozialpsychologischen Funktionen und Signifikanz interessierten psycho- logischen/-analytischen/-therapeutischen Forschungsliteratur und Empirie? Ein programmatischer Appell an die Scientific Community, die eben dieses Phänomen bislang unter den verschiedensten Beschreibungen zu fassen versuchte, sich unter dem wehenden Banner der ‚psychologischen Narratologie als Grundlagenwissenschaft’ zum inter-disziplinären und –methodologischen Gespräch zu versammeln? Die Frage nach dem Status von Harald Weilnböcks Artikel stellt sich bereits mit dessen Titel; sie bleibt indes auch nach dem Abschluß der Lektüre schwer zu beantworten.
Nichts gegen Referate, und nichts gegen programmatische Appelle, bei denen man sich naturgemäß weiter aus dem Fenster lehnen muß. 15 Druckseiten geben zudem naturgemäß viel Angriffsfläche; im Interesse der Debattenkultur will ich jedoch versuchen, mich auf drei knappe Einwürfe zu beschränken, um die Problematik des Beitrags zu umreißen.
Erstens: als ‚eigentliches Thema’ weist er die Absicht aus, den „Nachweis zu führen, dass der Mensch am angemessensten als Homo Narrator, als a priori erzählendes Wesen zu begreifen ist, weil die mentalen und interaktionalen Prozesse der Narration es sind, die die Grundeinheit des menschlichen Wahrnehmens, Denkens und Handelns überhaupt darstellen (…)“ (3) Zunächst: a priorische Bestimmung und empirischer Nachweis – und für diesen werden auf den Folgeseiten dann zahlreiche Beispiele aus der Forschungsliteratur referiert werden, während die apriorische Bestimmung ausbleibt – gehen schwerlich zusammen. Mit dieser Anmerkung möchte ich auf ein Grundproblem des Argumentationsmodus hinweisen, der in diesem und anderen Beiträgen herrscht, die das Erzählen relativ unbekümmert als anthropologische Universalie postulieren. An diesem vermeintlichen Fixpunkt wird dann flugs der eine oder andere große theoretische Hebel einer (narratologisch gesehen) Fremddisziplin angesetzt, die erkennbar ihr eigenes Explikationsprojekt verfolgt. Interdisziplinarität scheint dabei oft als Lizenz aufgefasst zu werden, die Begrifflichkeit irgendwie ‚lockerer’ zu handhaben, als dies im monodisziplinären Kontext der Fall wäre. So auch im vorliegenden Fall, wo die Begrifflichkeit ausgerechnet an Kernpunkten schwer ‚auf den Begriff’ zu bringen ist und fortwährend Mißverständnisse riskiert werden: beispielsweise dort, wo von Handlungslogik die Rede ist, dies aber nicht im philosophisch-logischen, sondern im sozialwissenschaftlich-beschreibenden Sinne einer empirischen Handlungstheorie gemeint ist. Ich bezweifle, daß man sich im psychologischen Forschungsdiskurs umgekehrt solche Unschärfe leisten darf; ich weiß definitiv, daß man es im narratologischen Diskurs nicht ungestraft tut. Denn hier meint ‚Handlungslogik’ eine spezifische Beschreibung des Repräsentationsgehaltes (nämlich die Logik des erzählten ‚Geschehens’) und eindeutig nicht die Pragmatik und Kontextabhängigkeit einer Produktions-Rezeptions-Konstellation im ‚Literatursystem’.
Zweitens: Das Problem bleibt im Kern auch dann bestehen, wenn man die Redeweise vom ‚a priori’ hier nicht begriffsanalytisch bzw. kantisch versteht, sondern metaphorisch, also im Sinne von: der Mensch ‚erzählt’ von Beginn seiner individuellen Existenz an und damit noch bevor er sprachmächtig geworden ist. Dieser Begriff des ‚Erzählens’ als einer unhintergehbaren, den Menschen als Menschen bestimmenden Eigenschaft wird in dem Beitrag leider nirgends expliziert, auch wenn sehr vieles angeführt sein mag, was intuitiv zur Phänomenologie des Erzählens gerechnet werden kann: von den ‚narrationsähnlichen Denk- und Wahrnehmungsmustern’ (3) über die ‚narrativ formatierte’ sog. ‚erlebte Mikrogeschichte’ (ibid.) bis hin zum ‚narrativ vorstrukturierten Wahrnehmen und Imaginieren’ und der ‚Mentalisierung und Narrativierung’ von Erfahrungen (4). Was aber heißt ‚Narrativierung’, was leiste ich, wenn ich etwas ‚narrativiere’? Der Beitrag kontrastiert eingangs die – nach seinem Verständnis altbacken philologische - ‚hermeneutisch-bedeutungszuweisende’ Herangehensweise an das Phänomen mit einer solchen, die ‚an der zentralen psycho- und handlungslogischen Dimensionen von Erzählen und seinen psycho-affektiven Funktionen nicht vorbeisehen’ will. (Auch hier ist, so scheint mir, nicht eigentlich von Handlungslogik die Rede, sondern von Pragmatik.) Wer, wenn nicht die Poetik, die Rhetorik und schließlich die Philologie haben denn zuallererst auf ebendiese Funktionsaspekte des Erzählens hingewiesen, so möchte man hier fragen? Maulwürfelnd-pragmatikblinde hermeneutische Tiefenbohrungen jenes Zuschnitts, auf den man hier ‚die Philologie’ reduziert zu sehen meint, erweisen sich in einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive auf das Feld der Textwissenschaften als ein relativ rezentes Phänomen. Der Ansatz mag im 19.Jahrhundert und bis zur Mitte des zwanzigsten fraglos Konjunktur gehabt haben – aber welche moderne Philologie läßt sich denn tatsächlich noch auf dieses kontextblinde Programm verpflichten?
Es scheint, man muß den Reduktionismusvorwurf retournieren: in dem Beitrag verkürzt sich der Begriff des ‚Narrativierens’ nämlich offenkundig auf die Kompetenz, existentielle Konstellationen auf dem Umweg der sprachlichen Symbolisierung als psychologische Transformationsmaschine zu funktionalisieren, um so zur Aneignung von Welt und - noch oder wieder - unverstandenem Selbst zu gelangen: „Es ist also lange vor der Sprache schon alles da, was eine Erzählung ausmacht: ein Subjekt, eine (Ausdrucks-)Intention, eine Handlungszielrichtung, eine Ereignis- und Vorher-Nachher-Perspektive sowie eine kommunikative Orientierung auf den Anderen.“ (3) Die ‚Erzählung’ geht hier definitorisch auf in der Funktion einer – bestenfalls noch kommunikativ camouflierten - (Selbst-)Bedeutung von Sprechern und Hörern: ein Reduktionismus, den die geschmähte Philologie mit dem Hinweis auf die trans-denotative Sinn-Dimension von Texten seit gut zweihundert Jahren weit hinter sich gelassen hat. Paradoxerweise gerät die Narration damit im gleichen Atemzug aber auch zu einem Allbegriff, zu etwas, was lange und schon immer vor uns da ist und zu dem es für uns als Subjekte schlechterdings kein Außen geben kann. Denn das, was da angeblich ‚vor der Sprache’ und schon immer da ist, wurde genau besehen nur analytisch aus dem vorausgesetzten Begriff des Subjekts selbst herauspräpariert.
Drittens: der Verfasser – es ist dies sein gutes Recht – enthält uns weder positive noch negative Urteile über Beiträge vor, die im Umkreis der Hamburger Forschergruppe Narratologie und der Tagung ‚Narratology beyond Literary Criticism’ entstanden sind. Was aus diesem Kontext scheinbar im Modus des Zitats berichtet wird, sind allerdings teils mündliche Diskussionsbeiträge und ist damit nicht nachprüfbar, und teils ist es nachprüfbar falsch oder zumindest irreführend akzentuiert: so wie einige direkte und indirekte Zitate aus dem Vorwort der Herausgeber zum Tagungsband. Dieses ist im Übrigen – wie der ganze Band und also auch ein in ihm abgedruckter Beitrag Weilnböcks selbst – auf Englisch verfaßt. Ebenfalls sachlich unzutreffend ist die Behauptung, die DFG habe der FGN jegliche Förderung interdisziplinärer Forschungsprojekte verwehrt. Dies sei hier nicht – was unangemessen wäre – gesagt, um als selbsternannter Anwalt von Kollegen oder Institutionen aufzutreten, sondern vielmehr, um auf die Problematik jenes Gestus hinzuweisen, der den Beitrag insgesamt auszeichnet. Er baut eine disziplinäre, methodische und institutionelle Frontstellung auf, die es nicht – oder zumindest: so nicht – gibt.
Die ‚Schwierigkeit’, die psychologische Narratologie als Grundlagenwissenschaften zu etablieren, mag damit hinreichend demonstriert worden sein – wobei man feststellen muß, daß es dem Verfasser nicht, wie zunächst im Titel behauptet, primär um deren Etablierung in den Sozialwissenschaftenm zu tun zu sein scheint, sondern umgekehrt wohl eher um ihre Installation als Grundlagenwissenschaft in den Textwissenschaften. Denn in den Sozialwissenschaften ist diese sog. ‚psychologische Narratologie’ ja bereits, wie der weitgespannte Überblick zeigen will, allerorten in nuce vertreten! Vom Nachweis der ‚Notwendigkeit’ solcher Inauguration dieser, oder irgendeiner Narratologie durch diesen Beitrag kann jedoch m.E. weder im Sinne eines logischen, noch im Sinne eines wissenschaftshistorischen Arguments die Rede sein.
Ich will es nicht verhehlen: wir alle haben unsere Freude daran, wenn zur Abwechslung einmal die eigene disziplinäre Sau durchs Dorf der Wissenschaften getrieben wird – aber ob wir nach all’ der methodischen Urknallerei von Lingo-, Psycho-, Nano-, Bio-, Neuro- und Kogni- nun auch noch ein Narrato-Paradigmenereignis brauchen, das scheint denn doch eher fraglich.
Jan Christoph Meister
Institut für Deutsche Philologie
LMU München
|