Gertrude Stein: zeit zum essen. eine tischgesellschaft
NIMM EIN EIS AN
Nimm an es sei innerhalb eines tores das offen ist
aaaaaoffen zur sperrstunde sommer heisst zu sagen es
aaaaasei so.
Alle sitze benötigen schwärzen. Ein weisses kleid ist
aaaaain sinn. Ein soldat ein richtiger soldat hat
aaaaaschäbige tressen, schäbig in tressen
aaaaaverschiedener grössen würde bedeuten könnte
aaaaaer lesen, könnte er lesen hätt er die grösse vier
aaaaaund zwanzig demonstrativ den mund zu stopfen.
Werd rot werd rot, lach weiss.
Nimm ein kollaps an ein geriebne schnurr, eine geriebne schnurr kriegen.
Kleine ladenmädchen ladenmädchen lämmerwädchen.
Lederlädchen und so delikat delikat, delikat delikat.
food, objects and portraits by Gertrude Stein,
über- und vorgetragen von Barbara Köhler, die zu ihrer Neuübersetzung ausgewählter Stücke der „Tender Buttons“ schreibt: „Wir wissen von dingen, die zeit verschlingen. Das schreiben von Gertrude Stein hingegen ist ein grundsätzlich nahrhaftes. Und sichtlich: es gibt längliche weile, rundliche, viel kurze und spitze, es gibt kein weil, das nicht frischkost wäre, auch wenn es seit 1911 schon auf dem papier steht. In den mund genommen, entfalten die texte geschmack und verblüffende aromen. Das gibt einen ohrenschmaus. Fast. Und auch slow food.“ Und was wäre eine Tischgesellschaft ohne Gäste? Barbara Köhler gesellt den Speisen und Dingen aus den „Tender Buttons“ Künstlerporträts hinzu, die hier erstmals auf Deutsch erscheinen: Man Ray, Stieglitz, Bernard Fay und George Hugnet.
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 2001
Die PORTRAITS zeigen eigenarten einzelner stimmen,
den duktus, das beredte einer sprache, nicht das beredete. Sie sprechen von beziehungsweisen einer person als deren grammatik und von grammatik nicht als zwanghaft, sondern möglichkeitsfeld, als entfalten eines sprachspielfeldes auf dem sich mit regeln umgehen lässt, die sich auch umgehen lassen: Sätze nicht nur worte sondern sätze und immer wieder sätze sind Gertrude Steins lebenslange leidenschaft gewesen. Machenschaften zwischen wörtern, wörtern und sätzen und sätzen und menschen. Machenschaften. Sie schreiben und sie stellen nicht fest, sie vergegenwärtigen bewegen. Das hauptwort der TENDER BUTTONS heisst CHANGE (change the subject); ich habe es meist übertragen als wandel, dessen bedeutung ebenfalls, anders changiert, auch eine leibliche bewegung tragen kann und das zauberische, gleitende einer verwandlung und eine gewisse autonomie ermöglicht (a change has come) gegenüber der mach- und feststellbaren, einrichtigen enderung oder dem zweipoligen springen des wechsels, demgegenüber ein wandel geraum ist beidseitig der wand…
TENDER BUTTONS sind zwar (auch und keineswegs ausschließlich) texte voller zweideutigkeit aber eben nicht von der eindeutigen, monosexuellen sorte: sie machen sich lustig und sind voller lust, voller kurioser erektionen und penetranz, einverleiben und leckereien, es blühen blumen in ihnen, die durchaus fliessend gelesen werden können (flowers von to flow – fliessige lieschen vielleicht) und bereits die buttons des titels knöpfen sich eine sexuelle dreideutigkeit vor, knospen/brustwaren und hoden und klitorides. Steins praxis ist, wird benannt cover, aber verhüllt, verbirgt weniger als dass sie anzüglich ist. Ein mittel (und keine mitte) wäre z.b. hanging – jedoch kein vorhang, vorwand zum dahinterkommen (ermittlung feststellung enthüllung) jedoch eine bewegliche textile vielfalt die ein beidseits, die einen unterschied macht.
ACT SO THAT THERE IS NO USE IN A CENTRE: Wo ein tisch ist, ein tuch, platz ist zum ausbreiten, ist platz für vieles, für viele, für differentes und differenzen, ist ZEIT ZUM ESSEN, zum vielstimmigen gespräch, in das sich zu mischen die/der lesende eingeladen ist, eine stimme, der kein platz zugewiesen aber gemacht ist. Platz gemacht platz zu nehmen, sich diese texte munden zu lassen, schauplatz und für einen ohrenschmaus. Das mündliche ist hier dem mündigen verwandelt die schrift in sprache zu übertragen in eine andere, eigene sprache, in der sich nichts von selbst versteht was man nicht selbst versteht, in der der text nicht vorgekaut, kein vorgesagtes ist, ich ihn mir selber mundlich, ihn stimmig machen muss. – Mir war es und ich hoffe es überträgt sich ein genuss…
Barbara Köhler, Bookleteinschub
Gertrude Stein
Schwer zu sagen, wie sie es geschafft hat, damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Ikone der europäischen und der amerikanischen Avantgarde zu werden. An ihrer Familie kann das nicht gelegen haben. Sie war jüdisch, kam aus Deutschland und, wie sie oft betonte, aus einem bürgerlichen und hoch achtbaren Haus. So konnte Gertrude Stein am Radcliffe College in Cambridge und in Baltimore Philosophie, Biologie und sogar ein bißchen Medizin studieren. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie 1909, auf eigene Kosten, da kein Verlag es haben wollte. Die Lektorin fand es zu „experimentell“, weil die Autorin die Wiederholung liebte und fähig war, ganz ohne Komma, Gedankenstrich, Semikolon und Doppelpunkt auszukommen.
Eines Tages ging sie mit ihrem Bruder Leo, einem Kunstsammler und Kritiker, nach Paris und eröffnete 1903 einen Salon in der Rue de Fleurus, zu dem sie Picasso, Matisse und Braque einlud. Damals, als deren Werke noch für ein Butterbrot zu haben waren, kaufte sie ihre Bilder. Auch die Dichter kamen: Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, der Erfinder des Ubu Roi und der Pataphysik, und Max Jacob.
Sie schrieb viel. Der Bedeutung ihrer zahlreichen Gedichte, Stücke und Prosaarbeiten war sie ganz sicher: „Denken Sie an die Bibel und Homer“, sagte sie, „denken Sie an Shakespeare und denken Sie an mich.“ Erst als sie einen Bund mit ihrer Liebesgefährtin Alice B. Toklas einging, die ihr als Sekretärin, Köchin und Muse diente, ließ sie sich zu einem Stil herab, den das Publikum mochte, und erreichte 1933 mit einer fiktiven „Autobiographie“ ihrer Freundin, daß ihr Name in den USA sprichwörtlich für die allerneueste Moderne wurde.
Von denen, die sie kannten, haben sich die meisten ihrer Herrschsucht und ihrer Megalomanie gefügt. Das ist wunderbar, denn sie war keine Schönheit, sondern fett und massiv. Von ihrer eigenen Genialität war sie derart überzeugt, daß auch bedeutende und selbstbewußte Künstler anfingen, ihr zu glauben. Das allein war schon eine beachtliche Leistung. Ihr Bruder aber verließ die gemeinsame Wohnung, als er es nicht mehr mit ihr aushielt, weil er ihren Größenwahn für manisch hielt. Sie reagierte auf seine Briefe nicht mehr und hat sich nie mit ihm ausgesöhnt.
Gertrude Stein mied Kriege. So hielt sie es auch im Ersten Weltkrieg. Über ein Jahr brachte sie von 1915 an mit ihrer Alice in Palma de Mallorca zu. Später, nach dem Waffenstillstand, erschienen in ihrem Salon neue Besucher wie Ernest Hemingway, John Dos Passos, Ezra Pound und T.S. Eliot. Auch Scott Fitzgerald und Jean Cocteau stießen zu ihrem Kreis von Eingeweihten.
Das ging nicht immer gut. Tristan Tzara, der auch dabei war, nahm Anstoß an ihren Lügen und an ihrem „größenwahnsinnigen Egoismus“, obwohl er selbst nicht frei von solchen Regungen war. Hemingway sandte ihr ein Buch mit der Widmung „a bitch is a bitch is a bitch“, zur Erinnerung an ihre berühmteste Verszeile, „a rose is a rose is a rose“. Ihr Freund Georges Braque erklärte:
Mlle. Stein hat nichts von dem verstanden, was hier passiert. Sie war und blieb eine Touristin.
Sie muß William Carlos Williams, einen Dichter ersten Ranges, für einen Provinzler gehalten haben; denn als er ihr riet, mißratene Manuskripte in den Ofen zu stecken, antwortete sie ihm:
Das Schreiben ist eben nicht Ihr Metier.
Sie zweifelte nicht daran, daß ihr 1.000seitiger Roman The Making of Americans neben dem Ulysses von Joyce und neben Prousts Recherche zu den bedeutendsten Werken des Jahrhunderts gehört. Edmund Wilson war nicht ganz ihrer Meinung.
Ich habe es nicht vollständig gelesen und weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Bei Sätzen, die so maßlos ausgewalzt sind und so viele Male wiederholt werden, wird der Leser einfach einschlafen.
Politisch war sie unzurechnungsfähig. 1934 soll sie gesagt haben:
Hitler sollte den Friedensnobelpreis bekommen, weil er Deutschland von allen strittigen Elementen befreit hat. Indem er die Juden, die Demokraten und die Linken vertreibt, macht er dieses Land handlungsunfähig und sorgt für Frieden.
Später erklärte sie, das sei ironisch gemeint gewesen.
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überraschte Stein und Toklas in ihrem Ferienhaus unweit von Aix-les-Bains und der Schweizer Grenze. Dort übersetzte sie Reden von Marschall Pétain, den sie für einen mutigen Politiker hielt. Er wolle doch nur Frankreich retten und werde zu Unrecht von den Amerikanern gemobbt. Erst 1942 ließ ihre Begeisterung nach. Über den Mord an den europäischen Juden äußerte sie sich nicht. Die deutsche Okkupation hat sie unbehelligt in Culoz, einer Ortschaft nahe der Schweizer Grenze, überstanden.
Dafür sorgte ihr Freund und Übersetzer Bernard Faÿ, ein Antisemit, der gute Beziehungen zur Vichy-Regierung und zur Gestapo hatte. (Nach dem Krieg wurde er als Kollaborateur zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 1951 konnte er – angeblich mit finanzieller Unterstützung durch Alice Toklas – in die Schweiz fliehen.) Im Dezember 1944 kehrte das Paar nach Paris zurück.
Picasso äußerte sich dem amerikanischen Journalisten James Lord gegenüber überraschend deutlich:
Gertrude war eine Faschistin. Sie hatte schon immer eine Schwäche für Franco, und für Pétain hat sie eine Rede geschrieben.
Stein starb am 27. Juli 1946 in Paris an Magenkrebs. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Père Lachaise. Die treue, bescheidene Toklas hat ihre Partnerin um mehr als 20 Jahre überlebt. Sie wurde im Grab von Gertrude Stein beigesetzt. Ihr Name steht auf der Rückseite des Grabmals.
Hans Magnus Enzensberger, aus Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler. 99 literarische Vignetten aus dem 20. Jahrhundert, Suhrkamp Verlag, 2018
FOR THE ONE AND ONLY GERTRUDE STEIN
eine rose ist eine rose ist eine rose
aber eine frau?
ein riese ist ein riese ist ein riese
aber eine frau?
ein stein ist ein stein ist ein stein
aber eine frau?
eine frau ist eine frau ist eine frau
aber eine rose?
Ernst Jandl
3. Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung 2009 an Barbara Köhler und Ulf Stolterfoht.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Pennsound
Fakten und Vermutungen zur Übersetzerin + Laudatio + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Barbara Köhler: Börsenblatt ✝︎ Standart ✝︎ SZ ✝︎ BZ ✝︎ TS ✝︎
NZZ ✝︎ Zeit ✝︎ Badische ✝︎ perlentauer ✝︎ ASH ✝︎ JW ✝︎ kreuzer ✝︎ KHM ✝︎
Ruhr ✝︎
Barbara Köhler liest beim poesiefestival berlin 2009.


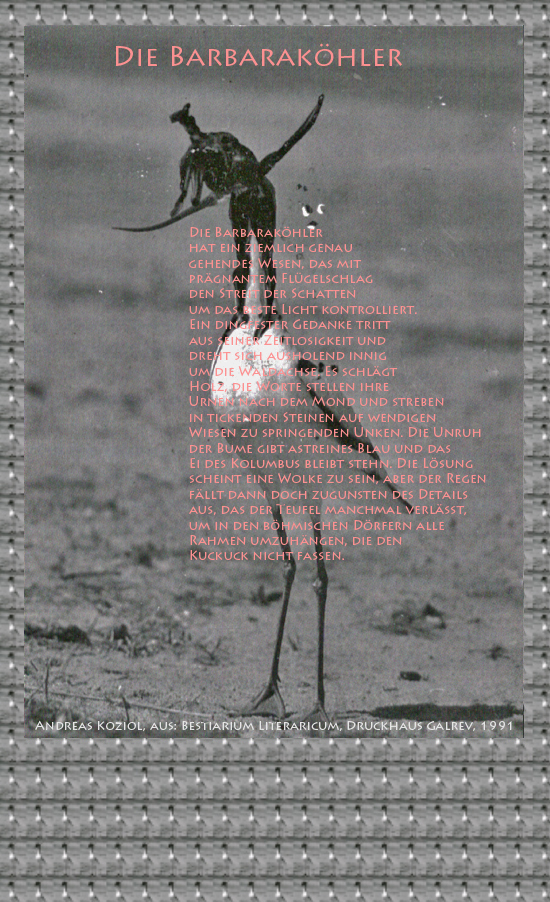








Schreibe einen Kommentar