Wulf Kirsten: satzanfang
SATZANFANG
den winterschlaf abtun und
die wunschsätze verwandeln!
saataufgang heißt mein satzanfang.
die entwürfe in grün überflügeln
meiner wortfelder langsamen wuchs.
im überschwang sich erkühnen
zu trigonometrischer interpunktion!
ans licht bringen
die biografien aller sagbaren dinge
eines erdstrichs zwischenein.
inständig benennen: die leute vom dorf,
ihre ausdauer, ihre werktagsgeduld.
aus wortfiguren standbilder setzen
einer dynastie von feldbestellern
ohne resonanznamen.
den redefluß hinab im widerschein
die hafergelben flanken
meines gelobten lands.
seine rauhe, rissige erde
nehm ich ins wort.
ENTWURF EINER LANDSCHAFT
Lyrische Landschaften haben in der deutschen Literatur ihre Tradition. Sie reicht von der Droste bis zu Kramer, Huchel und Bobrowski. Die Bedeutung einer an Landschaft gebundenen Naturlyrik liegt nicht in der Betonung geographischer Gegebenheiten, vielmehr erlaubt dieser Aspekt (die Begrenzung der Welt auf ein Segment) ein tieferes Eindringen in die Natur, eine auf sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit, eine Mehrschichtigkeit, mit der soziale und historische Bezüge ins Naturbild kommen. – Es geht um einen Fixpunkt, der in Beziehung zur Welt steht. Von einer so verstandenen sozialen Naturbetrachtung geht Weltzugewandtheit aus, die innerhalb der ihr gesetzten Grenzen besonders beweiskräftig sein kann. Eine solche Traditionslinie halte ich für konstruktiv, für weiterwirkend, im Gegensatz etwa zu einer ins Leere laufenden metaphysischen Natursicht, die auf Entrückung zielt.
Von den ersten Fingerübungen an suchte ich nach Modellen, später nach produktiven Beispielen, auf denen aufgebaut werden konnte. Die Aufarbeitung und Kenntnis des Fundus (nicht nur des deutschsprachigen) ist Voraussetzung für einen eigenen Beitrag, der Fortführung anstrebt und um einen neuen Ton bemüht ist. Es genügt dabei nicht, sich nur in die Tradition zu stellen und als Epigone treiben zu lassen. Tradition ist nur die eine Dimension oder Achse, zu ihr muß unbedingt als zweite Dimension die Gegenwart kommen. Von beiden „Achsen“ gehen diachron und synchron Impulse aus. Ohne dieses Fundament besteht wenig Aussicht auf eine eigene Handschrift.
Sein Thema finden heißt zu sich selbst finden. Dieser Prozeß der Suche schließt die verschiedensten Stationen ein, geht über Entwicklungsstadien, in denen sich die Einflüsse, mehr oder weniger eingeschmolzen, widerspiegeln. Zu den Einflüssen gehören neben bewußt gewählten, anfangs häufig wechselnden Vorbildern vor allem auch viele unbewußte punktuelle Übernahmen aus dem Fundus der Literatur (nicht nur der Lyrik). Dieser Vorgang vollzieht sich nicht nur auf ästhetischer Ebene, vielmehr schließt das Sichfinden in der literarischen Realität die ständige Auseinandersetzung zwischen dem lyrischen Ich und der Zeit ein. Erst die aus solchen Erkenntnissen gezogene Konsequenz, die Identifizierung mit der Gegenwart und mit dem Lande, in dem ich aufwuchs und lebe, ermöglichte es, das Thema zu finden und zu artikulieren. Von diesem Zeitpunkt an begannen sich die Erfahrungen mit der Literatur umzusetzen in Abbilder, die zu gesteigerten Szenen des Grunderlebnisses wurden. Die Wirklichkeit als „Vorlage“ für Dichtung konnte in der „ästhetischen Realität“ (Mnjasnikow) aufgehoben werden, in der Absicht, sich bis in den Tonfall hinein als Existenz sichtbar zu machen.
„Man sieht nur, was man weiß“ heißt es bei Fontane. Erst mit diesem Wissen sah ich die Landschaft wirklich, aus der ich kam. Erst als ich die Welt, die ich kannte, als meine Welt begriffen hatte, vermochte ich sie zu umschreiben. Diese Welt wurde zu dem Zeitpunkt mein Eigentum, als ich mich selbst als ein „Aktivum“ begriffen hatte. Es war ein Fixpunkt gefunden, der nicht mehr nur Schatzbehalter für Kindheitserlebnisse war, sondern auf den sich das lyrische Subjekt in allen Tempora beziehen ließ. Um das Idyll zerstören zu können, bedurfte es der Distanz. Ohne sie wäre es wohl auch nicht möglich, der Monotonie zu entgehen, zu der thematische Begrenzung führen kann.
Ich möchte den Werktag einer lokalisierten Agrarlandschaft, die für beliebig andere stehen mag, poetisieren (nicht romantisieren!), in einer aufgerauhten, „körnigen“ Sprache, die ich dem Thema angemessen finde. Es soll ein unberühmter Landstrich in poetischer Rede, also preisend, vorgeführt werden. In dieser Landschaft leben Menschen, für die Arbeit etwas Selbstverständliches, Notwendiges, Nützliches ist, eben das Alltägliche. Diese Leute ohne Resonanznamen sind eine staatstragende Kraft. Sie sorgen dafür, daß der Staat existent bleibt, demzufolge auch ich.
Mich interessieren die Beziehungen des Menschen zur Natur, in erster Linie die jener Leute, die intensiven Umgang mit ihr haben, ihr ein menschliches Gesicht geben. So gesehen, wird die Naturnähe zum „Raum des Menschlichen“ (Kito Lorenc). Weil alle Erlebnisse an ein bestimmtes Stück Welt gebunden sind, wobei das Geographische nur als Modellfall gedacht ist, bot sich gerade jene bäurische Landschaft, aus der ich komme und die ich kenne, als Hintergrund für das Weltbild an. Von diesem „überschaubaren“ Segment „Welt“ fand ich Zugang zu meiner Zeit. Weil ich ein Teil dieser Zeit und Wirklichkeit geworden war, konnte sie zur eignen Sache werden. Sich selbst ausforschen heißt dann auch, die Landschaft ins lyrische Ich einbeziehen, indem historische, soziale, ökonomische, topographische und biographische Details miteinander in Beziehung gesetzt werden, und zwar so, daß Abläufe in Zeit und Raum erkennbar sind. Mit dieser lokalen Totalität wird versucht, die Landschaft so exakt wie möglich zu benennen und etwas von ihrer Dynamik und Vitalität wiederzugeben.
Die Landschaft wird entworfen in einem Zyklus von Gedichten, die auf einander zugeordneten Grundworten basieren. Diese Grundworte sind jeweils Bilder, die Ausblicke geben wollen. Ein Gedicht soll ins andre hinüberreichen. Angedeutete Bilder werden in einem anderen Gedicht wieder aufgenommen und in den Mittelpunkt gerückt. An zentraler Stelle steht das Panorama „die erde bei Meißen“. Je nach dem Standort des Betrachters und der Entfernung zum Gegenstand wechselt der Sichtbereich. Die Gedichte heben sich voneinander ab, indem jeweils ein neuer, konkreter Ausgangspunkt gesucht wird, der Sichtweite hat. Mit jedem Grundwort ist ein Erlebnisinhalt verbunden: etwas Alltägliches ist zum Erlebnis geworden, weil es in vielfachen Variationen gesehen wurde. Diese optische Erfahrung muß ins Wort eingelebt sein und beim Schreiben noch einmal eingelebt werden. Das Grundwort ist ein lexikalisch umzusetzender Erfahrungswert, der etwas über das Verhältnis zu den Dingen sagt, die den Menschen umgeben.
Wie das Gedicht auf Grundworten ruht, so wird es auch von der Lexik her gebaut. Im Wort selbst liegt der Anfang der Poesie, nur darf es nicht bei sinnarmen Konstellationen bleiben. In die Gedichte geht (je nach Gegenstand) Wortgut aus dem bäurischen Lebensbereich ein, das nur so weit regional eingefärbt ist, als es sich mühelos in die Hochsprache nehmen läßt. Gerade aus dieser „vom Saft des Populären genährten“ Zwischenschicht profitiert die Sprache. Sie gibt der sprachlichen Gestalt das Kolorit. Insgesamt ist dieser Bereich aber nur eine sprachliche Quelle neben anderen. Wichtig ist, daß aus der Sprache, wie immer sie auch zusammengesetzt sein mag, die Wirklichkeit hervorgeht. Sie wird nachgezeichnet in dem guten Glauben, ich könnte Einfluß nehmen auf mich und vielleicht auch auf andre. Die Landschaft steht pars pro toto für eine Welt, in der die Lebensbedingungen auf die Erhaltung der menschlichen Existenz angelegt sind.
Erfolgreicher lyrischer Feldzug
Wer die seit etwa fünf Jahren in Anthologien erschienenen Gedichte des jungen „Landschafters“ Wulf Kirsten aufmerksam gelesen hat, wird das erste Gedichtbuch dieses talentierten Autors, das der Verlag übrigens sehr schön ausgestattet hat, mit einigen Erwartungen aufschlagen. Er wird sich nicht enttäuscht sehen: Kirsten hat sich ein belangvolles thematisches Programm erarbeitet, über das er in dem ebenso knappen wie aufschlußreichen Essay „Entwurf einer Landschaft“ am Ende seines Bandes Rechenschaft gibt, und er hat sich eine nicht ganz unproblematische, im ganzen jedoch angemessene und ansprechende Sprache geschaffen. „Armer karsthänse nachfahr“, redet der Lyriker in seinen reimlosen, aber bilderreichen Versen im wesentlichen davon, wie er die dörfliche Welt, die ihm in seiner Kindheit die Welt schlechthin war, heute sieht: anders und verändert, neu und erneut. Die früh erlebte, nachträglich historisch begriffene und in ihrer gegenwärtigen Wandlung gesehene „erde bei Meißen“ wird zum Zentrum eines Feldzugs, der mit Erfolg auf die poetische Eroberung alltäglicher und nächster Wirklichkeit ausgeht. In seinem ästhetisch-theoretischen Selbstbekenntnis formuliert Kirsten:
Ich möchte den Werktag einer lokalisierten Agrarlandschaft, die für beliebig andere stehen mag, poetisieren (nicht romantisieren!)… In dieser Landschaft leben Menschen, für die Arbeit etwas Selbstverständliches, Notwendiges, Nützliches ist, eben das Alltägliche. Sie sorgen dafür, daß der Staat existent bleibt (Zwischenfrage des Rezensenten: Sorgen sie nicht für mehr?), demzufolge auch ich. / Mich interessieren die Beziehungen des Menschen zur Natur, in erster Linie die jener Leute, die intensiven Umgang mit ihr haben, ihr ein menschliches Gesicht geben.
Die Gedichte, die diesen programmatischen Sätzen am unmittelbarsten entsprechen, indem sie unser neues Dorf und die heutigen sozialistischen „feldherrn“ bei ihrer Arbeit darstellen, stammen aus der jüngsten Zeit. Gegenwärtigen ländlichen Werktag gestaltende Stücke wie „hopfenfeld“, „nachricht vom icarus bucolicus“ und „scharfenberger quartalsbericht“ lassen annehmen, daß der Dichter sein Thema nun im innersten Kern gefaßt hat und es künftig immer prägnanter gestalten kann. In manchen älteren Gedichten gibt Kirsten bei aller Dynamik der poetischen Redeweise doch nur Impressionen, die in sich selbst zu wenig oder gar nichts von der Bewegung der Wirklichkeit erfassen und mitunter den Anschein zeitloser Idyllen tragen wie das stilistisch recht kunstvolle, aber ganz als Stilleben gezeichnete „landgasthaus“). Der Dichter begegnet diesem Mangel rückwirkend durch die sorgsame Ordnung der Gedichte zu zyklischen Kapiteln, innerhalb derer auch das idyllisch beschränkte Gedicht andeutungsweise historisch relativiert wird.
Der erste dieser Zyklen heißt „herkunft“, beschränkt sich aber keineswegs auf autobiographische Reminiszenzen, sondern greift auch in die Geschichte der heimatlichen Landschaft zurück. Naturgemäß enthält die Gedichtgruppe allerlei Rückblicke in die Kindheitswelt, zeichnet sich aber allenthalben durch eine unromantische Haltung aus. Zu sentimentalen Retrospektiven auf seine Kindheit ist der geschichtsbewußte Dichter nicht fähig: Er sieht die Kindheit in einer Welt angesiedelt, die dem kleinen Bauern feindlich, vom Faschismus gezeichnet und schließlich vom Kriege gebrandmarkt war. Das Schlußgedicht des Zyklus („im häuslerwinkel“) verbindet bezeichnenderweise die Erinnerung „hingealterter kinderspiele“ mit dem Hinweis auf das Verschwinden „einfältiger lehmkabachen“; es setzt der bitteren Kriegsreminiszenz („die satzzeichen zur biographie / rochen nach lunte und / fielen vom himmel als brandfackeln! mit feuerschwänzen“) das Bewußtsein einer veränderten Welt entgegen, die das lyrische Ich ganz als seinen eigenen, ihm gemäßen Aktionsraum empfindet:
in allen knechtskammern
entsiegelt das geheimnis
landläufiger demut.
ausgerollt hab ich den lebensfaden
auf der lichtseite welt
bei lebzeiten
wie die waldrebe,
zieh meiner straße
unmittelbar.
Das kleine Kapitel „porträts“ zeigt mit besonderem Nachdruck, daß man dem Autor Unrecht täte, wollte man ihn als bloßen Landschaftsdichter verstehen und ihn auf die ausschließliche Gestaltung bäuerlicher Welt festlegen. Kirsten bemüht sich hier auch um Totenbeschwörungen, die anderen Dichtern gelten („Jakob van Hoddis“, „Ivar von Lücken“, „Paustowski“), und er versucht sich am Ende im Selbstporträt. Die Ergebnisse dieser Versuche, die zweifellos der Erweiterung des poetischen Horizonts und der Erprobung neuer Techniken dienen, mögen alle interessant sein; am überzeugendsten, kraftvollsten ist nicht zufällig das Porträt „Querner“, es stellt den mit Kirstens Landschaft und Thema engstens verbundenen Maler Curt Querner politisch pointiert und weltanschaulich verallgemeinernd in bündigen vierzeiligen Strophen vor.
Als drittes zyklisches Kapitel folgt ein Dutzend Gedichte unter der Überschrift „wege“. Hier wechselt die hymnische Apostrophierung der „dorfstraße“ („du gabst mir den anfang zu poesie. / du bist eine verschliffene grußformel, / die sich der welt zukehrt, / allmählich“) mit nuancenreichen Scherzi und elegischen Erinnerungen an Krieg und Kriegsfolgen. Das Gewicht der Verse hängt nicht unwesentlich davon ab, in welchem Grade der Dichter Bewegung in sie zu bringen versteht. Besonders hervorhebenswert scheint mir das Gedicht „chaussee“. Es fügt die Eindrücke einer geschwinden Wagenfahrt über Land zu einem Gebilde zusammen, das Kirstens beachtliche Fähigkeit, verdichtete und verschränkte Impressionen mitzuteilen, auf eine neue Art fruchtbar macht; scheinbar nur Geschenes und Sichtbares wird zu einem Ablauf gefügt, der weltanschauliche Verbindlichkeit erhält und gesellschaftliche Perspektive vermittelt. Es heißt da am Schluß:
jeder deut, jede lappalie zuseiten
gibt dem erdstrich dynamisch kontur.
auf den höhenlinien
fliegen sich zu hochsilos und kirchtürme.
hügelab schwingt auf
der anwuchs verweltlichter länderein.
das land kommt grün davon.
Trotz verdienstvoller dichterischer Arbeiten von Walter Werner und anderen ist unsere Poesie nicht reich an solchen dichten, realistischen Versen, deren konkrete Gegenständlichkeit und ideelle Weitsicht so glücklich verbunden sind wie hier. Den größten Umfang hat das letzte zyklische Kapitel („blickfelder“), eingerahmt von den schon lange bekannten gewichtigen Gedichten „die erde bei Meißen“ und „Kyleb“. In diesem Zyklus finden sich auch die bereits erwähnten unmittelbarsten Beiträge Kirstens zur lyrischen Gestaltung des heute und hier tätigen, souverän handelnden sozialistischen Menschen. Moderne agronomische Technologie bewährt sich als Gegenstand lyrischer Darstellung, durch die erlebbar wird, daß unsere Genossenschaftsbauern in mehrfachem Sinne Herren sind: kollektive Selbstherrscher über den gemeinsamen Boden, kollektive Beherrscher neuester technischer Arbeitsmittel und des modernen Arbeitsprozesses. Was zunächst noch wie ein halb idyllisches Landschaftsbild erscheint, etwa das Gedicht „winter“, erweist sich schließlich als Anti-Idylle; auch das verschneite Dorf schläft nicht, es läßt seinen Schneepflug kreisen und wird in Kirstens Versen zum Medium der Darstellung heiter-überlegener Tätigkeit:
ein schneepflug kursiert,
sachlich schiebt er beiseite
des winters sentimentale schönfärberein.
Zu den Wörtern, die Kirsten neu zu deuten bemüht ist und die er zur Verflechtung seiner Verse einsetzt, gehört in erster Linie das in vielfältiger Weise und verschiedenartigen Zusammensetzungen („wortfeld“, „blickfeld“, „feldzug“, „feldherrn“) verwendete Wort Feld. Und wie er den Begriff durch die Darstellung intensiven und extensiven, in großem Stile organisierten Kampfs um höhere landwirtschaftliche Erträge mit völlig neuem Sinn erfüllt, so zeigt er an anderen Orten seines Bandes, wie aus dem „schlachtfeld“ das Feld freier Arbeit geworden ist. Wo einst – in der Schlacht bei Kesselsdorf – die Sachsen von den Preußen schwer geschlagen wurden, dort weist er die grüne Farbe der Fluren als die Fahne der neuen Feldherrn auf.
Hier mag sich nun die eingangs als notwendig signalisierte Erörterung von Kirstens Sprache anschließen, freilich auf Andeutungen beschränkt. Wulf Kirstens Sprache ist originell, provokativ-belebend und nicht zuletzt vorwiegend heiter; sie ist der Gegenständlichkeit der Gedichte gemäß bildhaft und anschaulich. Der Dichter beherrscht in der Regel seine Gegenstände, und er erarbeitet sich seine poetische Rede darüber mit einer offensichtlichen Freude an der Sprache. Zuweilen aber läuft er Gefahr (besonders in und seit der Mitte der sechziger Jahre), seine Lexik und Bildphantasie unökonomisch wuchern zu lassen. Gar nichts ist zu sagen gegen die vielen Einmalbildungen, die oft recht bedeutungsvoll und wertungsstark geraten: „ärmlingsäcker“, „haferhandtücher“, „flickjoppenleute“, „zerstobene taglöhnerzeit“. Nichts ist auch zu sagen gegen die Verarbeitung regionalsprachlichen Materials, soweit es durch Anmerkungen gemeinverständlich gemacht wird (was nicht mit aller Konsequenz geschieht). Bedenklich stimmt schon, daß manche Bilder unbrauchbare Assoziationen auslösen oder einfach in unzweckmäßige Übertreibung ausarten. Der Hausschlächter mag in den Dörfern um Meißen und anderswo noch immer eine nötige oder geläufige Erscheinung sein; zur Umschreibung des Morgenrots (siehe das Gedicht „über sieben raine“) empfiehlt er sich wohl doch nicht. Der Sinn, den die Geschichte und Brecht dem Wort Schlächter gegeben haben, läßt sich auch und gerade beim Gedichtlesen vorerst kaum vergessen. Und warum müssen sich die Straßen vor der Rathausfassade des „marktfleckens“ dämonischerweise „zu einem tückischen knäul“ fügen, wenn dann nur gezeigt wird, daß dort der Straßenkehrer zum Samstag den Markt fegt? Am bedenklichsten aber stimmt die Tendenz zu gehäufter Einbeziehung von Fremdwörtern in eine alltagsnah gemeinte Sprache. Selbst beim poetischen Entwurf des guten Kirstenschen Programms im Titelgedicht des Bandes stellt sich gleich symptomatisch mehrfach das Fremdwort mit seinem allerdings verlockenden Beziehungsreichtum ein:
inständig benennen: die leute vom dorf,
ihre ausdauer, ihre werktagsgeduld.
aus wortfiguren standbilder setzen
einer dynastie von feldbestellern
ohne resonanznamen.
Der Dichter möge die Frage verzeihen, ob sich denn nicht am Ende mit dem gleichen Effekt ganz einfach sagen ließe: „ohne tönende namen“. Er legt einem eine solche Frage selbst nahe, indem er wieder und wieder beweist, wie gut er auch einen einfacheren Wortschatz bedeutsam und schätzbar zu machen versteht. Man könnte viele Beispiele dafür erbringen; einige wenige nur seien hier vorgebracht:
saatanfang heißt mein satzanfang.
die entwürfe in grün überflügeln
meiner wortfelder langsamen wuchs.
Anspruch und Bescheidenheit des Dichters kommen hier zugleich zur Sprache, Anschaulichkeit und Abstraktion sind in einem sprachlichen Zuge geleistet, aus geläufigem Wortmaterial entsteht etwas eindrucks- und ausdrucksvoll Neues. Der Leser muß sich um den Sinn der Verse bemühen; aber weder er noch die Sprache werden überanstrengt. Ähnliches gilt auch für die vielsagenden, sprachlich aber ganz auf der Ebene des Gegenstands bleibenden Zeilen aus dem Gedicht „dorfstraße“:
über die zaunfelder rechterhand, linkerhand
springen die wortwechsel der sprichwortphilosophen.
Und gelegentlich kommt Kirsten selbst in sprachlich zwingendes Philosophieren, etwa wenn er sein Erinnerungsgedicht „seestück“ mit der schönen Wendung schließt:
beständiger ist nichts
als die himmelsrichtungen,
die uns fortziehn mit ihren langen armen.
Die mit dieser kleinen Anthologie von Zitaten angedeutete Fähigkeit Kirstens, sich anspruchsvoll, differenziert und zugleich schlicht zu äußern, sollte der Dichter mit Bewußtheit und Disziplin weiterentwickeln. Sie ist zusammen mit seinem thematischen Anliegen eine wichtige Garantie dafür, daß man gern auf seine Verse zurückkommt, wenn man sich erst einmal mit ihnen angefreundet hat. Ein enges Verhältnis zwischen dem Dichter und seinem Leser aber ist beiden Seiten nachdrücklich zu wünschen; mögen sie zueinanderfinden!
Kirstens satzanfang ist ein guter Anfang, und er ist mehr als ein Anfang. Sein Buch bereichert nicht nur unsere sozialistische Landschaftslyrik, bringt uns nicht nur sehr bestimmte Stücke unserer Wirklichkeit auf anregende Weise nahe. Es verhilft uns überhaupt dazu, uns selbst auf Chausseen und Dorfstraßen zu begegnen, unsere Wege deutlicher zu sehen und sie bewußter zu gehen, unsere Seh- und Blickfelder, durch die originelle Optik eines Dichters erweitert, besser zu bestellen. Es nützt uns auf dem Feldzug durch unsere Gegenwart in unsere Zukunft.
Hans Richter, neue deutsche literatur, Heft 7, 1971
Bekenntnis zur tätigen Wandlung
Der Dichter Wulf Kirsten dürfte vielen Lyrikfreunden kein Unbekannter mehr sein. In zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen vor Jahren bereits die ersten Arbeiten, und man wird sich erinnern an das seinem Schaffen gewidmete vierte Poesiealbum des Verlags Neues Leben mit Gedichten, die den Ärger über anachronistische Winterschläfer und damit die Vorbereitung eines neuen Jahrtausends im Schilde führten. Das alles freilich waren nur Vorabgaben eines Poeten, dessen Talent aufhorchen ließ und Erwartungen auf Künftiges weckte und wachhielt. Wie er diese Hoffnungen rechtfertigte, belegt der Lyrikband satzanfang, der den eigenwilligen, sprachbegabten Lyriker als Vertreter einer modernen sozialistischen Naturdichtung ausweist.
Gleich im ersten Text, dessen Titel der Sammlung den Namen gab, lesen wir:
den winterschlaf abtun und
die wunschsätze verwandeln!
saataufgang heißt mein satzanfang.
Dieser Vorsatz, ein verheißungsvolles Bekenntnis zur tätigen Wandlung, spricht mehr oder weniger aus allen 50 Gedichten des Bandes, ob sie nun Kindheitserlebnisse wiedergeben, düsteres Ahnengeschick berühren oder aber im Hier und Heute angesiedelt sind. Wulf Kirsten, Nachfahre von Landleuten, besingt „die erde bei Meißen“ und eine „ortschaft an der Oder“, seine lyrische Welt umschließt „die dorfstraße“, „das vorwerk“ und den „stadtrand“, sie ist der Grundstock für eine Landschaftsdichtung mit weiter Sicht und weltanschaulicher Naturauffassung.
In zwei Gedichten betont Wulf Kirsten namentlich seine künstlerische Verwandtschaft mit dem bei Dresden lebenden Bauernmaler Curt Querner, „auf der erdrinde, / wo das gestreu der ärmlingsäcker lungert, / kegeln im karstigen gewann / bäurische plebejer mit kartoffeln“, umschreibt er die „Querner-landschaft“ und endet: „mit aquarellen kommt / Bauern-Querner.“ In einem, nach dem Maler benannten Gedicht aus dem Zyklus „porträts“ heißt es über den Freund:
ein entschlossener landgänger
geht die welt an mit seinem pinselstrich
am herben gebirgsrand auf kargem geviert.
ein mensch behauptet sich und hat bestand.
Den Band rundet der bemerkenswerte Essay „Entwurf einer Landschaft“ ab, in dem sich Wulf Kirsten zur Tradition der Lyrik von der Droste über Huchel und Brobowski bekennt. „Die Aufarbeitung und Kenntnis des Fundus (nicht nur des deutschsprachigen) ist Voraussetzung für einen eigenen Beitrag, der Fortsetzung anstrebt und um einen neuen Ton bemüht ist“, gibt er dann zu bedenken. „Tradition ist nur eine Dimension oder Achse, zu ihr muß unbedingt als zweite Dimension die Gegenwart kommen… Ohne dieses Fundament besteht wenig Aussicht auf eine eigene Handschrift.“
Wulf Kirsten hat sich eine Handschrift geprägt, sein Thema gefunden, indem er zu sich selbst fand und wissend die Landschaft betrachtete, aus der er gekommen ist. In diesem Sinn zitiert er auch Fontane, der einst schrieb: „Man sieht nur, was man weiß.“ Die stete Auseinandersetzung zwischen dem lyrischen Ich und der Gegenwart also bleibt Bedingung für ein eigenständiges Werk, wie es der Dichter in dem besprochenen Band bezeugt, mit Weltzugewandtheit und sprachlicher Eigenart, geschöpft aus dem Wortgut des bäuerlichen Bereichs, dem seine Wirklichkeit innewohnt.
Horst Buder, Neue Zeit, 29.8.1971
Soziale Naturbetrachtung
– Der Lyriker Wulf Kirsten. –
Die Lyrik in der DDR ist weitaus stärker als die Dichtung im Westen Deutschlands den Traditionen verpflichtet. Die Nachteile einer solchen Anlehnung an vorgegebene literarische Muster liegen auf der Hand; so trifft man denn vor allem bei Lyrikern minderer Begabung auf epigonales Reimgeklapper, abgegriffene Metaphorik und einen Sprachgestus, der bei allem Bemühen um politische und soziale Aktualität eher rückwärtsgewandt und konservativ anmutet.
Andererseits hat sich die lebendige und kritische Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition – die bei uns gelegentlich allzu leichtfertig verachtet wird – bei einigen Dichtern durchaus positiv ausgewirkt: aufgenommen und weiterentwickelt werden Themen, Motive und Formen, die im Westen schon als erledigt angesehen wurden.
Das gilt nicht zuletzt für die Naturlyrik, die bei uns ja zu einem gewissen Abschluss gekommen zu sein schien. Die Linie von Lehmann, Loerke und Langgässer über Eich und Krolow bis hin zu Piontek scheint nicht mehr fortzusetzen zu sein; Dichter, die einst der Naturlyrik zuzurechnen waren, gehen heute längst neue Wege.
In der DDR dagegen hat die Naturlyrik eine Fortsetzung bis in die Gegenwart gefunden: erinnert sei nur an Johannes Bobrowski und an Peter Huchel. In den letzten Jahren sind einige neue Autoren hinzugekommen, die Aufmerksamkeit verdienen. Einer von ihnen ist Wulf Kirsten, den der Aufbau-Verlag (Berlin und Weimar) jetzt mit seinem Buch satzanfang als den „Vertreter einer modernen sozialistischen Naturdichtung“ vorstellt.
Kirsten, 1934 auf dem Land bei Meissen geboren, hat sich in verschiedenen Berufen versucht: Er war Bäckerlehrling, Bauhilfsarbeiter, Buchhalter, Sachbearbeiter. Er studierte in Leipzig und lebt heute als Verlagslektor in Weimar. Mitte der fünfziger Jahre begann Kirsten zu schreiben, doch erst seit etwa 1965 veröffentlichte er regelmässig in Anthologien und Zeitschriften. Im Westen stellte Peter Hamm den Lyriker erstmals 1966 auf zehn Seiten seiner Anthologie Aussichten vor. Kirstens erste selbständige Publikation war 1968 ein Heft in der Reihe Poesiealbum (Verlag Neues Leben, Ost-Berlin). In einen kurzen Vorspruch zu den 17 Gedichten des Bändchens schrieb damals Bernd Jentzsch:
Kirstens Thema ist die aus vielfacher Sicht gesehene Landschaft: Land der eigenen Kindheit, Land, das sich vor unserer Augen verändert. Genaue Beobachtungsgabe zeichnet diese Gedichte aus, in denen die Rede ist von dem Aerger mit anachronistischen Winterschläfern und der Vorbereitung des neuen Jahrtausends.
Mit satzanfang nun liegt eine erste grössere Sammlung von Kirsten vor: Fünfzig Gedichte, entstanden zwischen 1961 und 1970, dazu eine knappe poetische Standortbestimmung mit dem Titel „Entwurf einer Landschaft“. In diesen kleinen Essay nennt der Autor seine Intentionen:
Er strebt mit seinem Naturgedicht eine Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart an. Die konkrete Landschaft wird ihm zum „Fixpunkt“; von ihrer Betrachtung geht nicht Entrückung, sondern im Gegenteil „Weltzugewandtheit“ aus – „soziale Naturbetrachtung“ heisst das Ziel:
… eine auf sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit, eine Mehrschichtigkeit, mit der soziale und historische Bezüge ins Naturbild kommen.
Der Lyriker – er beruft sich auf Fontanes Wort „Man sieht nur, was man weiss“ – geht aus von der eigenen Erfahrung, wählt den für ihn überschaubaren Ausschnitt von Welt, nicht, um ihn im Sinne engstirniger Heimatpoesie zu verabsolutieren, sondern um von ihm aus einen Blick auf die Gesamtwelt tun zu können. Dabei knüpft er ganz natürlich an die eigenen Erfahrungen der Kindheitszeit und -landschaft an, doch:
nur noch den nachduft
hingealterter kinderspiele
verströmt
aus gärten und büschen
unsichtbare kurrentschrift
zauberalten holunders.
Das ist freilich recht platt und deklamatorisch gesagt und untypisch für Kirstens sonstigen lyrischen Duktus. Denn er ist kein Mann der grossen lyrischen Gebärde: Seine Sprache Ist eher spröde, lakonisch, kantig und aufgerauht. Kein gefälliger Reim glättet die Brüche, kein leicht eingängiger Rhythmus trägt über Klippen des Verstehens hinweg. Diese Gedichte verlangen den aufmerksamen, den mitdenkenden Leser.
Einen eigenen Ton gewinnen Kirstens Gedichte unter anderem dadurch, dass der Lyriker in seine Texte häufig Wortmaterial aus der Regionalsprache seiner Landschaft einarbeitet. Dieser „grobianische scheffeldrescherdialekt“ gibt den Gedichten eine bestimmte unverwechselbare Würze. Allerdings hat Kirsten hierbei bisweilen des Guten zuviel getan, streckenweise wird es allzu kernig-urig. Besser hätte der Autor – um einmal seine Termini zu gebrauchen – hin und wieder die „Rauhbank“ benutzt, damit der Leser in den Texten nicht so häufig „rajohlen“ muss und sich wie ein „Mondwolf“ durch den „Schlier“ des „Missingsch“ wühlen – es könnte sein, dass er „Rinsen“ muss. (Worterklärungen: Siehe Anmerkungen auf den Seiten 97/98 dos Buches.)
Wulf Kirsten erwähnt in seinen Gedichten mehrfach den hierzulande kaum bekannten Maler Curt Querner, „Bauern-Querner“. Ihn nennt er in einem Porträtgedicht einen „entschlossenen landgänger“, der die Welt mit seinem Pinselstrich angeht. Aehnliches mag, abgewandelt, auch für den Lyriker Kirsten gelten, dessen Dichtung manche Gemeinsamkeiten mit der Malerei hat. Kirstens Gedichte sind materialreich, bildstark, genau im Detail. Die besten von ihnen erreichen eine atmosphärische Dichte und eine poetische Präzision, die bestand hat:
vom grat der hügelkette
fährt auf die sonnenscheibe,
brät sich auf einem schieferdach landinnen
eingefleischte provinzen,
spellt balkenköpfe, schlürft gierig braches wasser,
brennt aus zu mürbem zunder
abgemähtes wiesenstück.
geborstne erde kocht.
im gluthauch flimmt die luft.
die wochentage hantieren mit backschaufeln.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 8.5.1971
Wulf Kirsten: Vermenschlichte Landschaften
Unwillkürlich drängen sich beim Lesen von Wulf Kirstens Gedichten in seinem Band satzanfang (1970) zwei literaturhistorische Analogien auf. Erstens sind sie durch ihre monothematische Beziehung zur Welt der Naturerscheinungen, zu einer Welt mit den herkömmlichen Requisiten der „Landlyrik“, also Hütten, Straßenbäume, verlassene Mühlen, still vor sich hin murmelnde Bäche usw. jener Naturlyrik zuzuordnen, deren bedeutendste Vertreter in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts Oskar Loerke und Wilhelm Lehmann waren. Dies allerdings wäre, wie man so schön sagt, nur die eine Seite. Denn Kirsten siedelt seine Gedichte in einer klar abgesteckten geographischen und historischen Landschaft an, verleiht der Naturbeschreibung eine eigene, unverwechselbare individuelle Gestalt und wird damit zum Erben jener Lyrik, die ihren Höhepunkt bei Johannes Bobrowski fand.
Erklären wir das ausführlicher. Naturphänomenen symbolische Bedeutung zu geben, dabei den Menschen in die engste Beziehung zu setzen, den Rhythmus der Phantasie mit dem Rhythmus der Jahreszeiten zu koppeln, den lebendigen Einfluß einer ursprünglichen Magie, von archetypischen Zeichen und Vorstellungen auf den Gedichtaufbau, ja all das läßt sich ebensogut bei Kirsten wie bei Loerke und Lehmann finden. Doch aus einem beinah identischen Material läßt Kirsten eine gänzlich andere anthropologische Vision entstehen. Das will besagen: die Natur ist in seinen Gedichten keine die menschliche Existenz fatalistisch determinierende Kraft, bildet auch keinen Winkel, in den man flüchten kann, ein Sammelbecken von über der Zeit stehenden Valenzen, auf die sich ein mit den Widersprüchen der Geschichte nicht ausgesöhnter Mensch berufen kann, ganz im Gegenteil, sie geht auf in der Ordnung der menschlichen Praxis, wird dynamisiert, ihre ständigen Merkmale muß sie dabei ablegen und erhält dafür die wechselhaften, veränderbaren, jene, die sich durch Arbeit, rationelle Mühen von Hand und Verstand freilegen lassen.
Einen ähnlichen Standpunkt bezog eben Bobrowski, wenn er erklärte, daß Gegenstand seines Vortastens als Lyriker die Landschaft, in der Menschen arbeiteten, sei, daß seine Ambition darin bestehe, in der Landschaft die Geschichte der menschlichen Arbeit zu finden. Doch an dieser Stelle muß erneut deutlich abgegrenzt werden. Kirsten geht über das von Bobrowski skizzierte Dichtungsmodell mindestens einen Schritt hinaus und tut das, indem er den Begriff Arbeit erheblich weiter faßt als der Dichter der „Sarmatischen Zeit“. Sie besteht für ihn nicht nur in der Arbeit des Pflügers, der das Feld zur Aussaat aufbereitet, oder in der Arbeit des Fischers, der die Netze auswirft, um es also kurz zu sagen, nicht nur als konkrete, auf einen greifbaren pragmatischen Effekt abzielende Arbeit, sondern auch revolutionäres, prometheisches Handeln, das die Struktur der gesellschaftlichen Existenz verändert, das am menschlichen Leben insgesamt zu messen ist.
In Bobrowskis Gedichten fehlte die Gegenwart. In Kirstens poetischen Wanderungen ist die Gegenwart gerade der allgegenwärtige Bezugspunkt. Hierbei erfaßt er große historische Räume des Meißner Landes, angefangen beim Bauernaufstand im 18. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart, deren besonderes Kennzeichen in den „Luftstraßen“, „Blechvögeln“ bestehen, was also, wenn wir einmal die Einkleidung als Metapher beiseite lassen, ganz schlicht Flugzeuge, Krane, Schlepper bedeutet, die die Natur durchfurchen und ihre ewige Gestalt verändern. Dieser irgendwie reportagehafte Zug läßt die Gedichte in satzanfang zu Chronikaufzeichnungen werden, führt dazu, daß sie für eine große Fülle an epischen Elementen aufnahmefähig werden, also an Geschichtsdaten, Ortsnamen in bezug auf die Vergangenheit materieller Requisiten. Mitunter entstehen daraus Texte voller Faszination für die Überschaubarkeit und die altehrwürdige Statik in den längst vergangenen Lebensformen, die dem frenetischen Tempo und der labyrinthhaften Natur der modernen Zivilisation entgegengestellt werden. Generell allerdings darf man behaupten, daß diese Nostalgie aus der Bewegung heraus angerufen wird. Der Dichter verläßt die heimatliche Scholle, kehrt dem von den Volkstümlern, Agraristen und Veristen so viel gepriesenen Landleben den Rücken, erkennt durchaus die Notwendigkeit an, die heutige Zeit mit all ihrem modernen Beiwerk zu akzeptieren, selbst um den Preis, daß jenes „Landleben“ überhaupt ausgelöscht wird. Geht es doch nicht um die Erhaltung einer poetischen Requisitenkammer, und der ästhetische Nutzen dürfte gleich Null sein, den die Künstlerphantasie beim Umgang mit einer Welt von Provinzsitten in Gegenüberstellung zur ganzen Last der jahrhundertealten Ungerechtigkeit und Armut erhält. Kirsten weiß ausgezeichnet, daß mit dem Ende des einstigen Landlebens auch ein gewisser Lyriktypus aufhört, daß Metaphern absterben, gewisse Vergleiche unmöglich werden, daß der Schatz an „universellen“, an von einer einhundertjährigen Tradition sanktionierten Symbolen dahinschmilzt, daß es damit ausgeschlossen sein dürfte, Gedichte wie bisher zu schreiben, daß sich dann eine neue Topik und eine neue Sensibilität notwendig macht. Und das Risiko, bisher noch nie erprobte Worte auszusprechen, geht Kirsten ein.
In Gedichten, die bereits die Räume des Kommenden durchstreifen, überall dort, wo er sich auf Vorbilder seiner Vorläufer nicht berufen kann, macht er es sich mitunter – geradezu publizistisch – etwas zu leicht, schleicht sich ein Pathos ein, das das originelle, nur dem Dichter gehörende Bild etwas unglaubwürdig macht. Irgendwie im Gegensatz zu seinen eigenen Programmzielen, im Hader mit seinem eigenen Ehrgeiz bleibt Kirsten doch ein Chronist des gegenwärtig herrschenden Augenblickes. Und hier, in der Beschreibung einer Welt am Scheideweg, die zwischen den widersprüchlichen Denkordnungen hin- und hergerissen wird, liefert er uns eben das Beste, was seinen Möglichkeiten entspricht. Das geschieht überall dort, wo er sich eines echten Stoffes aus der eigenen Erfahrenswelt, aus dem intimen Kontakt und seinem tiefen Wissen um die Natur und die Menschen seiner eigentlichen Heimat bedient, wo er sie verzaubert und transformiert, hyperbolisiert, entfremdet, sie in eine Märchen- und Sagendimension herüberholt, etwa so wie das – und diese Analogie dürfte mehrfach im Falle Kirstens am Platze sein – Marc Chagall tut, wenn er die empirische Ordnung der Ereignisse und Zeiten mischt, um auf diese Weise eine echte Vision zu bekommen, eine, die den humanistischen Sinn der Dinge widerspiegelt, jene Spur, die sie im Gedächtnis und in der Phantasie zurücklassen. Surrealistische Träume von angetasteten, energiegeschwängerten Landschaften antizipieren die Erfüllung einer Utopie, sind ihre Heimstatt für heute.
Zbigniew Światłowski, 1979, aus Manfred Diersch und Hubert Orłowski (Hrsg.): Annäherung und Distanz. DDR-Literatur in der polnischen Literaurkritik, Mitteldeutscher Verlag, 1983
WULF KIRSTEN
Liest Landschaftsgedichte in einem Kulturhauskeller
in Bukarest. Ganz in der Nähe: das Haus der
rumänisch-sowjetischen Freundschaft. Die amerikanische
Bibliothek. Das Flugbüro der EL-AL. Das Haus der
Elisabeth A. Eine finnische Design-Ausstellung. Der
Sitz der P.L.O. Der Turnsaal der Germanisten. Ein
Theater.
In diesem Keller findet er kein Vorverständnis vor. Das
da ist eine andre Landschaft. Herr Bossert. Meint er.
Klaus Hensel
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


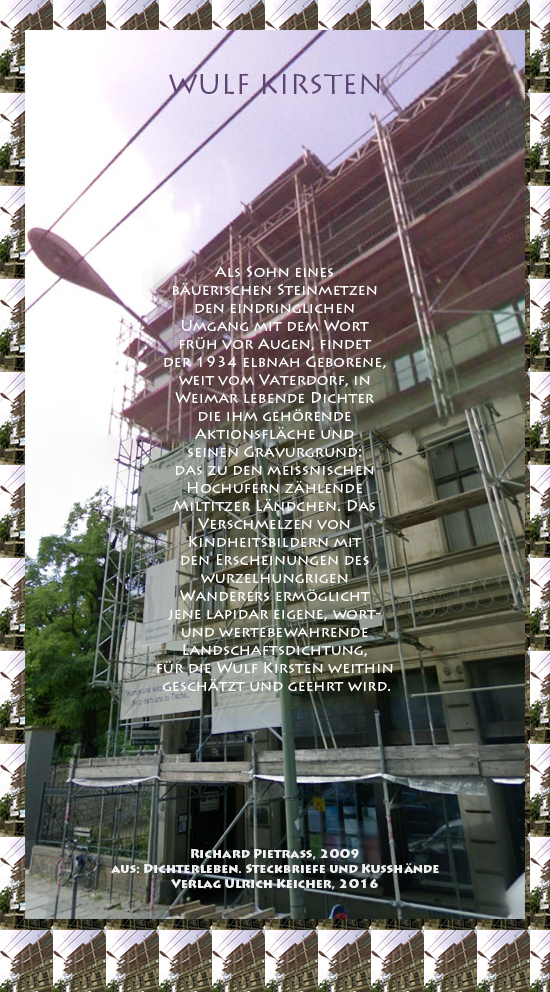








Schreibe einen Kommentar