|
rezensiert von Thomas Harbach
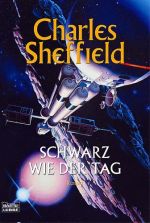 „Dark as Day“ ist die zweite Fortsetzung des ebenfalls im Rahmen der Bastei Science Fiction Reihe erschienenen Romans „Cold as Ice“. Den Mittelband „The Ganymede Club“ hat der Verlag bislang dem deutschen Publikum verschwiegen. Trotzdem bauen die beiden unmittelbar aufeinander auf und erweitern das Spektrum des 22. Jahrhundert. Die Menschheit hat den Mars, den Asteroidengürtel und die Jupitermonde besiedelt. Im Zuge dieser Expansion hat sich der Asteroidengürtel politisch isoliert und schließlich einen verheerenden Krieg gegen die anderen Siedlungen begonnen. Dabei wurden die Waffensystem immer tödlicher und perfider, bis schließlich der Gürtel kapitulieren musste. Bei dem Konflikt kamen neunzig Prozent aller Menschen ums Leben.
„Dark as Day“ ist die zweite Fortsetzung des ebenfalls im Rahmen der Bastei Science Fiction Reihe erschienenen Romans „Cold as Ice“. Den Mittelband „The Ganymede Club“ hat der Verlag bislang dem deutschen Publikum verschwiegen. Trotzdem bauen die beiden unmittelbar aufeinander auf und erweitern das Spektrum des 22. Jahrhundert. Die Menschheit hat den Mars, den Asteroidengürtel und die Jupitermonde besiedelt. Im Zuge dieser Expansion hat sich der Asteroidengürtel politisch isoliert und schließlich einen verheerenden Krieg gegen die anderen Siedlungen begonnen. Dabei wurden die Waffensystem immer tödlicher und perfider, bis schließlich der Gürtel kapitulieren musste. Bei dem Konflikt kamen neunzig Prozent aller Menschen ums Leben.
Inzwischen sind dreißig Jahre vergangen, doch immer wieder finden sich weitere geheime Lager mit noch geheimnisvolleren, tödlicheren Waffensystemen.
Rustum Battachariya – einer der Protagonisten des ersten Romans – hat Ähnlichkeit mit dem phlegmatischen, aber hochintelligenten Detektiv Nero Wolfe. Er ist einer der führenden Köpfe im Rätsel-Network- einer Online-Community der hellsten aber auch seltsamsten Köpfe. Außerdem sammelt er Relikte dieses letzten großen Krieges, in erster Linie Waffen.
Bei seiner Recherchen ist er auf eine Art Doomsday Waffe mit dem Codenamen „Dark as Day“ gestoßen. Neugierig geworden macht er sich auf den Weg.
Axel Ligon dagegen ist einer der Erben einer der reichsten Familien des Sonnensystems. Gleichzeitig ist sein Spezialgebiet die Extrapolation bestehender Trends und in dieser Tätigkeit für die Ganymed Regierung sieht er schwere Zeiten auf die einzelnen politischen
Konstellationen im Sonnensystem zukommen.
Der Dritte im Bunde – Milly Wu – ist eine SETI Sucherin, die aus dem Nichts heraus ein Signal einer fremden Intelligenz auffängt. Auch das Netzwerk und Axel Ligon interessieren sich für das Signal. Die einen wollen das unglaublich komplexe Signal entschlüsseln, für Ligon stellt die Begegnung mit einer fremden Intelligenz den einzigen Ausweg aus der
Sackgasse dar. Er hofft, dass die Menschheit an dieser Aufgabe wieder zu einer Einheit zusammenwächst und ein neuer Krieg ausgeschlossen wird.
Im Gegensatz zu Autoren wie Jack McDevitt verhindert Charles Sheffields sachlicher Ansatz schon im Vorwege jegliche Legendenbildung. Wissenschaftlich theoretisch korrekt beginnt er seinen Plot und verbindet die verschiedenen Handlungsebenen schnell zu einem geradlinigen, aber wenig phantasievollen Stoff. Darum leben seine Romane auch weniger von ihren einzelnen Plotideen und dem breit gespannten, aber ein wenig unkonzentriert wirkenden Handlungsbogen, sondern eher den Erklärungen, die der Autor seinen Figuren in den Mund legt. Hier entwickelt er zumindest ein interplanetarisches Internet, das ohne Zeitverlust mittels Quantentechnologie die einzelnen Planeten miteinander verbindet. Außerdem hat er vorsichtig die zehn Jahre, die zwischen der Gestehung des ersten und des letzten Teils dieser Serie liegen, technologisch vorsichtig in den Büchern umgesetzt.
Dazu kommt eine unglaublich detaillierte Studie der Analyse der außerirdischen Signale. Hier zeigt sich die wissenschaftliche Ausbildung Sheffields.
Nicht überzeugend dagegen ist die Extrapolation von Alex Ligons Computer Modell. Hier fehlt dem Autoren die Vision, die Asimovs Psychohistoriker auszeichnete und der Wille, einen entsprechenden Schritt weiter zu gehen. Zu eng klebt er an seinem ansonsten klassischen Handlungsverlauf, der zwar abschnittweise sehr rasant verläuft, selten sich über das Niveau seiner Vorgänger erhebt und originelle Überraschungen bietet. Der Leser hat unwillkürlich den Eindruck, eine andere Variante der Vorgängerromane um die außerirdische Komponente zwar bereichert, doch nicht belebt zu lesen.
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Tatsache begründet, dass Sheffield ganze Handlungsstränge, die die Grundlagen dieser Serie gewesen sind, komplett ignoriert. So fliegen die Supermenschen aus dem ersten teil – immerhin drei Erwachsene und sechs vermisste Kinder – wahrscheinlich weiterhin durch das All, es gibt keinen Hinweis auf ihre Entdeckung und weitere Folgen für die Reste der Menschheit und das im ersten Buch entdeckte Dyson Artefakt durch ein Teleskop wird auch nicht weiter ausgeführt. Die kristallinen Lebensformen strecken auch ihre Fühler nicht mehr aus. Sheffield hat zumindest eine Reihe von neuen Ideen in diesen Roman eingeführt, um die Widersprüche zum ersten Roman nicht zu deutlich aufflammen zu lassen.
Trotzdem überzeugt Sheffield mit einigen interessanten Ansätzen, die sich mehr im Hintergrund seines Romans abspielen: wie einige andere Autoren zeigt er uns eine Menschheit in ferner Zukunft, die dank verbesserter Körperstruktur fast unsterblich ist und augenscheinlich nicht altern. Computersysteme, die ihre menschlichen Schöpfer ausschalten und untereinander zu kommunizieren beginnen und die Begegnung mit der gewalttätigen menschlichen Vergangenheit.
Über allem schwebt aber der positive Wille, die Situation zu verbessern und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Trotz des kriegerischen Hintergrunds finden sich weder gewalttätige Szenen noch auf der anderen Seite romantische Klischees. Sein Universum erscheint als zugeordnet, zu sauber und nach den ersten Missverständnissen schließlich auch zugeordnet. Trotzdem wirkt der Roman in seiner Konzeption überraschend statisch und im Vergleich zu anderen barocken Space Operas – siehe M.John Harrison oder Alastair Reynolds – und selbst unter Berücksichtigung von insgesamt vier Handlungsebenen zu lang und zu komplex ohne nachvollziehbaren Inhalt angelegt. Auf den letzten sechzig Seiten entschließt sich Sheffield zu einer rasanten Actionsequenz- diese wirkt aber hier zu aufgesetzt als das sie ausgedürstete Leser noch überzeugen kann.
Geschickt und routiniert führt Sheffield die verschiedenen Handlungsebenen zu einem komplexen und oberflächlich unterhaltsamen Strang zusammen. Sheffield geht keine Risiken ein. Außerdem wirkt der Roman unglücklich konstruiert. Mit einem intellektuellen Schweiger als Protagonisten und als Gegengewicht opulente Mahlzeiten passt sich die Struktur dieses Buches sehr schnell seiner Umwelt an. Ruhig, fast schon gelassen und damit auch für den Leser ohne greifbare Struktur fließt alles dahin und findet schließlich einen sanften, seichten Abfluss. Vergleicht man den Roman mit dem ersten Teil, in dessen Mittelpunkt mit Cyrus Mobarak ein verschlagener, geheimnisvoller Planer gestanden hat, verzichtet „Schwarz wie der Tag“ auf jegliche Hinterhältigkeit und enthüllt eine umfangreiche und schwer nachvollziehbare, innere Suche nach ewigen Frieden und der Zukunft für eine ungezogene Menschheit.
Charles Sheffield: "Schwarz wie der Tag"
Roman, Softcover
Bastei 2005
ISBN 3-4042-4338-2

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|