|
rezensiert von Thomas Harbach
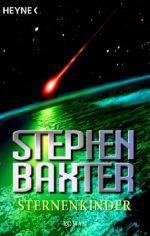 „Sternenkinder“ ist der Mittelteil von Stephen Baxters Trilogie „Destiny´s Children“.
„Sternenkinder“ ist der Mittelteil von Stephen Baxters Trilogie „Destiny´s Children“.
Nach dem ersten Eindruck der ersten beiden Bücher verbindet die Romane bislang nur ein sehr dünner Faden. Auch die angesprochenen Schicksalskinder sind oft mehr Spielball galaktischer Gewalten und politischer Ränke als Entscheidungsträger.
Ein Leser braucht allerdings weder den ersten Teil „Der Orden“ noch eine begleitende Novelle „Riding the Rock“ gelesen zu haben, um die Hintergründe dieses Romans zu verstehen. „Riding the Rock“ beschreibt dramatisch, intensiv und eindringlich den Jahrtausende währenden Krieg mit den Xeelee aus der Sicht eines jungen Kadetten und fast ausschließlich auf den zu fliegenden Festungen ausgebauten Asteroiden. Auf diese zweifelhafte Taktik geht Baxter einmal kurz zu Beginn dieses Romans ein und nimmt den Handlungsfaden später im Rahmen einer detaillierten Beschreibung der Infantrieausbildung wieder auf. Er beschreibt sie eher sachlich und nur selten überträgt er die unglaublichen Verluste der Menschheit in nachvollziehbare Einzelschicksale.
In diesen Abschnitten wirkt sein Text retro perspektivisch und über weite Strecken bleibt er eher unbewusst den Materialschlachten der frühen Perry Rhodan Serie und damit des Golden Ages der Science Fiction verhaftet. Nach den ersten Seiten wird diese Art der Kriegsdarstellung fragwürdig. Bezug auf „Den Orden“ nimmt Baxter nur an einer eher unbedeutenden Stelle. Die beiden jugendlichen Protagonisten Nilis und Pirius Red besuchen den Mars und werden in eine gewaltige Bibliothek eingeführt, in der fast 25000 Jahre Menschheitsgeschichte zusammengefasst worden sind. Betrieben wird diese Institution von einem menschlichen „Bienenstock“. Die Organisationsform gleicht dem Orden, den Regina im ersten Buch gegründet hat und dessen Entwicklung der Leser fasziniert und detailliert verfolgen konnte. Dieser Bezug zum Auftaktband ist nicht notwendig. Im Genteil- Baxter setzt mit der Handlung am schwächsten Teil des ersten Buches an. Es sind ungezählte Jahrtausende vergangen, die Menschheit lebt und arbeitet nur noch für einen Grabenkrieg mit den technologisch überlegenen Xeelee. Beide Seiten können keine entscheidenden Erfolge erringen. Dabei wird dieser Krieg nicht nur im All, sondern auch in der Zeit ausgetragen. Die einzige Veränderung ist eine ständig schwankende Front, die sich mehr und mehr zum Zentrum der Galaxis orientiert und damit die Erde aus dem Blickwinkel verloren hat.
Auf den ersten Blick wirkt die Konstellation wie eine futuristische Fortführung seines interessanten Romans „Evolution“ mit allen intellektuellen Spielereien seiner vorangegangenen Raum/Zeit Trilogie. Im Gegensatz zu den oft philosophisch theoretischen Werken kehrt Stephen Baxter zur Grundlage eines guten Romans zurück: eine interessante, möglichst vielschichtige Handlung mit dreidimensionalen Protagonisten. Es gibt in der Konzeption Ähnlichkeiten zu Orson Scott Cards berühmten Roman „Enders Game“. Wieder sind es in erster Linie Jugendliche, die mit ungewöhnlichen Ideen und mutigen Entscheidungen die zukünftige Richtung des Krieges beeinflussen, vielleicht den Status Quo erschüttern und der Menschheit zum Sieg verhelfen sollen. In Cards Roman waren die unschuldigen und unwissenden Kinder Opfer einer manipulierenden und verzweifelten Militärregierung, in Baxters Roman sind die agierenden Protagonisten zielgerichtet, neugierig und aktiv. In beiden Fällen müssen sie sich mit dem oft starren Status Quo auseinandersetzen.
„Sternenkinder“ verändert die Ausgangssituation nur in einem vielleicht entscheidenden Punk. Der Anstoß zur Veränderung kommt von der älteren Generation, die Jugendlichen müssen die Idee hinaus in das Universum und dann zurück zur Erde tragen.
Baxters fügt dem Geschehen eine politisch brisante Ebene hinzu. Er beschreibt einige Kräfte und Organisationen, die mit einem ewigen Krieg leben könnten und lieber weiterhin Menschen als Macht verlieren.
Trotz seiner ambitionierten Handlung verliert Stephen Baxter öfter den Faden und das Ziel aus seinen Augen. Der Roman wirkt – ähnlich wie die Kooperation „Zeit Odyssee“ mit Arthur C. Clarke – überhastet geschrieben und wenig fließend.
Während sich „Der Orden“ in erster Linie auf die Vergangenheit bis zur leicht veränderten Gegenwart konzentrierte, springt „Die Sternenkinder“ 25000 Jahre in die Zukunft. In der Zwischenzeit ist die Erde von außerirdischen Eroberern – den Qax – unterjocht worden. Diese konnten erfolgreich vertrieben werden und mit diesem Erfolg legte die Menschheit selbst den Grundstein für zukünftige Eroberungen in der Milchstraße. Alleine diese Zwischengeschichte könnte eine Reihe von Romanen füllen. So überspringt die Handlung diese ereignisreichen Jahre und der Leser landet direkt in dem scheinbar unendlichen Konflikt mit den exotischen Xeelee. Eine Rasse von unfassbar fortschrittlichen Außerirdischen. Über deren Entwicklung hat Stephen Baxter seit Jahren geschrieben. Seit seinem ersten Werk „Das Floß“ hat ihn deren Geschichte nicht losgelassen. Während er wie seine britischen Mitstreiter die Extreme der barocken neuen Space Opera extrapolierte, ging er mit seinen serienunabhängigen Werken immer einen Schritt weiter: eine Fortsetzung der Zeitmaschine, die Eroberung des Sonnensystems mit heute zur Verfügung stehender Technik und schließlich eine Parallelweltgeschichte, die in der bemannten Landung auf dem Mars ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Mit dem zweiten Roman dieser Trilogie geht er einen Schritt zurück: trotz seiner intellektuellen Stimulation, trotz seiner messerscharfen wissenschaftlichen Thesen ist die zugrunde liegende Geschichte direkt aus der Zeit der Pulpmagazine in die Gegenwart transportiert worden. Die Begegnung mit den Fremden muss unwidersprochen feindlich sein, eine Kommunikationsbasis wird weder gesucht noch gefunden. Da die Menschen die Xeelee nicht zu Gesicht bekommen, verzichtet Baxter auf jegliche Rassenvorurteile und nimmt dem Leser eine mögliche Sympathie/ Antipathieebene. Diese Gesichtslosigkeit unterstreicht allerdings eher die Hilflosigkeit des Militärs, ein Feindbild zu etablieren und ein Ziel für die sinnlose Opferung zu fabulieren. Trotzdem wirken die hierarchischen Führungsstrukturen geschlossen und entschlossen. Unbewusst erhält Baxters Roman dadurch wieder Aktualität.
Viele Tendenzen, die in seinem Roman in einem unglaublich komplexen Vernichtungskrieg kumulierten, übernimmt er aus der gegenwärtigen politischen Lage. Konfrontation statt Kooperation, Missverständnisse ausleben statt klären und schließlich unterschiedliche Wertmaßstäbe anwenden. Dabei malt Baxter polemisch schwarz weiß: in seinem Universum müssen alle Menschen negativ auf die Fremden reagieren und diese düsteren Aussichten tragen die Geschichte.
Den einzigen logischen und lesenswerten Ausweg offenbart die Integration des Elements Zeit in die Handlung. Damit wird dem Autoren, den Lesern und schließlich den Soldaten ene wichtige Brücke gebaut. Baxter legt seinen Konflikt als indirekten und nicht gewollten Zitkrieg an. Darum ist der Katalysator der möglichen Veränderungen ein alt gedienter Soldat, dem durch seine „Feigheit vor dem Feind“ und der daraus resultierenden Flucht der Schlüssel für eine Lösung in die Hände fällt. Durch eine Manipulation der Kausalzusammenhänge kann der junge Pilot Pirius – trotzdem er Veteran einiger Schlachten – ein Xeeleeschiff aufbringen und zu einer menschlichen Basis fliegen. Obwohl er als Verräter gebrandmarkt wird und das Verhalten der Militärs offenkundig von dem Autoren konstruiert worden ist, um seinen Handlungsbogen weiterführen zu können, entstehen in relativ schneller Abfolge die besten Ideen des Buches. Der Überlichtflug der Jäger zerstört deren physikalische Umgebung und macht aus ihnen kleine Zeitmaschinen. Dadurch können zukünftige Strategien im Vorwege aus deren Ergebnissen analysiert werden. Dadurch bringt Pirius aus seiner Gegenwart einen Xeelee- Jäger in die jüngere Vergangenheit. Dadurch kann er seinem jüngeren Ich begegnen, das mit ihm zusammen vor Gericht gestellt wird. Die Begegnung der beiden ähnlichen Charaktere – nur die Erlebnisse der einzelnen Einsätze und ihre Einstellung zum sinnlosen Heldentum trennen die beiden noch – ist eine der besten Szenen des Buches. Aus ihnen kann ein außen stehender Betrachter auch die Sinnlosigkeit dieses modernen Grabenkrieges ablesen. Da beide Seiten die Ergebnisse verlorener Schlachten durch Zeitreisen manipulieren können, bewegt sich die Front nicht mehr und die Opferbereitschaft der einzelnen Fußsoldaten wird systematisch zermürbt. In erster Linie die Menschheit muss sehr schnell ein überraschendes Element in diese Gleichung des Todes einbringen, wenn sie überleben möchte. Für ranghohe Militärs stellt die Kaperung des Xeelee Schiffes dieses überraschende, destabilisierende Element dar. Mit trockenem Humor entlarvt Baxter Kriege als sinnlose Rückbesinnung auf kommunikationslose Zeiten. Sein Krieg ist weder technologisch ein Fortschritt noch gesellschaftspolitisch ein tragbares Element. Es ist eine Aushöhlung individueller Stärken zugunsten eines fragwürdigen Gleichschaltens und einer Diktatur der Befehlshaber. Um diese Botschaft zu verstärken, begibt sich der Autor mit seinen nächsten Prämissen auf sehr dünnes Eis. Handlungstechnisch notwendig gelingt es ihm nicht, diesen einen logischen Rahmen zu geben.
Für Pirius Vorgesetzte ist Flucht vor dem Feind Feigheit und Individualität ein Verbrechen. Damit schließt er unbewusst den Kreis zu der Bienenstockgesellschaft auf dem Mars. Für Baxter stellen die Soldatenschmieden – von Geburt an für ein kurzes Leben und auf äußerste Pflichterfüllung gedrillt - eine Perversion dar. Er stellt nicht nur den Krieg per se, sondern dessen Einfluss auf eine nicht wieder zuerkennende Gesellschaft in Frage. Seine Argumentation, an der Baxter als Autor scheitert, ist dagegen nicht nachzuvollziehen. Es ist unwahrscheinlich, dass selbst die strengste militärische Hierarchie seine Soldaten bestraft, weil sie einen Weg gefunden haben, den irrsinnigen Krieg zu gewinnen und damit zu beenden. Die Betonung liegt nicht auf beenden, sondern Pirius schenkt der Menschheit eine echte Siegchance. Der Autor stellt die These auf, dass Gesellschaften, die sich eng an Dogmen orientieren, unwillkürlich in eine Art Stasis übergehen und Entscheidungen kaum noch zu treffen sind, doch es ist unwahrscheinlich, dass selbst die starrste Regierung nicht den Faden aufnehmen könnte. Darum muss Pirius natürlich von einem Außenseiter, einem Querdenker gerettet werden. Hier kommt es zum zweiten Widerspruch im Roman. Der ältere Pirius – in der Folge Pirius Blau genannt – wird zu einem Infanteriestützpunkt abkommandiert, um zum Kanonenfutter ausgebildet zu werden und das jüngere Pirius- Ich – jetzt Pirius Rot genannt – darf mit seiner Sexfreundin in Begleitung des Querdenkers Nilis zur Erde fliegen, um dort die Theorien des Pirius Blau vorzustellen. Dabei lässt es Baxter vollkommen offen, warum die Beiden ihre Positionen tauschen müssen und ausgerechnet der erfahrene Pirius Blau noch einmal in die Ausbildung darf. Unentschlossen beschreibt Baxter im mittleren Teil seines Buches die Reise der drei unterschiedlichen Charaktere – Pirius Rot, seine Freundin und Nilis - durch das Sonnensystem. Erst zur Erde, dann zu Mars, schließlich zu den Saturnmonden und letzt endlich zum Pluto. Damit negiert er den galaxisweiten Hintergrund zu Beginn des Romans und stellt auch noch die These auf, dass der technologische Fortschritt gegenläufig der Expansion der Menschheit ins All ist. Darum wirken die Szenen im Sonnensystem am Vertrautesten, fast schon archaisch.
Während Pirius und Nilis im Sonnensystem ihre Waffe entwickeln, begegnen sie einer Reihe von interessanten Nebencharakteren. So kommen sie in Kontakt mit Luru Parz, einem Veteranen der Qax Besetzung der Erde von 20000 Jahren. Er erhielt das Geschenk potentieller Unsterblichkeit als Gegenleistung für seine Kooperation mit den Besatzern. Sie wird allerdings nicht als mahnendes Beispiel vorgezeigt, sondern versteckt. Die Regierung der Erde hofft, dass sie vielleicht doch noch über geheimes Wissen verfügt. Nach 20000 Jahren! Da sage noch jemand, Bürokraten arbeiten langsam. Außerdem verzichtet Baxter auf jegliche moralische Implikationen und beschreibt die Episode eher neutral. Hinzu fügt er eine Reihe von typischen Diskussionen mit den ewig Gestrigen. Dabei bemüht sich Baxter, der Unzahl von Figuren – Vielzahl wäre ein zu schwaches Wort – zumindest Anflüge von individuellen Charaktereigenschaften zu geben. Trotzdem wirken sie eher steif und unbeholfen. Die ganze im Sonnensystem spielende Episode hätte eher in einen anderen, konzeptionell eigenständigen Roman verlegt werden sollen. Der einzige Nutzen Luru Parz besteht in ihrer Katalysatorfunktion. Sie öffnet Pirius und Nilis als eine Art Helptaste die Augen. Danach verschwindet sie wieder zum Bedauern der Leser in ihrer unsterblichen Unendlichkeit. Nach diesem sehr schwachen und phasenweise unoriginellen Mittelteil nehmen Handlung und Konzept im letzten Drittel des Buches wieder Fahrt auf.
Die potentielle Lösung wirft neue Ansätze und Ideen auf. Baxter etabliert die Xeelee als parasitäre Rasse eines in den Schwarzen Löchern schlafenden Muttervolkes. Außerdem entwickelt er eine weitere symbiotische Lebensform. Im Gegensatz zu dem abrupten Szeneriewechsel im ersten Roman bleibt Baxter in dem von ihm geschaffenen Universum. Trotzdem wirkt der Abschluss gedrängt und unvollständig. Zwischen der Erkenntnis, eine mögliche „Waffe“ gegen die Xeelee gefunden zu haben und dem Beginn der Umsetzung der Idee vergehen fast fünfhundert Seiten, auf den letzten zweihundert Seiten verdrängt Baxter alle militärischen Strömungen und macht aus den expansiven und aggressiven Menschen eine Art Reinigungstruppe für galaktische Schlafhöhlen. So faszinierend die Idee ist, so schlecht funktioniert die Umsetzung. Das keine anderen Völker auf die parasitären Xeelle reagiert haben, wirkt unglaubwürdig.
Oft waren die einzelnen Charaktere in seinen Romanen von einer farbenprächtigen und vielschichtigen Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand gedrückt worden. In diesem Roman vollzieht Baxter einen Wechsel. Mit Pirius verfügt der Leser in doppelter Hinsicht über einen Charakter, mit dem er sich identifizieren kann. Dabei überzeugen die Szenen mit dem erfahrenen, älteren Pirius Blau mehr. Obwohl ihm weniger Raum zur Verfügung steht, sind seine Erfahrungen intensiver. Baxter beschreibt die brutale Ausbildung zum Infanteristen. Um ihn herum sterben alle seine Kontakte, Freunde können sie nicht werden, dazu ist die Zeit zwischen Kennen lernen und sterben viel zu kurz. Diese düsteren und deprimierenden Szenen geben dem Roman eine emotionale Tiefe. Oft wird Baxter vorgeworfen, dass sein Werk zu philosophisch theoretisch ist. Schon in „Riding the rock“ beschrieb er mit unvoreingenommener Offenheit die blutige Seite auch eines eher anonym geführten Krieges in den Tiefen des Alls. Weniger breit, aber dafür in die Tiefe gehend nimmt er diesen Faden wieder auf. Es lohnt sich, erst die Novelle zu lesen und dann zu diesem umfangreichen Roman zurückzukehren. Außerdem fehlt dem Autoren der oft gescholtene Optimismus. Im Gegensatz zu seinem eigenen Werk und den intellektuellen Gedankenspielen anderer Science Fiction Autoren hat sich seine Menschheit keinen Schritt, keinen Deut weiter entwickelt. Baxters Menschheit ist weiterhin oberflächlich, egoistisch und selbstsüchtig. Vorurteile bilden in den meisten Fällen die Entscheidungsgrundlage. Damit negiert er einige der Ideen, die er in „Der Orden“ aufgeworfen hat. Der Leser vermisst ein verbindendes Element zwischen den beiden Romanen. Der fortlaufende rote Faden ist die „Züchtung“ von gleichartigen Menschen. Aus der kleinen isolierten Gemeinschaft im ersten Roman ist eine ausschließend militärisch genutzte Institution weit draußen im All geworden. Nur durch ihren menschenverachtenden industriellen Schöpfungsprozess stehen den Befehlshabern ausreichende Rohstoffe zur Verfügung, um einen ewigen Grabenkrieg durchzustehen. Diese Botschaft ist aufrüttelnd, zynisch und weist auf aktuelle politische Bestrebungen an.
Diese Botschaft hat Baxter allerdings auch in seiner Novelle „Riding the Rock“ deutlich in Worte gefasst. Für diese Botschaft benötigt er keinen weiteren, mit siebenhundert Seiten viel zu umfangreichen Roman. Darum ist „Sternenkinder“ der Versuch, diese Botschaft, diese Idee in einen größeren Rahmen zu verpflanzen. Dieser Versuch ist gründlich misslungen. Zwischen den einzelnen Teilstücken findet sich zu viel Leerraum. Trotzdem ist „Sternenkinder“ eine interessante Lektüre, ein Pulpabenteuer im barocken Neogewand, vielleicht sogar eine weitere neue Richtung der Space Opera. Wie viele Werke aus seiner Feder ist dieses Modell mit einer heißen Nadel gestrickt worden und weist eine Reihe von Oberflächlichkeiten und Schwächen aus. Stephen Baxter würde es gut zu Gesicht stehen, weniger zu veröffentlichen und seine nächsten Romane zu zentrieren. In Bezug auf seinen Ideenreichtum und seine großartigen Zukunftsvisionen gehört er weiterhin zu den wichtigsten englischen Autoren.
Stephen Baxter: "Sternenkinder"
Anthologie, Hardcover
Heyne 2005
ISBN 3-4535-2101-3

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|