Literatur im Lichthof (Ausg. 5/2014) - Zoom
Bernhard Aichner: Totenfrau. Thriller.
Bernhard Sandbichler
Josef Feichtinger: Kämpfen für das Heiligste. Tiroler Stimmen zum Ersten Weltkrieg. Mit einem Vorwort von Oswald Überegger und einem Audio-Feature unter der Regie von Luis Benedikter. Doch Willram und Reimmichl sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Namen derer, die literarische Kriegspropaganda gemacht haben, Männer wie Frauen, sind Legion. Hier seien willkürlich einige namentlich genannt: Marie von Buol, Rudolf Greinz, Karl Emerich Hirt, Franz Kranewitter, Bartholomäus Del Pero, Klara Pölt-Nordheim, Karl Zangerle. Natürlich sind in den Texten deutliche Unterschiede und Abstufungen in der Motivation zu bemerken; manche mögen tatsächlich für die Ermunterung der Soldaten und der Menschen im Hinterland gedacht gewesen sein und auch als solche gewirkt haben. Als Gegengewichte zu den vielen martialischen tirolischen Äußerungen hat Feichtinger immer wieder kriegskritische Texte eingebaut, u.a. von Karl Kraus, Kurt Tucholsky, Hermann Hesse. Aber es gibt, wenn auch wenige, kritische Stimmen aus Tirol, die der Kriegsverherrlichung nicht das Wort reden. Etwa Georg Gallmetzers Tagebuchaufzeichnungen, die freilich erst 1999 erschienen sind und also nicht der Zensur unterlagen. Er kritisiert immer wieder unverblümt seine inkompetenten Vorgesetzten, auch wenn er anfänglich auch von der patriotischen Begeisterungswelle mitgenommen wird. Auch Kriegsgräuel schildert er offen und scheut sich nicht, die vielgeschmähten Russen mit den Österreichern zu vergleichen. Und da ist auch Ludwig von Ficker mit den Briefen an seine Frau Cissi, an Kraus und Ludwig Wittgenstein, und einige seiner „Brenner“-Mitarbeiter: Georg Trakl mit „Grodek“, Theodor Haecker mit seinem Essay „Der Krieg und Führer des Geistes“, Carl Dallago mit seiner Broschüre „Ueber politische Tätigkeit, den Krieg und das Trentino“ und seinen Gedichten, Josef Leitgeb (der seine Jugend im Weltkrieg verlor und dann auch noch den Zweiten Weltkrieg aktiv mitmachen musste) mit seinen Kriegserinnerungen, Richard Huldschiner, dem mit seinem Text „Standschützen auf der Wacht“ laut Feichtinger „eine der schönsten Schilderungen aus dem Krieg“ gelingt. Doch war da auch noch ein Joseph Georg Oberkofler, der das Leid der Mütter ganz im katholischen Sinn durch die Unterwerfung in den Willen Gottes sublimieren lässt (laut Feichtingers spitzigem Kommentar) und ein Arthur von Wallpach, dessen Gedichtband „Wir brechen durch den Tod“ eine Fundgrube für Feichtinger war, denn für Wallpach war der Krieg lange Zeit ein „frohes Fest“, der Kampf eine echte Bewährungsprobe für die Männer. Feichtinger hat versucht, seine Texte thematisch zu gliedern: Der Anfang, Militärs, Feinde, Religion, Tirolismus, Frontalltag, Frauen im Krieg, Kriegsopfer, Zusammenbruch. Diese Gliederung hat selbstverständlich ihre Tücken, Überschneidungen sind vorprogrammiert. So kommt es zu Wiederholungen, manchmal wohl auch dadurch bedingt, dass Feichtinger seine vielen Funde eben auch unterbringen wollte, was verständlich ist, wenn man sich die große Arbeit vor Augen hält, die in dieser Auswahl und Zusammenstellung steckt. In manche bio-bibliografische Angabe, die jedem Autor einer derartigen Sammlung wie immer in letzter Sekunde noch abgerungen wird, haben sich einige Fehler eingeschlichen. Es ist eben ein nicht unwesentlicher Unterschied, ob Dallago seine Kritik an Mussolini „Die Diktatur des Wahns“ 1938 verfasst hat, oder richtig schon zehn Jahre früher, 1928. Als letztes Kapitel hat Feichtinger Texte zusammengestellt unter dem Titel „Vom Weltkrieg in den Weltkrieg“. Eindrucksvoll wird vorgeführt, wie nahezu zwangsläufig der Zweite Weltkrieg auf den ersten folgte. Und da waren es die Weltkriegsromane eines Anton Graf Bossi-Fedrigotti, eines Luis Trenkers, eines Karl Springenschmids, eine Oswald Menghins – Dokumente des „Militarismus“, die laut Feichtinger bereits den „Trommelklang einer kommenden Zeit“ (des Nationalsozialismus) hören, die „das Soldatentum der Deutschen“ verherrlichen. Dem Buch beigelegt ist eine CD, betitelt mit „Der Heilige Krieg“, konzipiert und gestaltet von Jutta Wieser (Aufnahmeregie und Sprecher: Luis Benedikter). Schauspieler lesen Texte aus dem Buch, es gibt aber auch historische Aufnahmen, etwa von Kaiser Franz Joseph und Viktor Dankl, Interviews mit Josef Feichtinger und Ulrike Kindl, die eindeutige Aussagen zum Krieg macht: „Es gibt keinen Krieg, der verteidigt werden kann, der gerecht ist. Es gibt nur unfähige Politiker, die einen Krieg nicht verhindern können.“
Irene Heisz, Julia Hammerle: Tirol - hoch hinaus und tief verwurzelt. Von Zugspitzblick bis Aguntum. Magische Zahlen für Reisende
Ju Innerhofer: Die Bar. Eine Erzählung.
Gerhard Kofler: Das Universum der kostbaren Minuten / L‘ universo dei minuti preziosi. Band 1 der Trilogie Gedächtnis der Wellen / La memoria delle onde.
Waltraud Mittich: Abschied von der Serenissima. Roman. Im Zentrum: die am Rande der Geschichte Stehenden
Herbert Rosendorfer: Ich beginne, an der Nicht-Existenz Gottes zu zweifeln … Letzte Gespräche. Herausgegeben von Julia Rosendorfer und Paul Sahner. Mit 23 s/w-Fotos und zahlreichen Zeichnungen und Faksimiles.
Herbert Rosendorfer: Martha. Von einem schadhaften Leben. Roman.
Judith W. Taschler: Apanies Perlen. Vier Erzählungen.
Judith W. Taschler: Roman ohne U. Wien. Problematische Ironie des Schicksals
Verena Teissl: Kulturveranstaltung Festival. Formate, Entstehung, Potenziale. Vera Vieider: Gebettete Landschaft. Gedichte. Mit einem PVC-Schnitt von Josua Reichert.
Wir wünschen der Autorin, dass sie dem Roten, dem Stechenden aber auch Leuchtenden, und dem Glühenden in ihren zukünftigen Büchern weiten Raum gebe. Gebettete Landschaft ist eine verheißungsvolle Ankündigung: Am Horizont / rot durchzogen die Naht …
Erika Wimmer: Nellys Version der Geschichte. Roman. |
|||||||||||
zoom.html - zoom.html
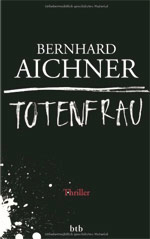 Bernhard Aichner ist am Zenit angekommen und strahlt. Am Bücherhimmel gibt es ja viele Gestirne, manche sieht man mit freiem Auge nicht, andere leuchten so stark, dass sie einen unübersehbar blenden, viele changieren irgendwo dazwischen. Wie es dazu kommt, ist jeweils interessant. Wie also kommt es bei diesem Autor zum unübersehbaren Funkeln?
Bernhard Aichner ist am Zenit angekommen und strahlt. Am Bücherhimmel gibt es ja viele Gestirne, manche sieht man mit freiem Auge nicht, andere leuchten so stark, dass sie einen unübersehbar blenden, viele changieren irgendwo dazwischen. Wie es dazu kommt, ist jeweils interessant. Wie also kommt es bei diesem Autor zum unübersehbaren Funkeln? Gleich vorweg: Josef Feichtinger legt hier eine bewundernswerte Sammlung von Texten bzw. Textauszügen aus Romanen, Tagebüchern, Erinnerungsschriften, Zeitungen und Zeitschriften vor. Was in diesen erschreckenden, irritierenden, skurrilen Dokumenten zu lesen ist, bestätigt selbstverständlich, was schon längst landläufig bekannt war, dass nämlich der Erste Weltkrieg auch ein großer Propagandakrieg war und dass viele bedeutende Persönlichkeiten an der geistigen Mobilmachung mitgewirkt haben. Dass dies ein Bruder Willram in reichlichem Maße getan hat, ist schon seit längerem durch die Forschungen von Eberhard Sauermann dokumentiert. Dass sich aber auch sein Priesterkollege Reimmichl als fanatischer Kriegstreiber betätigt hat, rückt erst dieses Buch voll ins Bewusstsein. Als populärer „Botenmann“ – er gab den „Tiroler Volksboten“ gemeinsam mit dem Geistlichen Josef Grinner heraus – brachte er seine Botschaften bis zu den einfachen Menschen, die seiner Predigerlogik und Demagogie wohl wenig entgegenzusetzen hatten. Schon im August 1914 konstatiert Reimmichl einen neu erstarkten Patriotismus im Vielvölkerstaat, „eine großartige religiöse sittliche Erhebung“ (S. 28), die sich durch vermehrtes Kirchengehen und Beichten anzeigt, gar Sozialdemokraten will er da gesehen haben. Volksbelustigungen und Touristen verschwänden samt ihrer unzüchtigen Kleidung, Einfachheit, Sparsamkeit und Opfermut kämen wieder auf. 1918 ist plötzlich von den Verheerungen des Krieges die Rede, von Unsittlichkeit, vom Zusammenbruch der Religion. Feichtinger hat – wie auch bei vielen anderen Texten – einen süffisanten, kritischen Kommentar dazu verfasst: „Wo ist der ‚Völkerfrühling‘ geblieben und die ‚großartige sittliche Erhebung der Völker‘? Die ‚Botenmänner‘ setzen auf die Vergesslichkeit ihrer Leser.“ (s. 29)
Gleich vorweg: Josef Feichtinger legt hier eine bewundernswerte Sammlung von Texten bzw. Textauszügen aus Romanen, Tagebüchern, Erinnerungsschriften, Zeitungen und Zeitschriften vor. Was in diesen erschreckenden, irritierenden, skurrilen Dokumenten zu lesen ist, bestätigt selbstverständlich, was schon längst landläufig bekannt war, dass nämlich der Erste Weltkrieg auch ein großer Propagandakrieg war und dass viele bedeutende Persönlichkeiten an der geistigen Mobilmachung mitgewirkt haben. Dass dies ein Bruder Willram in reichlichem Maße getan hat, ist schon seit längerem durch die Forschungen von Eberhard Sauermann dokumentiert. Dass sich aber auch sein Priesterkollege Reimmichl als fanatischer Kriegstreiber betätigt hat, rückt erst dieses Buch voll ins Bewusstsein. Als populärer „Botenmann“ – er gab den „Tiroler Volksboten“ gemeinsam mit dem Geistlichen Josef Grinner heraus – brachte er seine Botschaften bis zu den einfachen Menschen, die seiner Predigerlogik und Demagogie wohl wenig entgegenzusetzen hatten. Schon im August 1914 konstatiert Reimmichl einen neu erstarkten Patriotismus im Vielvölkerstaat, „eine großartige religiöse sittliche Erhebung“ (S. 28), die sich durch vermehrtes Kirchengehen und Beichten anzeigt, gar Sozialdemokraten will er da gesehen haben. Volksbelustigungen und Touristen verschwänden samt ihrer unzüchtigen Kleidung, Einfachheit, Sparsamkeit und Opfermut kämen wieder auf. 1918 ist plötzlich von den Verheerungen des Krieges die Rede, von Unsittlichkeit, vom Zusammenbruch der Religion. Feichtinger hat – wie auch bei vielen anderen Texten – einen süffisanten, kritischen Kommentar dazu verfasst: „Wo ist der ‚Völkerfrühling‘ geblieben und die ‚großartige sittliche Erhebung der Völker‘? Die ‚Botenmänner‘ setzen auf die Vergesslichkeit ihrer Leser.“ (s. 29) Mit Zu Ende gebaut ist nie − bei Haymon in einer bibliophilen Ausgabe erschienen – legt Sabine Gruber ein sehr persönliches Buch vor. In nur 14 Gedichten, auf wenig Raum also und mit sparsamen Mitteln, beleuchtet die Autorin Aspekte einer omnipräsenten Vergänglichkeit. Außenansichten und Innenschau werden kontrastiert; Blendung und Lüge einerseits, Ernüchterung und die Erfahrung von kalter Leere andererseits ziehen sich leitmotivisch durch die Gedichte. Vor allem aber ist es der hinter allen Masken lauernde (physische und seelische) Tod, in dessen Zeichen der Zyklus steht. Es ist der barocke Vanitas-Gedanke, der hier in einer aktuellen, gleichermaßen reduzierten wie reflektierten Form neu formuliert wird.
Mit Zu Ende gebaut ist nie − bei Haymon in einer bibliophilen Ausgabe erschienen – legt Sabine Gruber ein sehr persönliches Buch vor. In nur 14 Gedichten, auf wenig Raum also und mit sparsamen Mitteln, beleuchtet die Autorin Aspekte einer omnipräsenten Vergänglichkeit. Außenansichten und Innenschau werden kontrastiert; Blendung und Lüge einerseits, Ernüchterung und die Erfahrung von kalter Leere andererseits ziehen sich leitmotivisch durch die Gedichte. Vor allem aber ist es der hinter allen Masken lauernde (physische und seelische) Tod, in dessen Zeichen der Zyklus steht. Es ist der barocke Vanitas-Gedanke, der hier in einer aktuellen, gleichermaßen reduzierten wie reflektierten Form neu formuliert wird. “Neapel” oder wahlweise “Rom sehen und sterben” ist ein irreführendes geflügeltes Wort. Patricia Schultz hat den Sager schon vor Zeiten vertausendfacht: 1000 Places to see before you die heißt ihr millionenfach verkaufter Wälzer. 36 ist eine weitere Zahl, die im Sektor Reiseempfehlungsliteratur auftaucht, vom Taschenverlag in rot gefärbtes Leinen gebunden, auf das in seriöser Fraktur der Schriftzug “The New York Times” geprägt ist. Es geht um 125 Wochenenden in Europa, welche diverse schreibende Kapazunder des Traditionsblattes den LerserInnen auf 4 bis 6 Seiten in Wort und Bild anempfehlen - schließlich sind die Wochenend-Trips auf jeweils 36 Stunden Aufenthalt anberaumt.
“Neapel” oder wahlweise “Rom sehen und sterben” ist ein irreführendes geflügeltes Wort. Patricia Schultz hat den Sager schon vor Zeiten vertausendfacht: 1000 Places to see before you die heißt ihr millionenfach verkaufter Wälzer. 36 ist eine weitere Zahl, die im Sektor Reiseempfehlungsliteratur auftaucht, vom Taschenverlag in rot gefärbtes Leinen gebunden, auf das in seriöser Fraktur der Schriftzug “The New York Times” geprägt ist. Es geht um 125 Wochenenden in Europa, welche diverse schreibende Kapazunder des Traditionsblattes den LerserInnen auf 4 bis 6 Seiten in Wort und Bild anempfehlen - schließlich sind die Wochenend-Trips auf jeweils 36 Stunden Aufenthalt anberaumt. “Unser Leben währet siebenzig Jahr, und wenn’s hoch kömmt, so sind’s achtzig Jahr, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Müh und Arbeit gewesen.”
“Unser Leben währet siebenzig Jahr, und wenn’s hoch kömmt, so sind’s achtzig Jahr, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Müh und Arbeit gewesen.” Im Nachhinein liest man die letzten Texte oder Gedichte eines Autors oft im Hinblick auf Hinweise auf den nahenden Tod. Diese müssen nicht immer sichtbar sein und doch bekommt man beim Lesen dieses Gedichtbandes von Gerhard Kofler den Eindruck, dass das Lebensende des lyrischen Ichs spürbar näher gerückt ist. Eine gewisse Melancholie breitet sich in den Versen aus, sie wird in mehreren Gedichten auch explizit benannt, immer wieder schaut das Ich auf vergangene Tage zurück, das Sich-Erinnern wird zunehmend präsent, der Blick in die Zukunft kürzer. Die Frage nach dem Ziel der Reise drängt sich auf, „wo bin ich angekommen? / dove sono arrivato?“ (16/17), der Lebenszyklus kommt verstärkt ins Bewusstsein, die Kindheit und der Vater, der Aufbruch und eine Vorahnung vom Antritt der letzten Reise. Mehrere „genuin Kofler‘sche Motive“ (220 Brugnolo/Drumbl im Nachwort) kehren in diesem kostbaren poetischen Buch, das vierzig Gedichte aus dem Nachlass des Autors vereint, in Variationen wieder: das Meer, die Reise, die Sprachen, der Gesang.
Im Nachhinein liest man die letzten Texte oder Gedichte eines Autors oft im Hinblick auf Hinweise auf den nahenden Tod. Diese müssen nicht immer sichtbar sein und doch bekommt man beim Lesen dieses Gedichtbandes von Gerhard Kofler den Eindruck, dass das Lebensende des lyrischen Ichs spürbar näher gerückt ist. Eine gewisse Melancholie breitet sich in den Versen aus, sie wird in mehreren Gedichten auch explizit benannt, immer wieder schaut das Ich auf vergangene Tage zurück, das Sich-Erinnern wird zunehmend präsent, der Blick in die Zukunft kürzer. Die Frage nach dem Ziel der Reise drängt sich auf, „wo bin ich angekommen? / dove sono arrivato?“ (16/17), der Lebenszyklus kommt verstärkt ins Bewusstsein, die Kindheit und der Vater, der Aufbruch und eine Vorahnung vom Antritt der letzten Reise. Mehrere „genuin Kofler‘sche Motive“ (220 Brugnolo/Drumbl im Nachwort) kehren in diesem kostbaren poetischen Buch, das vierzig Gedichte aus dem Nachlass des Autors vereint, in Variationen wieder: das Meer, die Reise, die Sprachen, der Gesang.  „Straβen als Auβenräume begehen, abgehen, noch einmal gehen, wird in den folgenden Geschichten eine Art Programm sein, Leitmotiv, Konstante. Vom Menschen auβerhalb seiner Wohnräume am meisten benutzt und gestaltet, wie sollten wir nicht daran denken, ihr Schicksal auf gleicher Höhe zu betrachten und zu beschreiben wie das unsere.“ (5) – so beginnt das Buch Abschied von der Serenissima von Waltraud Mittich. Ein autofiktionaler Roman, der Lebenspfade, aber auch konkrete Wege und Straβen in aller Bewusstheit noch einmal begeht. Im Zentrum stehen weibliche Biographien des 20. Jahrhunderts, die mit Südtirol in Verbindung stehen. Der Roman ist vielschichtig: Drei Kapitel geben ihm Struktur, jedes von ihnen erzählt eine bestimmte Zeitepoche (ausgehend von den 1920er Jahren bis zu den 1980er Jahren). Hier geht die Autorin chronologisch vor, während auf der Mikroebene des Textes die zeitliche Folge an Bedeutung verliert – Erinnerungen widersetzen sich den Chronologien. Vorangestellt ist ein kurzer Prolog, der thematisch in das Thema der Wege und Straβen einführt und gemeinsam mit dem Epilog zur Serenissima „als Name für eine Autobahn, die nach Osten führt“ (223) den Rahmen bildet.
„Straβen als Auβenräume begehen, abgehen, noch einmal gehen, wird in den folgenden Geschichten eine Art Programm sein, Leitmotiv, Konstante. Vom Menschen auβerhalb seiner Wohnräume am meisten benutzt und gestaltet, wie sollten wir nicht daran denken, ihr Schicksal auf gleicher Höhe zu betrachten und zu beschreiben wie das unsere.“ (5) – so beginnt das Buch Abschied von der Serenissima von Waltraud Mittich. Ein autofiktionaler Roman, der Lebenspfade, aber auch konkrete Wege und Straβen in aller Bewusstheit noch einmal begeht. Im Zentrum stehen weibliche Biographien des 20. Jahrhunderts, die mit Südtirol in Verbindung stehen. Der Roman ist vielschichtig: Drei Kapitel geben ihm Struktur, jedes von ihnen erzählt eine bestimmte Zeitepoche (ausgehend von den 1920er Jahren bis zu den 1980er Jahren). Hier geht die Autorin chronologisch vor, während auf der Mikroebene des Textes die zeitliche Folge an Bedeutung verliert – Erinnerungen widersetzen sich den Chronologien. Vorangestellt ist ein kurzer Prolog, der thematisch in das Thema der Wege und Straβen einführt und gemeinsam mit dem Epilog zur Serenissima „als Name für eine Autobahn, die nach Osten führt“ (223) den Rahmen bildet. Die Gegenwart bietet zwar Machtverhältnisse wie ehedem, sie bietet Unrecht, Skandale und Krisen in Mengen, jedoch kaum noch gesellschaftliches Engagement gegen ebendiese. Da greift der kritische Zeitgenosse gern nach besseren Zeiten, auch wenn sie nicht nur lang vorüber sind, sondern kaum Spuren hinterlassen haben. Tendenzen, gegen die man in den späten 1960er und in den 1970er Jahren protestierte und durchaus unter Anwendung von Gewalt kämpfte, haben sich schließlich doch durchgesetzt, sie sind heute zur einzementierten Selbstverständlichkeit geworden. Das „Fieber“ von damals hat nicht nur nachgelassen, es existiert so gut wie gar nicht mehr; in Nitz‘ Buch aber wird es noch einmal beschworen – fast so, als könne solches Erbe im Jahr 2014 doch noch angetreten werden.
Die Gegenwart bietet zwar Machtverhältnisse wie ehedem, sie bietet Unrecht, Skandale und Krisen in Mengen, jedoch kaum noch gesellschaftliches Engagement gegen ebendiese. Da greift der kritische Zeitgenosse gern nach besseren Zeiten, auch wenn sie nicht nur lang vorüber sind, sondern kaum Spuren hinterlassen haben. Tendenzen, gegen die man in den späten 1960er und in den 1970er Jahren protestierte und durchaus unter Anwendung von Gewalt kämpfte, haben sich schließlich doch durchgesetzt, sie sind heute zur einzementierten Selbstverständlichkeit geworden. Das „Fieber“ von damals hat nicht nur nachgelassen, es existiert so gut wie gar nicht mehr; in Nitz‘ Buch aber wird es noch einmal beschworen – fast so, als könne solches Erbe im Jahr 2014 doch noch angetreten werden. Selten beginnt ein Buch mit “Letzten Bitten”:
Selten beginnt ein Buch mit “Letzten Bitten”:  „Martha. Von einem schadhaften Leben“ heißt der letzte Roman von Herbert Rosendorfer und er erzählt genau dies: die Geschichte einer Frau, die in das 20. Jahrhundert hineingeboren und von Orten, mit denen sie eine Koexistenz führen wird. Denn lange bevor Martha geboren wird, gibt es einen Menschenschlag in einer weltabgekehrten Gegend, die einem mythisch-magischen Terrain gleicht. Dort fristen die Menschen eines Südtiroler Bergdorfes an der Grenze zur Schweiz ihr ewig gleichbleibendes, vom Aberglauben geprägtes, karges Dasein. Darüber plaudert ein Erzähler in einem halbernsten Ton gutmütig, liebevoll, auch kritisch. Beinahe mündlich wirkt dieses Erzählen, lebendig, elliptisch, mit eingestreuten tirolerischen Wendungen, gleichzeitig distanziert und ironisierend.
„Martha. Von einem schadhaften Leben“ heißt der letzte Roman von Herbert Rosendorfer und er erzählt genau dies: die Geschichte einer Frau, die in das 20. Jahrhundert hineingeboren und von Orten, mit denen sie eine Koexistenz führen wird. Denn lange bevor Martha geboren wird, gibt es einen Menschenschlag in einer weltabgekehrten Gegend, die einem mythisch-magischen Terrain gleicht. Dort fristen die Menschen eines Südtiroler Bergdorfes an der Grenze zur Schweiz ihr ewig gleichbleibendes, vom Aberglauben geprägtes, karges Dasein. Darüber plaudert ein Erzähler in einem halbernsten Ton gutmütig, liebevoll, auch kritisch. Beinahe mündlich wirkt dieses Erzählen, lebendig, elliptisch, mit eingestreuten tirolerischen Wendungen, gleichzeitig distanziert und ironisierend. 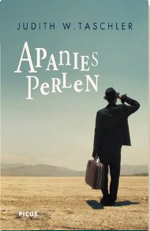 Vier Erzählungen versammelt dieser Band, deren Abfolge gut gewählt ist, nimmt doch die Intensität des Erzählten kontinuierlich zu.
Vier Erzählungen versammelt dieser Band, deren Abfolge gut gewählt ist, nimmt doch die Intensität des Erzählten kontinuierlich zu.  Am Dienstag, 17.06.2014, hielt Sigurd Paul Scheichl, emeritierter Professor für Österreichische Literaturgeschichte und Allgemeine Literaturwissenschaft am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck, seine Abschiedsvorlesung. Darin war unter anderem vom Wohl und Wehe der Germanistik die Rede. Zum Wehe der zukünftigen Germanisten-Generation gehöre, dass ihr das genaue Lesen zugunsten des Schauens abhanden gekommen sei, was Scheichl unter anderem daran festmachte, dass in schriftlichen Arbeiten der Studierenden vermehrt der Begriff “Hauptdarsteller” anstelle von “Hauptfigur” auftauche.
Am Dienstag, 17.06.2014, hielt Sigurd Paul Scheichl, emeritierter Professor für Österreichische Literaturgeschichte und Allgemeine Literaturwissenschaft am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck, seine Abschiedsvorlesung. Darin war unter anderem vom Wohl und Wehe der Germanistik die Rede. Zum Wehe der zukünftigen Germanisten-Generation gehöre, dass ihr das genaue Lesen zugunsten des Schauens abhanden gekommen sei, was Scheichl unter anderem daran festmachte, dass in schriftlichen Arbeiten der Studierenden vermehrt der Begriff “Hauptdarsteller” anstelle von “Hauptfigur” auftauche. Ein Blick auf die Tiroler Kulturveranstaltungslandschaft zeigt, dass sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein vielfältiges und kaum noch zu überschauendes Spektrum an kulturellen Veranstaltungen herausgebildet hat. Sehr viele davon sind festivalesker Natur. Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter sind heute mit zunehmender Konkurrenz und Kommerzialisierung, mit fehlenden kulturpolitischen Konzepten und anderen Herausforderungen konfrontiert. Angesichts des inflationären Auftretens von Festivals und damit zusammenhängender Problemfelder beschäftigt sich Verena Teissl – Komparatistin, Professorin für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement an der FH Kufstein und nicht zuletzt selbst Initiatorin und Mitarbeiterin diverser Festivals – also mit einer aktuellen Thematik, wenn sie nach Beschaffenheit, Geschichte und insbesondere der gesellschaftspolitischen wie künstlerischen Wirkungsmacht von kulturellen Festivals fragt. Gegenüber den Veranstaltungsprogrammen fest eingerichteter Kulturbetriebe erzeugen festivaleske Veranstaltungen als „inszenierte Zeit-Räume“ eine besonders hohe Aufmerksamkeitsdichte. Auf künstlerischer Ebene vermögen sie der Initiation weiträumiger Netzwerkstrukturen und der Weiterentwicklung künstlerischer Formensprache zu dienen. Auf gesellschaftspolitischer Ebene schaffen Festivals idealerweise „Orte der Gegenöffentlichkeit“, sind besonders geeignet dafür, „transkulturelle Prozesse“ in Gang zu setzen. Theoretisch stützt sich die Autorin u.a. auf das Konzept der „Sites of Passage“ (Marijke de Valck): Kulturfestivals werden aus dieser Perspektive als wirkungsmächtige Schnittstellen verstanden, die „ästhetische Akkumulations- und Aufmerksamkeitsprozesse in Gang setzen bzw. implizieren, um eine Veränderung, eine Initiation zu bewirken“ (S. 76).
Ein Blick auf die Tiroler Kulturveranstaltungslandschaft zeigt, dass sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein vielfältiges und kaum noch zu überschauendes Spektrum an kulturellen Veranstaltungen herausgebildet hat. Sehr viele davon sind festivalesker Natur. Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter sind heute mit zunehmender Konkurrenz und Kommerzialisierung, mit fehlenden kulturpolitischen Konzepten und anderen Herausforderungen konfrontiert. Angesichts des inflationären Auftretens von Festivals und damit zusammenhängender Problemfelder beschäftigt sich Verena Teissl – Komparatistin, Professorin für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement an der FH Kufstein und nicht zuletzt selbst Initiatorin und Mitarbeiterin diverser Festivals – also mit einer aktuellen Thematik, wenn sie nach Beschaffenheit, Geschichte und insbesondere der gesellschaftspolitischen wie künstlerischen Wirkungsmacht von kulturellen Festivals fragt. Gegenüber den Veranstaltungsprogrammen fest eingerichteter Kulturbetriebe erzeugen festivaleske Veranstaltungen als „inszenierte Zeit-Räume“ eine besonders hohe Aufmerksamkeitsdichte. Auf künstlerischer Ebene vermögen sie der Initiation weiträumiger Netzwerkstrukturen und der Weiterentwicklung künstlerischer Formensprache zu dienen. Auf gesellschaftspolitischer Ebene schaffen Festivals idealerweise „Orte der Gegenöffentlichkeit“, sind besonders geeignet dafür, „transkulturelle Prozesse“ in Gang zu setzen. Theoretisch stützt sich die Autorin u.a. auf das Konzept der „Sites of Passage“ (Marijke de Valck): Kulturfestivals werden aus dieser Perspektive als wirkungsmächtige Schnittstellen verstanden, die „ästhetische Akkumulations- und Aufmerksamkeitsprozesse in Gang setzen bzw. implizieren, um eine Veränderung, eine Initiation zu bewirken“ (S. 76).
 Gewagt eröffnet Erika Wimmer ihren Roman über Freundschaft, Liebe und Liebesvermögen: der Filmemacher Sturm beobachtet Publikum, Menschen, die zur Präsentation von Buch und Film kommen. Er denkt sich seinen Teil, er hofft auf manche Gesichter, er wartet, bis der Saal voll ist und alle da sind, auf die seine Frau Nelly, die Schriftstellerin, besonderen Wert legt. Sturm ist ein komplexer Mann, aber das verrät die Autorin noch nicht. Auf den ersten Seiten wirkt er pedantisch, distanziert, lehrerhaft, während er die wichtigsten Personen der Geschichte so en passant vorstellt. Sieben Seiten, deren Lektüre die Irritation über den Mann Sturm verstärkt, scheinen keine verführerische Einleitung für einen Roman zu sein. Aber Erika Wimmer macht es so geschickt, dass klar wird: es gibt einen guten Grund für diese Art von Eröffnung – und man möchte ihn kennen.
Gewagt eröffnet Erika Wimmer ihren Roman über Freundschaft, Liebe und Liebesvermögen: der Filmemacher Sturm beobachtet Publikum, Menschen, die zur Präsentation von Buch und Film kommen. Er denkt sich seinen Teil, er hofft auf manche Gesichter, er wartet, bis der Saal voll ist und alle da sind, auf die seine Frau Nelly, die Schriftstellerin, besonderen Wert legt. Sturm ist ein komplexer Mann, aber das verrät die Autorin noch nicht. Auf den ersten Seiten wirkt er pedantisch, distanziert, lehrerhaft, während er die wichtigsten Personen der Geschichte so en passant vorstellt. Sieben Seiten, deren Lektüre die Irritation über den Mann Sturm verstärkt, scheinen keine verführerische Einleitung für einen Roman zu sein. Aber Erika Wimmer macht es so geschickt, dass klar wird: es gibt einen guten Grund für diese Art von Eröffnung – und man möchte ihn kennen.