- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

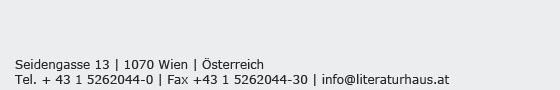



FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Karl-Markus Gauß - "Mit mir, ohne mich. Ein Journal." Ein Schriftsteller muß schreiben, nicht weil ihn ein dunkler Drang dazu nötigt, sondern weil er nur, indem er schreibt, über die unklaren Dinge Klarheit bekommt (und über die klaren Dinge wieder in heilsame Verwirrung geraten) kann. Die Gattung spielt dabei keine Rolle. Selbst eine so simple Sache wie eine Literaturkritik macht mich klüger; klüger nämlich, indem ich sie verfertige, wie ich auch das Buch, über das ich zu urteilen habe, erst im Schreiben wirklich kennenlerne. Fragt mich jemand, ehe ich darüber zu schreiben begonnen hätte, was das für ein Buch sei, das ich gerade gelesen habe, ich wüßte es ihm nicht zu sagen. Erst wenn ich mich hinsetze und zwinge, für meine im vor-sprachlichen Stadium verharrenden Vor-Gedanken Sprache zu erschaffen, erfahre ich selber, was ich schon vorher von diesem oder jenem (Buch) gehalten habe. (Das Entsetzen meiner Frau, als ich ihr auf die Frage, wie ich denn ein Buch, das wir beide gelesen hatten, besprechen würde, wahrheitsgetreu antwortete, daß ich es noch nicht wisse.) © 2002, Zsolnay Verlag, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Sehr geehrte Veranstaltungsbesucher
/innen! Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns, wenn wir Sie im September... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
OUT NOW: flugschrift Nr. 35 von Bettina Landl
Die aktuelle flugschrift Nr. 35 konstruiert : beschreibt : reflektiert : entdeckt den Raum [der... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Neue Buchtipps zu Ljuba Arnautovic, Eva Schörkhuber und Daniel Wisser auf Deutsch, Englisch,... |