- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen





FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Eva Menasse: Lieber aufgeregt als abgeklärt.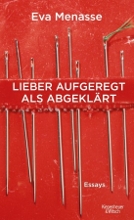 Essays. Muss man heute in Westeuropa noch für die Meinungsfreiheit streiten? Oder ist das in unseren demokratisch befriedeten Breiten am Ende nur wohlfeile Spiegelfechterei? Erstens: man muss und zweitens: ganz und gar nicht, postuliert Eva Menasse, seit 15 Jahren in Berlin lebende Wiener Schriftstellerin mit politischer Verve und ausgeprägter Meinungsfreudigkeit. Menasse findet, dass die Einmischung Intellektueller in die Politik zu unserem Schaden aus der Mode gekommen ist. In ihrem Essayband „Lieber aufgeregt als abgeklärt“ regt sie sich darüber auf, dass Intellektuelle heute freimütig einräumen, gar nicht zur Wahl zu gehen. Politisches Engagement gelte eher als peinlich und wer sich dennoch äußere, bekomme einen Nasenstüber. „Wir als Gesellschaft sind (...) vital darauf angewiesen, dass Menschen diesen Mut haben, dass sie frei denken und sprechen, dass sie auch das Unmoderne, das Unangenehme, meinetwegen das Törichte formulieren ...“ Menasses schmaler, aber gehaltvoller Band versammelt im Wesentlichen Reden anlässlich von Preisverleihungen, Artikel über Literaturskandale, Essays über noch nicht vollständig entdeckte oder eher vergessene Autoren (oder die unbekannten oder vergessenen Seiten bekannter Autoren), Einlassungen zum komplementären Charakter und prekären Verhältnis der Deutschen und Österreicher sowie einige autobiographische und fiktive Texte. Als positive Prototypen des engagierten Schriftstellers gelten ihr, wenig überraschend, Böll und Grass, zwei Schriftsteller, die Rainald Goetz wohl meinte, als er vor 30 Jahren den Begriff „präsenile Chefpeinsäcke“ prägte. In der Nachkriegszeit hätten diese als moralische Autoritäten gegolten. Über Grass schreibt Menasse: „damals hat man es so gewollt, man hat ihn gebraucht, so dringend wie den sprichwörtlichen Bissen Brot.“ Das hindert die Autorin nicht – und damit wären wir bei den Skandalen – Grass für sein Gedicht „Was gesagt werden muss“ zu rügen. 2012 hatte sich der Nobelpreisträger darin gegen die weitere Belieferung der Atommacht Israel mit Rüstungsgütern ausgesprochen und sein bisheriges Schweigen mit dem Schuldkomplex der deutschen Geschichte begründet – was in den deutschen Medien Empörung auslöste. Noch weniger Verständnis als für Grass’ „Antisemitismus aus enttäuschter Liebe“ bringt Menasse für Sibylle Lewitscharoff auf, die sich 2014 mit ihrer „Dresdner Rede“ in die feuilletonistischen Nesseln setzte. In einem christlich-fundamentalistisch anmutenden Elaborat hatte Lewitscharoff Retortenkinder als „Halbwesen“, „zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weißnichtwas“ bezeichnet. „Als hätten wir darauf gewartet, dass endlich wieder jemand die Kanzel besteigt und mit persönlicher Abscheu argumentiert“, schreibt Menasse giftig. Und äußert sich auch in einem sehr persönlichen Text zur „hundertprozentig frauenfeindlichen“ Haltung der Gesellschaft beim Thema Präimplantationsdiagnostik. Unfruchtbarkeit, Fehl- und Totgeburten würden noch immer als rein weibliche Angelegenheit angesehen. Das gegenseitige Missverständnis im Verhältnis von Deutschen und Österreichern bringt Menasse prägnant auf den Punkt. Dass die Deutschen die Österreicher und ihren charmanten Dialekt lieben – diese Liebe jedoch im Allgemeinen unerwidert bleibt, gehört zu den weniger schmeichelnden Erkenntnissen. Die Österreicher fürchten sich nämlich vor der direkten, schnörkellosen Sprache der Deutschen, meint Menasse. Sie halten sie gar für arrogant – eine Behauptung, der Menasse vehement widerspricht. Die Deutschen seien vielmehr „ein halbwegs transparentes Volk. Sie fragen, wenn sie etwas wissen wollen, sie sagen, was sie denken, und sie nehmen keine übertriebenen Rücksichten darauf, wie das beim anderen ankommen könnte.“ Andererseits räumt Menasse ein, dass der deutsche Perfektionismus und die daraus resultierende gnadenlose Verdammung gefallener „moralischer Fackelträger“ durchaus etwas Nervtötendes habe. Ausgehend von den Raucherzonen auf deutschen Bahnhöfen versucht sie nachzuweisen, wie sehr die „German Angst“ noch im seelischen Untergrund der Deutschen schwäre. Sei’s drum, der Vergleich der Völkerschaften endet in einem Patt. Denn so sehr Menasse das „Enge, Kleine, Neurotische, das Beleidigte und Verhaberte“ Österreichs nicht leiden kann, so wenig glaubt sie umgekehrt an das „Lebenskünstlertalent“ der Deutschen, obwohl sie sie mit freimütiger Ironie für „offen, freundlich, ideologisch und moralisch frisch gelüftet“ hält – im Gegensatz zum ressentimentgeladenen Wiener Establishment, das durch den Eisernen Vorhang jahrzehntelang von der Welt abgeschnitten waren. Dass nicht der Opernball, sondern der Philharmonikerball der wichtigste der Wiener Bälle sei, ist eine der vielen Einsichten in innerösterreichische Befindlichkeiten, die einem dieses Buch gewährt. Die Bälle seien längst nicht mehr nur der sozialen Elite vorbehalten: „Wer glaubt, dass Bälle die eingezäunte Spielwiese der herrschenden Klassen sind, irrt. Das war einmal. Aber weil an einer übermächtigen Leitkultur irgendwann alle teilhaben wollen, gibt es längst nicht nur die Bälle der verschiedenen Handwerkszünfte und Innungen, sondern auch den Ball der Wiener Hausbesorger, den Ball der Gewichtheber, den Flüchtlingsball und sogar den Opferball, zu dem Obdachlose freien Eintritt haben.“ Da in Wien die Politik so theatralisch sein könne wie eine Aufführung in der Burg politisch, nutzten Politiker jeder Couleur (außer den Sozialdemokraten, die sich gern als Ballverächter gäben) die Chance zum großen Auftritt. Dabei könne ein persönlicher Faux-pas böse Folgen haben – ebenso wie ein gelungenes Bonmot das Image nachhaltig aufpoliere. In jedem Fall schlagen die Herzen der Wiener auf Bällen begeistert im Dreivierteltakt – womit sich wieder ein vertrautes Klischee über Österreich bestätigt. Man nimmt es befriedigt zur Kenntnis, als Piefke, bevor man sich glücklich eine riesige Serviette um den Hals schlingt, sich vor sein dampfendes Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffeln setzt, einen großen Krug Bier hinter die Binde kippt und leise „Mahlzeit!“ murmelt. Judith Leister Originalbeitrag. |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |