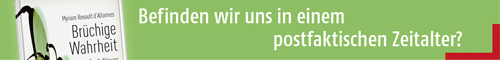13.-14.5.2017 – Nix da Fort-da. Mutti ist traurig
13.5.2017
„Deine Sorgen möcht ich auch mal haben!“ sagt die Eine, als sie den Tag mit Zupacken im Garten anfängt, weil jetzt alles getan werden muss, um dem Ziel näherzukommen, das da Blumenwiese heißt. Das hat sich die Andere ausgedacht, die da immer von Mäusen und Vögeln und Blumen redet und sich manchmal einbildet, sie könne etwas – was? – retten, wenn sie der Welt Blumen zurückgibt.
Die Eine packt an und denkt: es geht ja! Und macht weiter, als wäre sie sechzig.
Dabei hat sie Hilfe von einem afrikanischen Flüchtling aus dem Senegal. Weil er diesmal allein ist, reden sie länger miteinander, als wenn zwei Senegalesen da sind, die miteinander Wolof sprechen. Modu erzählt, dass am 26. Mai Ramadan beginnt. Er mache Ramadam seit 20 Jahren. Es ist für ihn so selbstverständlich wie das Aufstehen um halb sechs, um zu beten und im Koran zu lesen vor der Arbeit. Diesmal fällt Ramadan auf die längsten Tage im Jahr und es wird schwer. Wie machen das eigentlich die Muslime in Finnland?
Als der Kuckuck ruft, erzähle ich von unseren Vögeln. Und Modu sagt: Im Senegal machen die Vögel viel kaputt. Beim nächsten Mal werde ich fragen, wie die das machen.
Nach der Arbeit gehe ich noch schwimmen, weil das Freibad wieder offen ist.
In der Nacht ist der Spaß vorbei, ich kann vor Schmerzen nicht schlafen, höre die Mäuse um mich herum arbeiten, es stört sie nicht, wenn ich zische oder in die Hände klatsche, nur wenn ich die Taschenlampe anmache, ist es still, aber sobald es wieder dunkel ist, geht es weiter. Ich entschließe mich zu Ibuflam und stehe umständlich schmerzvermeidend auf. Als ich in die Küche komme, sehe ich eine Maus zwischen Herd und Spüle verschwinden. Ich habe sie gestört. Wieder im Bett warte ich darauf, dass der Schmerz nachlässt und denke an die Fallen, die ich wieder aufstellen muss und – so denke ich – griffbereit aufgeräumt habe.
Ja denkste. Bis jetzt habe ich sie nicht gefunden. Nur die falschen, in die noch nie eine Maus gegangen ist.
14.5.2017
Als ich gestern Abend ins Haus komme, sehe ich, dass Paul angerufen hat, und rufe zurück. Ich hätte ihn angerufen, sagt er, und im Hintergrund seien viele Kinderstimmen gewesen. Das habe ihn gewundert. Er klingt viel kräftiger als beim letzten Telefonat. Nein, ich habe nicht angerufen, war gar nicht da und mein Telefon allein auf dem Küchentisch. Komisch. Wir wundern uns nun beide. Es gehe ihm besser, sagt er und erzählt ganz stolz, er habe heute seinen Citroen gut verkauft.
Ich glaub’s nicht. Doch. So ist er. Morgen kommen seine Kinder, und dann meldet er sich wieder. „Keine Angst, so schnell geh ich noch nicht.“ sagt er. Höre ich da meinen Vater? Ich hatte meine allererste Reise nach Afrika – Tunesien, ganz harmlos und organisiert – gebucht und mit ihm darüber gesprochen, ob ich die machen sollte, wo wir nun wussten, dass er krank war. „Geh ruhig“ hat er gesagt und: „ich bin schon noch da, wenn du wiederkommst.“ Unglaublich. Das hab ich ihm nie vergessen. Von meiner Mutter hatte ich gelernt, dass es sie krank machte, wenn ich mich weiter entfernte. Solange sie lebte, wäre ich nie nach Afrika gekommen.
1981
Nix da Fort-da. Mutti ist traurigwer sich in Gefahr begibt,
kommt darin um
Wenn ich nicht weiß, wo du bist, werde ich krank. Mein Herz macht das nicht mit.
Als meine Mutter mich das erste Mal nicht erreichen konnte – wir, ihre Tochter mit Mann und Kindern, waren in Griechenland unterwegs, ohne Adresse, ohne Telefon – war sie krank, bis ich wiederkam und keinen Tag länger. Und sie sagte: das darfst du nie wieder tun!
Sie ließ mich dabei nicht aus den Augen. Da sah sie nichts. Und sie hörte auch nicht, wie ich sagte: Ich werde es wieder tun. Wieder und wieder.
Im nächsten Sommer war sie tot.Heimgekommen bin ich immer zu spät. Immer am letzten Tag der großen Ferien.
Glanz im Auge der Mutter? Ich habe ihn nicht gesehen, für den es sich gelohnt hätte, nach Hause zu kommen. Stattdessen traurige Vorwürfe: Warum kommst du wieder erst am letzten Tag. Hast du mich denn gar nicht lieb. Dieser eine Tag ist doch nicht so wichtig.
Zuhause empfing mich ein übervoller Teller mit den Früchten des späten Sommers. In meinem Zimmer nur für mich allein. Pflaumen, Birnen, Trauben, grüne und blaue. Obstkuchen mit Schlagsahne.
Dort hatten wir die Pflaumen geschüttelt, die Äpfel in der Pferdekoppel gesammelt, die reifen Birnen vom Baum vor dem Haus geholt. Am Nachmittag Marmeladebrot soviel man wollte. Meine Mutter saß traurig neben dem vollen Teller und fragte: „Freust du dich nicht, wieder daheim zu sein? Ist es zuhause denn gar nicht schön?“
– Doooch. Jaa. Natürlich.
Natürlich nicht. Natürlich ist es gelogen.
Nein hätte ich sagen wollen. Nein und nochmal nein. Überall ist es schöner als hier.
Ein Tag früher. Das wäre der Liebesbeweis gewesen. Von mir kriegte sie ihn nicht. Ich war kein einfaches Kind.
„Aber es war doch so schön – “ Verstand sie denn nicht, dass es etwas gab, das schöner war als ihr beleidigtes Gesicht? Natürlich verstand sie das nicht.
Da war immer niemand.
Aber ich hatte sechs Wochen lang Geschwister gehabt, jüngere Geschwister, die immer da waren. Niemals alleine einschlafen. Im Dunkeln reden. Ich erzählte, sie hörten mir zu, war ich doch schon so groß. Durch den Wald „ninders“ Bad – nach hinten ins Bad – gehen, mit einer Omi Himbeeren in Milchkannen sammeln, Pilze suchen, die die Omi heimlich wegwerfen musste, weil sie giftig waren. Und an den wenigen Regentagen sich nicht anziehen müssen, den ganzen Tag im Zimmer mit den vier Betten an den Wänden bleiben und im Schlafanzug spielen: Mikado, Fang den Hut, Mensch ärgere dich nicht. Später: Monopoly. Und vor dem Einschlafen sang ich Schlager von Hans Albers vor, die konnte ich am besten. Einmal noch nach Bombay oder nach Shanghai, einmal noch nach Tokio oder nach Hawai, einmal durch den Suez und durch den Panama, und dann zurück nach Hamburg, in mein Hamburg-Altona. Dabei kamen mir immer die Tränen. Aber im Dunkeln sah man sie nicht. Und ich hörte, wie Britta sagte: nochmal! So oft, bis sie eingeschlafen war. Kleine Möwe, flieg nach Helgoland –Hatte ich Heimweh? Diese wunderschön-schmerzliche Mischung aus Freude am Fremdsein und Sehnsucht nach Vertrautheit? Nach der Vertrautheit oder nach der Sehnsucht? Oder nach der Vertrautheit mit der Sehnsucht?
Nach Hause, dorthin, wo meine Mutter war, wollte ich gar nicht zurück.
Oh Susanna, nimm alles nicht so schwer. Uhund wein dir nicht die Augen aus, wenn ich nicht wiederkehr -Sie ist mir in die ersten Skiferien gefolgt. Da brach für mich alles zusammen: zuallererst die Hoffnung, dass eine Flucht möglich war. Es sollte eine Überraschung sein, eine Freude wollte sie uns machen, wie sie sagte, und ich konnte nicht anders als weinen, weinen, weinen. Und ich konnte nicht sagen, warum. Wut durfte es nicht sein.
Es sollen Herzbeschwerden gewesen sein, die man mit dem Höhenunterschied erklärte und die meine Mutter zwangen, am nächsten Tag zurückzufahren.
Und ich habe mich geschämt, dass ich so geweint habe. Als sie tot war, habe ich nicht so geweint.Ihre Krankheit. Der Tumor im Gehirn stellte nebeneinander, was immer ein undurchschaubares Ganzes gewesen war. Jeden Tag hat die Krankheit die Decke ein bisschen mehr weggezogen von den Verbindungen zwischen uns, so dass mein Bild in ihrem Kopf jetzt vor mir liegt, wie ihr Gehirn vor den Ärzten, die es durchsuchen, um die Windung zu finden, in der ihr Tod saß. Ich habe es ihnen erlaubt.
Und da lag die Wahrheit. So wie du bist, ist es falsch. War es immer falsch. So ein Kind wollte ich nicht. Aber nun bist du einmal da und mir bleibt nichts anderes übrig, als dich für mein Leben zu nehmen. Du bist zwar nicht, was ich wollte, aber du bist alles für mich. Du bist nicht mein liebstes Kind, aber mein einziges. So musst du alles für mich tun. Aber es wird mir nie genügen.
Ich hätte mir schließlich auch immer ein zärtlicheres Kind gewünscht.Flüchtlingsfrau und vertrieben. Weinend kam sie nach Hause gelaufen, wenn man ihr einmal wieder Hura-Flichtling nachgerufen hatte. Dabei war sie doch unschuldig, tat nichts anderes als arbeiten und machte jeden Abend Kasse, zählte das Geld mit flinken Fingern. Die Lippen bewegten sich lautlos unüberhörbar.
Mit dem Geld konnte man sich ein Haus kaufen, aus dem man nicht vertrieben werden konnte, auch Häuser, kein Zuhause.
Wie gern habe ich, als ich heiratete, den Namen hergegeben, der sofort verriet, dass ich hier nicht dazugehörte.Nach ihrem Herzinfarkt besuchte ich sie täglich. Sie wollte keinen anderen Besuch. „Nur du kannst mir helfen -“ hat sie gesagt. Beinahe ohnmächtig vor Übelkeit, das konnte ich ihr ansehen, rief sie die Schwester, nur um ihr lächelnd zu sagen: „Sehen Sie: wenn meine Tochter bei mir ist, geht es mir gut.“
Ihre Tochter war bei ihr, ja, sie kämpfte selbst mit der Übelkeit. Jedesmal wieder hatte sie Angst, über ihrem Bett zu erbrechen, wenn es nicht gelang, rechtzeitig hinaus, weg, schnell fort zu kommen.
Die Mutter verstand die Dinge nicht mehr. Sie wurde immer ehrlicher.
Täglich wartete sie darauf, dass ich die „Prüfung“ machte, die ihr sagte, dass ihre Tochter endlich etwas war, wodurch sie endlich etwas wäre. Dafür hätte sie gerne auf alles verzichtet. Verzicht war immer ihre große Stärke, nur wollte sie alles dafür. Nicht mehr und nicht weniger. Das nannte sie Dankbarkeit.
Beschimpft als undankbar, fragte ich mich, wofür ich dankbar sein sollte. Wann das anfing, weiß ich nicht mehr.
Sie begann zu phantasieren. Sie sei die ganze Nacht im Krankenhaus herumgelaufen, sagte sie, und hätte mich gesucht. Immer suchte sie mich, wenn sie schlief. „Ich konnte dich nicht erreichen. Ich wollte dich anrufen, konnte dich wieder nicht erreichen!“ Sie hat mich nie erreicht. Ich erzählte von den Kindern, unserem Leben. Sie verstand es nicht, redete irgendwoanders weiter, was ich sagte, kam bei ihr nicht an. Wann wäre ich bei ihr angekommen.
Alles war plötzlich grausam ehrlich: ihr Wunsch, ihre Hilflosigkeit, ihre Unfähigkeit unverdeckt unverstellt.
Auf der anderen Seite: ich. Ungesehen. Unverstanden.Jede allein. Wie immer für immer.
Die Krankheit deckte ihre Angst auf. Sie erwartete mich mit immer neuen Geschichten von Verrat und Betrug, die zwischen gestern und heute passiert waren. Sie sah sich bedroht verfolgt bestohlen betrogen verraten verkauft.
Sie tat mir leid. Ich weinte, als ich mich zum Abschied über sie beugte. Bis morgen –
Ich kam jeden Nachmittag. Ich versuchte, ihr zu helfen, so gut ich konnte – gerade ich? Konnte ich die Folterqualen lindern, denen ihr böses Hirn sie aussetzte, indem es sie durch alle Ängste jagte, vor denen sie ein Leben lang geflohen war?
Aber sie wollte mehr. „Wenn du das jetzt nicht für mich tust, ist alles, was du Gutes für mich getan hast, umsonst!“ So weit war es wieder einmal.
Wie immer. Alles umsonst. Sie entzog mir ab sofort das Vertrauen. Ich hatte sie wieder einmal enttäuscht. Da konnte ich nichts machen. Ich nicht.
Als sie schließlich starb, glaubte sie, mein „Doktor“ sei fertig. Es war ihr so wichtig, dass sie meinen Widerspruch nicht mehr hörte. Wenigstens das hatte sie erreicht und rutschte zufrieden unter die Bettdecke. Sie konnte sterben.
Ich aber war ein Jahr zu spät. Wie immer hatte ich es ihr nicht recht gemacht. Diesmal endgültig.
Sie sagt: du musst es machen, du musst es besser machen als alle, alle! Sie sagt: wenn du es besser machst als ich, werde ich dich vernichten! Ich sage: Ich bin so blöd, dass ich das nicht hinkriege!Ist es schlimm, wenn ich das Unmögliche nicht hinkriege?
Sie schlug nach mir. Ach so. Auch das erkannte ich wieder. Als meine Wahrnehmung noch nicht so gut entwickelt war für die feineren Methoden, in ihrem Gesicht zu lesen, ob ich nun gut oder böse war, da hat sie’s mir auf diese Art gezeigt. Ein kleiner Schlag und ich wusste: jetzt war ich böse.
Dann hat sie ihren Hass auf mich herausgelassen. In der Nacht hat sie mich lachen hören. Das war so widerlich, sagte sie. Ich sah ihr den Ekel an. Wann ich endlich aufhören würde, so widerlich zu lachen. Warum ich nicht so wie meine Cousinen sei, wie ihre Nichten. Freundlich wie die erste, gescheit wie die zweite und zärtlich wie die dritte.
Sie hätte sich schließlich auch immer ein zärtlicheres Kind gewünscht.An dem Gehirntumor sollte sie sterben. Und ich mit ihr. Natürlich.
Das Leben verließ mich schneller als sie. Ich fühlte nichts mehr. Mein Spiegelbild war ein Gespenst, grau, bleich und alt. Die Augen brannten. Sie nahm mich mit. Ohne sie kein Leben. Ich war ein Kind im Bauch einer sterbenden Frau.
Da musste ich raus, bevor ihr Tod mich tötete. Das Licht der Welt gewinnen. Den Zipfel ergreifen, den ich hatte schimmern sehen.
Es ist ganz normal, dass eine Tochter eine Mutter überlebt. Ihr Tod, mein Leben.Aber einen Schrecken habe ich dir schon eingejagt?!
Ich schob meine Mutter durch die unterirdischen Gänge des Krankenhauses dorthin, wo am nächsten Tag ihr Kopf geöffnet werden sollte. Mein Vater und ich hatten der Operation zugestimmt, ohne die ihr ein langsamer qualvoller Tod gewiss gewesen wäre.
Heute zeigte sie sich versöhnt mit dem, was war, und dem, was kommen würde, verwirrt und dabei fast ein bisschen weise. Sie sah alle ihre Neffen und Nichten, die sie so gern als Söhne und Töchter gehabt hätte, um sich versammelt. Sie wollten bei ihr Kaffeetrinken, sagte sie.
Aber nur ich war da. Wie immer nur ich.
Dafür spielte sie jetzt ihren größten Trumpf aus. Mit sicherer Hand griff sie nach der letzten, aber entscheidenden Karte. Sie fragte mich lieb und freundlich und ihre augenblicklich wachen Augen forderten die sofortige Bestätigung:
Aber einen Schrecken habe ich dir schon eingejagt?!
Wie?
Was meinte sie? Den Herzinfarkt? Den Tumor? War das ihre Rache?
Ihr Blick ließ mich nicht aus. Mein Kopf nickte fassungslos, mechanisch, den Mund hab ich vergessen zuzumachen. Ich schob sie weiter.
Sie rutschte noch ein Stückchen weiter unter die Bettdecke und lächelte zufrieden. Glücklich. Sie konnte mich entlassen, brauchte mich nicht mehr.Es sollen ihre letzten Worte gewesen sein.
Aber einen Schrecken habe ich dir schon eingejagt. Das war genug.
An diesem Abend war ich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Frei zu tun, was ich wollte, frei zu wollen. Frei zu gehen, wohin es mir einfällt, frei mir etwas einfallen zu lassen. Frei Lust zu haben. Es machte mir Spaß, mit 130 ein Polizeiauto zu überholen und den Polizisten zuzuwinken.
Gleichgültig wie die Operation verlaufen würde, dorthin, wo die Angst war, ginge ich nicht zurück.
- Musst du immer das letzte Wort haben!?!
- Ich hab ja nicht gewusst, dass du nichts mehr sagen willst.
Das setzte eine Ohrfeige. Wer hat das letzte Wort.Zwischen Weihnachten und Neujahr ist meine Mutter nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Am 1. Januar wurden die Geräte abgestellt. In den ersten Stunden des neuen Jahres hat ihr Herz zu schlagen aufgehört. Ich bin ein Neujahrskind.
Sieben Jahre lang hat ihr Körper dieses Wunschkind nicht gewollt. Die Medizin musste den Widerstand überwinden, sonst gäbe es mich nicht. Dem Professor in Auftrag gegeben. Darauf war sie stolz. Der wäre der Vater, nicht nur der Schlachter.
Was sollte sie mit mir anfangen. Neugeboren hat das Kind schnell gelernt.
Schreien zur falschen Zeit hatte zur Folge, dass man das Kind hinausschob. Soweit, bis man es nicht mehr hörte.
Verträgt es schon, ist dick genug. Wenn gar nichts mehr zu hören war, durfte es wieder in das Zimmer der Eltern.
Bald schrie es nicht mehr. Das brave Kind.„Geh ruhig, Mammi, es macht mir nichts aus.“ Meine dreijährige Vernünftigkeit wird stolz berichtet.
„Geh zu Frau Stubenrauch. Ich fürcht mich nicht. Allein.“ Hätt ich gesagt. Das Bett war naß, als sie wiederkam. Das Kind noch wach.
„Ich dacht, sie war nicht da –“, mein Satz wird lachend der Geschichte überliefert. Als Witz. Ich lache mit.Nachdem sie sich seit Tagen nicht mehr wachrufen ließ und ihr Atem schon aussetzte, war es sicher, dass sie nicht mehr aufwachen würde. Ich glaube, sie hat es so gewollt. Die Krankheit kam ihr zu Hilfe.
Als sie nicht mehr lebte und noch nicht tot war, habe ich manchmal ihre weiche Hand gehalten. Es war neu und ungewohnt. Fremd. Sie war noch warm, aber meine Mutter konnte sie mir nicht mehr entziehen. Auch wenn diese Hand noch lebte, waren ihre Augen schon gebrochen, ihr Bewusstsein erloschen. Nun konnte ich diese Hand halten und streicheln, solange ich wollte, und sie konnte mir nicht mehr zeigen, dass es ihr lästig war. Wie eine Diebin kam ich mir vor.
Aber ich hatte von dem Gestohlenen nichts. Eine leere gefühllose Hand, die ich wieder zurückgelegt habe.
Vor dieser Hand hat mir nicht mehr gegraut. Sie war so weiß und so weich wie alle Hände von Sterbenden.
Da stand nun das böse Liebkind vor seiner Mutter.Lass sie sterben, die Hoffnung.
Sie sollte mit ihr gehen. Ich hatte Angst, diese Hoffnung könnte sie überleben. Sie war ein Teil von mir und das stärkste Band zwischen uns. Lebenslänglich haben wir uns gegenseitig enttäuscht. Nie habe ich für sie sein können, was ich hätte sein sollen. Die Erfüllung ihrer Wünsche, nicht mehr und nicht weniger.
Und nie hat sie mir das geben können, was ich brauchte, Vertrauen in meine Lebensfähigkeit. Sie hat mir alles gegeben, was sie hatte, ihr ist kein Vorwurf zu machen. Ihre Angst wurde meine Angst, ihre Zweifel an sich selbst wurden meine Zweifel an mir, ihre Sehnsucht zurück in die dunkle tiefe Heimat – Land der dunklen Wälder – wurde meine Sehnsucht nach dem Tod. Ich bin die Alleinerbin, ich bin das Wunschkind: eine Tochter.
Ich tue, was sie sagt: Zufriedenheit wird Unruhe, Vertrauen in die Zukunft wird Mißtrauen gegenüber der Gegenwart: Zweifel, Unlust, Ärger. Traurigkeit?
Von der Hoffnung bleibt ein Wunsch, dass ich mich getäuscht, dass ich in meiner Bosheit ihr unrecht getan hätte von Anfang an und immer.Als ich das nächste Mal kam, war sie schon kalt. Mein Vater und ich sind hingefahren, um sie nach ihrem Tod noch einmal zu sehen. Dafür musste man eine Kiste aus der Kühlung ziehen. Die Füße kamen zuerst, ein Zettel mit den Personalien war mit einer Schleife um den großen Zeh gebunden, wie in jedem zweiten Krimi. Das war sie, wer sonst.
Das war sie nicht mehr. Wir konnten gehen.Als sie tot war, redete ich fortwährend mit ihr. Jetzt konnte ich mit ihr sprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass das, was ich sagte, sie töten würde. Ich schrieb es auf. Ich brauchte Zeugen für meine Trennung von ihr. Zeugen für mich gegen mich, für mich heute gegen mich gestern und gegen mich morgen.
Im Morgengrauen des Tages, an dem ihre Asche versenkt werden sollte, träumte ich, dass sie lebte.
Sie ist aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen: größer, schöner und lebendiger als sie es im Leben je war. Ich staune. Dann trete ich vor ihren Spiegel im Badezimmer und reiße meine Zähne heraus. Die linke Hälfte der oberen Seite zuerst. Ihrem Mann – das musste mein Vater sein, aber so wie er aussah, kannte ich ihn nicht – erkläre ich, das müsse so sein. Weil sie doch aus dem Krankenhaus kommt. Meine Zähne waren die Bedingung für ihre Entlassung.
Dieser Mann sieht es ein. Vielleicht ist es ja meiner. Der muss mich nun ohne Zähne nehmen.Der Fehler meiner ersten Geburt war, dass sie nie abgeschlossen wurde. Sie hat mich in die Welt entlassen, um mich dort in ihrer engsten Nähe mit Mauern zu umgeben, hinter denen eine Welt nur nebelhaft zu ahnen war. Ohne Mutter bei der Mutter gefangen.
Nun staunte ich, dass die Welt Farben trug. Sie war gar nicht so eintönig grau, wie ich sie immer gesehen hatte. Manchmal schien schon eine Sonne und ich erkannte mit Herzklopfen, dass meine Wirklichkeit nicht die ganze Wirklichkeit gewesen war. Sie allein hat die Mauern gehalten. Pappmauern. Es war lächerlich, wie leicht sie umfielen in dem Moment, wo sie sie nicht mehr halten konnte.
Schuppen von den Augen.
Die Todesanzeige in der Tasche wagte ich mich zum ersten Mal in die Welt. Ich war auf Überraschungen gefaßt.
Ich ging in die Stadt und suchte die Menschen, vor denen ich immer geflohen war. Ich hielt Blicke aus, denen ich ausgewichen bin. Ich sah den Menschen ins Gesicht und wagte Sätze, nur um Antwort zu bekommen. Um nicht umzufallen, klammerte ich mich an das letzte Bild von ihr in meinem Kopf.
Ich würde trotz Schnee und Kälte keine Mütze aufsetzen an diesem Tag. Schadenfreude. Niemand würde mir sagen: Man geht bei diesem Wetter nicht mit nacktem Kopf.Als das Telefon klingelte, blieb ich in der Badewanne. Sie konnte es nicht mehr sein. Keine Vorwürfe am Abend, weil sie mich nicht angetroffen hat. Vor niemandem hatte ich mich zu rechtfertigen. Ich ging in mein Zimmer, ohne zuvor die ganze Wohnung aufzuräumen und meine Zeit freizuschaufeln. Ich ließ alles liegen, wo es lag.
Den Dreck, den ich erwartet habe, fand ich nicht.
Ich sah meine Welt, die sie noch ausfüllte, aber nicht mehr zerstören konnte. Das konnte mir nie nie nie wieder passieren, dass sie mich verhöhnte.
Ich brauchte keine Angst mehr davor zu haben, beschämt, gedemütigt und bloßgestellt zu werden. Wer hätte daran jetzt noch Interesse. Ich konnte anziehen, was ich wollte. Niemand würde sagen: wie hast hast du dich wieder angezogen! Unvorteilhaft.
Sie war nicht mehr da. Und ihre verbliebene Allgegenwärtigkeit und Allmacht wollte ich herausschleudern aus mir, ausspucken, herausreißen und zertrümmern. Was dann noch übrigbleiben würde, wusste ich noch nicht. Vielleicht ein Ich mit vielen Löchern, aber sicher ein Ich.
Ob ich jetzt nicht mehr zu spät kommen musste?Kuchen von ihr kam aus der Gefriertruhe bis zum nächsten Sommer. Die Marmeladen blieben länger.
Sie war tot. Wo sie war, gab es nichts. Leeres freies großes Nichts.
Ich lebte. Ich fiel nicht um. Immer nur fast und dann Staunen. Ich war noch da. Ein Wunder. Ich hatte ein Maß angenommen, das für sie erträglich war. Jetzt wurde ich unerträglich.
Das bisschen klappernde Asche, das ich durch den Schnee trug, machte mir keine Angst mehr. Ich passte nicht mehr in mein Leben.Vorne schlossen sich die runden Türen langsam und lautlos vor ihr. Begleitet von der Musik, die sie dafür ausgesucht hatte. Land der dunkeln Wälder. Ich brauchte ihre Vorbereitungen nur weiterzugeben. So hatte sie sich ihren Abgang vorgestellt. Und alle weinten.
Hinter mir gingen die Türen nach draußen auf, wo alles weiß und erfroren war. Dort musste ich schnell hinaus. Sie könnte nach mir greifen, am Ende noch ein Fetzchen von mir erwischen und ich müsste meine Haut da lassen. Meine Haut als Preis für Überleben ohne sie.
Im Traum bin ich mit großen weiten Bewegungen auf das Leichenhaus zugefahren mit leichtem Ski. Habe ich die Welt deshalb leerer gefunden? Eigentlich wurde sie dann erst bunt.In dem Jahr nach dem Tod der Mutter bin ich zum ersten Mal ohne meinen Mann in Ferien gefahren.
Meine Große war bei mir. Sie war sechzehn und dachte ans Sterben und an nichts anderes.So wichtig am Anfang. Zum ersten Mal wusste ich, dass ich nicht gehen darf, dass ich dieses Kind beschützen musste, für das ich alles war. Ich. Alles. Dass es das gibt. Ich. Allein.
Es reichte nicht aus.
Ich verstand sein Weinen nicht.
Ich habe sie nicht beschützen können.Am Ende dieses Jahres gab es die Familie nicht mehr. Im November verließ der Vater das Haus. Ich war nicht mehr die Frau, die er geheiratet hatte. Wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, hätte sich mein Mann nicht von mir getrennt. Hat er gesagt. Keine Mutter lebt ewig.
Seitdem mache ich meine Reisen allein.
Bald zwanzig Jahre ist die Mutter nun tot, und ich muss es immer wieder probieren, ob Fortgehen mich das Leben kostet.Wer sich nicht in Gefahr begibt
kommt darin um
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. (geklaut)
Heute – inzwischen habe ich 26 Jahre gelebt – weiß ich, dass es Liebe war. Und: Kinder müssen die Eltern lieben, sie können nicht anders. (auch geklaut)
Blaue Pfützen holen den Himmel herunter. Es ist Muttertag. Und ich bin ein Elternteil.
Mein rechtes Knie knickt weg und tut dabei scheusslich weh. Mit dem Aufstehen waren die Schmerzen da. Solche kenne ich noch nicht. Bei jeder Bewegung packen sie zu. Was soll das nun wieder werden. Der Rücken hat sich gerade wieder fast beruhigt, da kommt das. „Das versteh ein anderer!“ So haben beide Elternteile gesprochen. Das versteh ein anderer.
Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de