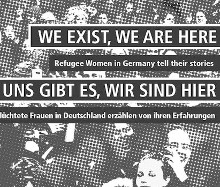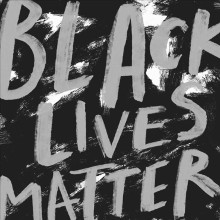Seit einiger Zeit ist Mobilitaet
das Schlagwort einer Gesellschaft, die sich dem permanenten Druck der Globalisierung stellen will. Mobil muessen alle werden, die nicht als Globalisierungsverlierer enden wollen. Mobilisiert werden restlos alle Ressourcen, damit unsere Gesellschaft nicht in die Globalisierungsfalle tappt. Doch was steckt hinter diesen selbstverstaendlich gewordenen Appellen? Tom Holert und Mark Terkessidis haben beschlossen der Frage nachzugehen. Konkret: Sie haben die Mobilitaetsantipoden Tourismus und Migration gegenuebergestellt.
Auf Reisen, bei ausgedehnten Recherchen in Bibliotheken und waehrend Interviews sowie Gespraeche ist ihr gemeinsames zweites Buch >Fliehkraft< entstanden. Es denkt Tourismus und Migration zusammen als zwei Seiten ein und derselben Mobilitaetsmedaille. Interessant an der bisherigen Rezeption ist: Vor allem in der Migrationsdebatte ist das Buch hellhoerig aufgenommen worden. Sturm auf die Festung Europa? Fliehkraft zeigt, dass die afrikanische Bedrohung eine hausgemachte ist.
Und legt ferner die intrikaten Manoever des Grenzschliess- muskels offen, der immer nur unter der Hand offen ist und dann auch nur, wenn Arbeitskraefte gebraucht werden. Was das Ganze mit Tourismus zu tun hat, scheint niemanden wirklich zu interessieren. Damit wird die zentrale These des Buches belegt: In unserer Gesellschaf gelten beide Seiten der Mobilitaetsmedaille als unvereinbare Gegensaetze. Vielleicht bestaetigen die meisten Journalisten auf ihre Art einfach nur, wie sich Mobilitaet als eine so wirksame Ideologie erhalten konnte. Niemand will ihre jeweilge Kehrseite sehen.



 MORE WORLD
MORE WORLD