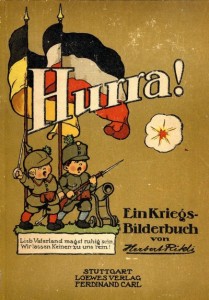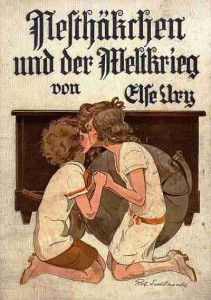Erinnerung an den Gewerkschaftler Walter Köpping
© Werner Lang
Was vermag die Literatur? Welche Rolle spielt die Kunst im Leben des Menschen? Hat Kunst etwas mit Politik zu tun? Mit anderen Worten: Ist eine Arbeiterliteratur notwendig, kann sie eine Wirkung ausüben? (Walter Köpping, Gewerkschaftliche Monatshefte 6, 1974, S. 329).
Walter Köpping geht von diesen Fragen in seinem Beitrag „Der gesellschaftspolitische Stellenwert der Arbeiterliteratur“ aus. Er kommt zu dem Schluss, dass Arbeiterliteratur Wirkung haben kann, wenn sie sich der Realität stellt und so zur Veränderung der Lebenswirklichkeit beizutragen sucht.
Arbeiterliteratur kann als Tendenzdichtung im guten Sinne des Wortes, so wie sie Walter Köpping beschrieben hat, aufgefasst werden. Er schreibt:
„Sie ist nichts für ruhige Abende, nichts für Literaturgenießer. Sie ist als eine Literatur in Abgrenzung und Gegensatz zu dem, was als Literatur im Allgemeinen gilt zu verstehen. Und im Allgemeinen wird sie noch immer als Projekt der Fantasie, als rein geistiger Vorgang, eine Literatur mit Betonung der sprachlichen Form bis hin zu Wortartistik verstanden.
-Literatur als Werk eines Einzelnen, des außergewöhnlichen Individuums
-Literatur, die auf das Individuum (Leser) zielt
-Literatur ohne politische Dimension, ohne Einbeziehung sozialer Fragen oder Probleme der Arbeitswelt.“ (S. 331).
Genauso, wie sich die bürgerliche Literaturauffassung unwesentlich verändert hat, hat sich auch die Realität der Arbeitswelt seit 1974 nur unwesentlich verändert, weil noch immer gilt, dass Millionen von Menschen täglich Lohnarbeit, daher fremdbestimmte Arbeit leisten. Der Lohnarbeiter ist sozusagen der Handwerker, dem sein Werkzeug weggenommen wurde und daher in Abhängigkeit geriet.
Zur Ausbeutung ist mit den Worten von Theodor Prager zu sagen, „dass im Kapitalismus die Kapitalisten sämtliche Produktionsmittel besitzen. Die Arbeiter besitzen nichts als ihre Arbeitskraft; das zwingt sie, diese zu verkaufen, wodurch ihre Arbeitskraft zur Ware wird.
Und die Ware Arbeitskraft hat die einzigartige Eigenschaft, mehr Werte zu erzeugen, als sie selbst wert ist. Diesen ‚Mehrwert‘ eignet sich der Kapitalist kraft seiner Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel an. Das ist das Wesen der Ausbeutung.“ Theodor Prager, „Das Märchen vom Lohn, der nicht steigen darf“, 1951.
Von seiner Stellung in der Produktion ausgehend, wird der Lohnarbeiter zum Getriebenen im kapitalistischen System. Aber wo es Getriebene gibt, gibt es auch die Antreiber, die versachlicht der „Wirtschaft“ zugeschrieben werden. Marx nannte das „Entfremdung“.
Elmar Treptow schreibt: „Statt von Versachlichung können wir, heute üblich, auch von ‚Sachzwängen‘ sprechen, wenn damit gemeint ist, dass die Integration der Arbeitskräfte in den Prozess des Kapitalwachstums nicht durch die direkte körperliche Gewalt von Personen, sondern durch die Abhängigkeit von Sachen und Funktionen erzwungen wird.“ (Elmar Treptow, „Die widersprüchliche Gerechtigkeit im Kapitalismus“, Weidler Buchverlag, 2012, S. 303.)
Nicht nur, aber auch aus dem oben zitierten, sind die arbeiteten Menschen von Unfällen und von Berufskrankheiten bedroht.
Aus all dem resultieren in der Arbeitswelt vielfältige soziale Konflikte und Kämpfe.
Walter Köpping schreibt: „Millionen von Menschen (Lohnarbeiter und aus der Lohnarbeit Rausgefallene) leben unter schwierigen materiellen Bedingungen. – Löhne, Renten, soziale Absicherung und Bildungsstand sind zu gering. Stichworte: ausländische Arbeitnehmer, prekär Beschäftigte, Konkurrenzkampf usw. (S. 323).
Depressionen in modernen Industrienationen werden oft in einem Zusammenhang mit den rasanten Veränderungen von Gesellschaft und Wirtschaft und dem damit einhergehenden vermehrten Stress gesehen. Es ist anerkannt, dass dabei Faktoren wie Arbeitsplatzunsicherheit, wachsende Anforderungen an Mobilität und Flexibilität, Auflösung vertrauter Strukturen, Leistungsdruck und innerbetrieblicher Konkurrenzkampf eine zunehmende Rolle spielen. Diesen Erschöpfungszustand, der im Rahmen von Überlastungen am Arbeitsplatz entsteht, ist allgemein bekannt. Diese Probleme aber findet man in der herkömmlichen, der ‚echten‘ Literatur nicht oder werden nur nebenher erwähnt.
Kunst und Literatur für Lohnarbeiter aber sollte die Realitäten des Lebens widerspiegeln. Zum Leben der Menschen gehört nun einmal die Arbeit.
Wenn Arbeiterliteratur dazu beiträgt, fest im Bewusstsein der Menschen zu verankern, dass die Arbeit, wenn sie auf Lohnarbeit reduziert ist, die Ausbeutung, Nöte und Gefährdungen, die die Arbeitsbedingungen – die auf Konkurrenzkampf untereinander ausgerichtet ist – größtenteils hervorbringt, kann Sie als notwendige Literatur für die Humanisierung der Gesellschaft betrachtet werden. Sie kann dadurch eine wesentliche Ergänzung der Literatur sein. Man sollte nicht geringschätzig auf diese Literatur und den Autoren herabsehen, weil sie ‚anders‘ ist, schreibt Walter Köpping (S. 332).
Köpping weist auch darauf hin, dass diese Literatur Bundesgenossen, politische Verstärker, die Gewerkschaftsbewegung braucht, auch im Zusammenwirken mit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, um den gesellschaftlichen Stellenwert zu heben. (S. 333)
Weiters meint er, dass der gesellschaftliche Stellenwert der Arbeiterliteratur sich nicht objektiv festlegen lässt. „Das hängt davon ab, was ein Mensch unter Gesellschaftspolitik versteht, ob er eine konservative, eine progressive oder gar revolutionäre Grundhaltung hat. Und es hängt nicht weniger davon ab, ob der Mensch sich mit Dichtung beschäftigt oder ob er darauf verzichtet, so bleibt lediglich eine subjektive Bewertung.“ (S. 334)
„Gewiss aber vermag diese Literatur mehr, als ihre Kritiker vorgeben. Sie erhebt keinen Absolutheitsanspruch, es kann nicht darum gehen, künftig nur noch politische Literatur zu produzieren. Die Arbeiterliteratur ist als Bereicherung, als wesentliche Ergänzung unserer Literatur zu verstehen, sie kann dazu beitragen, soziale Missstände bewusst zu machen. Es geht dabei um Bewusstseinsveränderung auf doppelte Weise: Änderung des Bewusstseins der Arbeitnehmer und zugleich Veränderung im öffentlichen Bewusstsein. Arbeiterliteratur macht die Probleme der Arbeitswelt sichtbar begreifbar.“ (S. 335)
Von der Arbeiterliteratur kommen wesentliche Anstöße zu gesellschaftlichen Veränderungen, sie ist ein Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt.
Walter Köpping fasst zum Schluss seines Artikels das Wesentliche noch einmal zusammen in dem er schreibt: „Arbeiterliteratur ist authentische Literatur. Berufsschriftsteller erfinden in der Regel Personen und Handlungen. Der Arbeiterschriftsteller empfindet Arbeit, Arbeitswelt und deren Mühsale. Berufsschriftsteller suchen oft lange nach einem Stoff, einem Thema. Für Berufsschriftsteller ist Schreiben vielfach Flucht aus der realen Welt. Für Arbeiterschriftsteller ist das Schreiben eine Auseinandersetzung mit der realen Welt.“ (Walter Köpping, S. 337)
Köpping Walter, „Gewerkschaftliche Monatshefte“ 6, 1974, S. 329, S. 332, 331, 333, 334, 335, 337.
Prager Theodor, Grad des Bachelor of Commerce, Doctor der Philosophy, (Economics), „Das Märchen vom Lohn, der nicht steigen darf“, Stern Verlag, 1951.
Treptow Elmar, Professor der Philosophie,“Die widersprüchliche Gerechtigkeit im Kapitalismus“ Weidler Buchverlag, 2012, S. 303.




![Ran an den Feind - Kinderbuch aus der Bibliothek für Jugendbuchforschung, Goethe Universität Frankfurt am Main. Ran an den Feind. [O.A.]](https://iza-server.uibk.ac.at/pywb/dilimag/20210113092156im_/https://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/wp-content/uploads/2014/05/Ran-an-den-Feind-196x300.jpg)