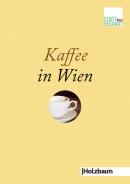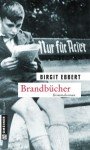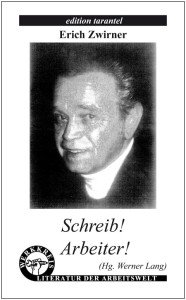Papa hat sich erschossen
Mittwoch, 4. Februar 2015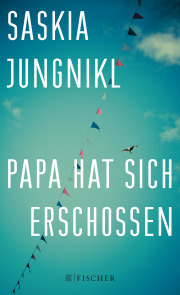 Als ich Saskia Jungnikls Satz im „Album“, der Beilage in der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ lese, fällt eine große Last von meinen Schultern. Auch ich unterliege dem –selbstauferlegten – Druck nach einem Todesfall möglichst schnell wieder zu funktionieren. Ich leiste Trauerarbeit und merke, dass ich in den in diesem Konzept beschriebenen Phasen nicht vorwärtskomme, immer wieder ganz vorne anfangen muss. Anscheinend werde ich mit meiner Trauerarbeit – ein Wort, das ich mittlerweile kategorisch ablehne – nie fertig. Ich bin ungeduldig. Ich bin wütend und frage mich, wann sich diese Trauer endlich vom Acker macht. Und dann gibt es den nächsten Satz, der mir den Kopf zurechtrückt: „Trauer gibt einen Dreck auf meine Ungeduld.“
Als ich Saskia Jungnikls Satz im „Album“, der Beilage in der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ lese, fällt eine große Last von meinen Schultern. Auch ich unterliege dem –selbstauferlegten – Druck nach einem Todesfall möglichst schnell wieder zu funktionieren. Ich leiste Trauerarbeit und merke, dass ich in den in diesem Konzept beschriebenen Phasen nicht vorwärtskomme, immer wieder ganz vorne anfangen muss. Anscheinend werde ich mit meiner Trauerarbeit – ein Wort, das ich mittlerweile kategorisch ablehne – nie fertig. Ich bin ungeduldig. Ich bin wütend und frage mich, wann sich diese Trauer endlich vom Acker macht. Und dann gibt es den nächsten Satz, der mir den Kopf zurechtrückt: „Trauer gibt einen Dreck auf meine Ungeduld.“
Dabei hatte ich mit „meinem“ Todesfall Glück: kein Unfall, kein Mord. Kein Suizid – so wie bei Saskia Jungnikl, deren Vater sich 2008 erschossen hat. „Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch.“ Ihren „Bericht“ über diesen Tag, über die Zeit danach, über die Zeit davor verfasst sie in der Gegenwartsform, bleibt so ganz nahe am Geschehen, erlaubt keine scheinbare, abgeklärte Distanz. Die Zärtlichkeit, die Saskia Jungnikl mit ihren Eltern verbindet, braucht keine ausschweifenden Formulierungen. Sie nennt sie Papa und Mama – das genügt.
Saskia Jungnikl zeichnet ein unsentimentales Bild ihres Vaters und entgeht so dessen undifferenzierter Verklärung. In einigen Kapiteln lässt sie ihn selbst zu Wort kommen: in Kurzgeschichten und Gedichten. Sie zeigt ihn als widersprüchlichen Menschen: künstlerisch tätig und anpackend, willensstark und sensibel. Er neigt dazu, andere zu dominieren. Er fühlt sich schuldig am Tod seines Sohnes Till, der mit 26 Jahren stirbt; droht daran zu zerbrechen. Es gibt keinen Trost, nicht für die Schwester Saskia, nicht für die zwei anderen Brüder, nicht für die Mutter: „Doch dass mein Bruder alleine gestorben ist, dass ich nicht da war, das kann ich nicht verwinden. Niemand von uns kann das.“
Und was kann sie antworten, wenn jemand sie fragt, wie viele Geschwister sie hat? Zwei lebende? Drei prägende? „Ich bin Halbwaise, weil mein Papa tot ist, aber was bin ich, weil mein Bruder tot ist?“
Der Suizid des Vaters hinterlässt Fragen nach dem Warum, Schuldgefühle, Wut.
Jede/r in der Familie versucht auf die eigene Art, damit zurechtzukommen. Saskia Jungnikl hat viele Affären, trinkt viel, geht viel weg, unternimmt eine Reise nach Afrika. Nichts davon schafft „Abhilfe“. Renate, eine gute Freundin, hält zu der Trauernden, Um-sich-Schlagenden, Verzweifelten, andere Beschimpfende, Zynische; erträgt sie, scheut keine Auseinandersetzung mit ihr – obwohl auch die Freundin hilflos, ratlos, verzweifelt ist.
„Es heißt, dass jeder Suizidtote etwa drei bis fünf Angehörige hinterlässt.“ Suizid ist (nach wie vor ) ein Tabu. Von betroffenen Angehörigen gibt es selten etwas zu lesen oder zu hören. Saskia Jungnikl bietet als Angehörige keine Phrasen à la „Die Zeit heilt alle Wunden“. Sie bemüht sich, alles nach „Trauerbewältigungsanleitungen“ zu absolvieren; trotzdem ist sie frustriert von diesem Vor und Zurück. Langsam, aber sicher gibt es viele Tage, „an denen alles wie ein weit entfernter Schrecken hinter mir liegt“. Dass die Wunde endgültig verheilen wird, diese Hoffnung wird immer wieder zunichtegemacht. Ein Anknüpfen an das vorige Leben ist nicht mehr möglich. Diese Einsicht macht Angst. Sie macht unsicher. Sie schürt Zweifel. Sie ist jedoch unausweichlich; sie ist ehrlich – und ist genau deswegen Trost. Wahrscheinlich nicht nur für mich.
Petra Öllinger
Saskia Jungnikl: Papa hat sich erschossen.
FISCHER Taschenbuch, Frankfurt am Main 2014. 255 Seiten, € 15,50 (A)
Über Saskia Jungnikl