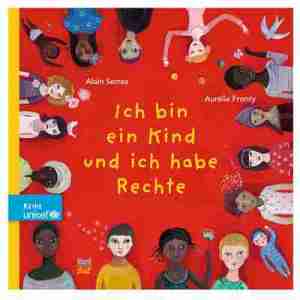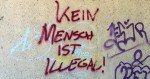Herzlichen Dank an Michael Karjalainen-Dräger, der dem „Duftenden Doppelpunkt“ den Beitrag „Ich bin eine kämpferische Sprachfeministin“ aus seinem Blog „MEIN SENF ZU ALLEM“ zur Verfügung gestellt hat.
Die Minister sollen, so die Forderung, „dem Wildwuchs durch das sprachliche ,Gendern‘“ Einhalt gebieten. „Ein minimaler Prozentsatz kämpferischer Sprachfeministinnen darf nicht länger der nahezu 90-prozentigen Mehrheit der Staatsbürger ihren Willen aufzwingen“, sagen die Unterzeichner. Sie sehen darin einen Widerspruch zur Demokratie. „Was die Mehrheit der Sprachteilhaber als richtig empfindet, wird als Regelfall angesehen. Wo immer im Laufe der Geschichte versucht wurde, in diesen Prozess regulierend einzugreifen, hatten wir es mit diktatorischen Regimen zu tun.“
Jetzt ist das auch klar: Ich bin eine kämpferische Sprachfeministin – mit kleinem „i“. Damit habe ich in einem Satz mein Geschlecht gewechselt. Frage ich mich aber, ob es mein soziales oder mein körperliches Geschlecht ist. Denn je näher ich darüber nachdenke, desto verwirrender und unlogischer sind die Ansätze und Aussagen der rund 800 Kämpfer gegen das Binnen-I, die eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität fordern.
Da befremdet mich erst einmal, dass extra betont werden muss, dass mehr als die Hälfte der Unterzeichner (männliche Form) weiblich sind. Als Aushängeschild hat sich Chris Lohner zur Verfügung gestellt. Bei den Herren der Schöpfung sind es aber wesentlich mehr Promis (Lissmann, Taschner, Mayer, Schröder, Sick).
Dann wird versucht die gendersensible Sprache als Ausdruck eines diktatorischen Regimes darzustellen, weil sie gegen den Willen von angeblich 90 Prozent der Staatsbürger (wieder nur männliche Form) sei.
Weiters wird auch jeder (und nicht nur jede), der für das sprachliche Gendern eintritt, als der 10-prozentigen Minderheit der kämpferischen Sprachfeministinnen zugehörig dargestellt. Hier ergeben sich zumindest zwei Fragen, nämlich diese nach dem Umgang mit Minderheiten in einer Gesellschaft und jene nach der Verweiblichung von geschlechtersensiblen Männern. Soll ich das jetzt als Diskriminierung verstehen? Ich tue es nicht, es ist mir eine Ehre, dazugerechnet zu werden. Dennoch nehme ich für mich in Anspruch, dass ich ein Feminist bin und keine Feministin.
Angeführt wird auch, dass diese Formulierungen die gewachsene Struktur der Sprache zerstören und den Grundregeln der Sprache widersprechen. Gefordert wird daher nichts geringeres als die Eliminierung derselben aus dem Sprachgebrauch. Was für ein starkes, männliches Wort! Ich bin beeindruckt von der mangelnden sprachlichen Sensibilität meiner Geschlechtsgenossen.
Abschließend wird der ÖNORM-Entwurf zur geschlechtergerechten Sprache als Lösung angeführt. Dieser schlägt vor beide Geschlechter getrennt und vollständig anzuführen. Das ist ja seit dem Gendern auch schon möglich, davor allerdings war bloß die männliche Formulierung normal, es gab für viele Begriffe keine weibliche Form.
Was ist also mit der von den Proponenten und Proponentinnen Rückkehr zur Normalität tatsächlich gemeint?
Betrachten wir es trotz all der Schärfe, die in der Art und Weise, wie das Anliegen kolportiert wird, liegen mal mit großer Milde: ein Thema, dass sich mit dem Sommer im Herbst verziehen wird. Die dahinterliegenden Motive jener Unterzeichnenden aber halte ich für potentiell gefährlich. Daher wird man weiter auf sie achten müssen.
Weiterführende Links:
Offener Brief zum Thema „Sprachliche Gleichbehandlung“
„Geschlechtergerechter Sprachgebrauch Empfehlungen und Tipps“ – ein kurze Zusammenfassung auf der Site des Bundeskanzleramtes
„Reaktionärer Backlash“ – ein Beitrag über den politisch-ideologischen Hintergrund in Zusammenhang mit dem Thema gendergerechte Sprache auf der Site „stoppt die rechten“
Severin Groebner: In diesem Sommerloch steckt ein großes „I“ – eine kabarettistische Annäherung an das Thema