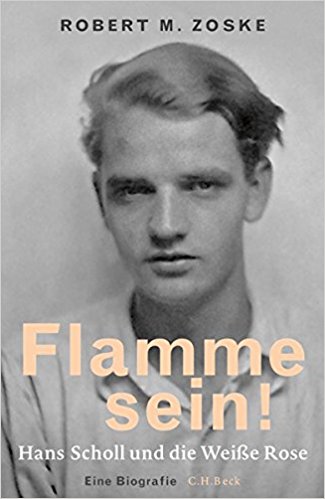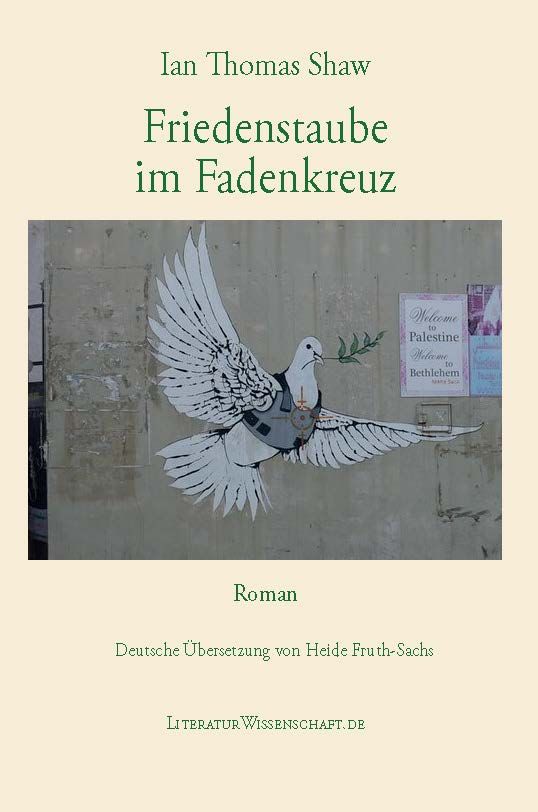Aus dem Museum ins Lager und wieder zurück
Gaby Weber erforscht mit den „Churer Todesbildern“ ein bedeutendes Werk der Schweizer Wandmalerei
Von Franz Egger
Ein besonderer Glücksfall ist eingetreten: Ein qualitätsvoller Bilderzyklus, seit Jahrzehnten ohne ausführliche Publikation, fristete sein Dasein im Depot. Rechtzeitig zu seiner Ausstellung im neuen Domschatzmuseum in Chur erhielt er nun endlich eine mustergültige wissenschaftliche Darstellung. Ende August 2020 eröffnete das Domschatzmuseum, nur zwei Wochen vorher war das passende Buch von Gaby Weber, Die Todesbilder im Bischöflichen Schloss in Chur, erschienen.
Die Churer Todesbilder sind eine über 15 Meter lange und etwa 3,5 Meter hohe in Grissailletechnik bemalte Fachwerkwand mit 35 Szenen aus dem Bischöflichen Schloss in Chur. Zum Zyklus gehören acht Sockelfelder und einige Bretter mit lateinischen Inschriften. Zweimal erscheint die Jahreszahl 1543. Die Bilder sind eine frühe Kopie der Holzschnitte Bilder des Todes von Hans Holbein dem Jüngeren aus dem 16. Jahrhundert. Die nur etwa 5,5 cm hohen Holzschnitte Holbeins zeigen in vielen Einzelszenen, wie der Tod als Skelett die Menschen bei ihrer Arbeit aus dem Leben reißt. Die Gleichheit aller Menschen vor dem Tod ist bei Holbein, wie bei den mittelalterlichen Totentänzen, eine Grundaussage. Im Jahre 1882 wurden die Churer Todesbilder wegen eines Umbaus aus dem bischöflichen Schloss ausgebaut und im Rätischen Museum ausgestellt. 1976 entzog man die Bilder den Augen der Öffentlichkeit und stellte sie ins Depot.
Schritt für Schritt führt die Autorin anhand der Entdeckungs- und Forschungsgeschichte in das Thema ein. Dadurch erhält die Darstellung eine große Unmittelbarkeit. Der Zyklus von Chur ist nicht nur eine qualitätsvolle Malerei, er besitzt auch eine spannende Geschichte.
Die Bilder wurden von Jacob Burckhardt entdeckt und 1857 erstmals beschrieben. Er erkannte sofort die Ähnlichkeit mit den Holzschnitten Holbeins. Im Jahre 1878 publizierte Friedrich Salomon Vögelin hierzu eine Monografie. Er ging von einem eigenhändigen Werk Holbeins aus und erregte damit massiven Widerspruch. So nahmen die nicht abreißenden Diskussionen um den Künstler der Churer Todesbilder ihren Anfang. Die angebrachte Jahreszahl 1543 war dabei noch nicht entdeckt worden. Gaby Weber zeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Churer Todesbildern genau nach; auch die Restaurierungen gehören dazu.
Der Churer Künstler setzte die kleinen Holzschnitte Holbeins in das ganz andere Medium der Wandmalerei um und vergrößerte die Vorlagen stark. Er kopierte nicht stur, sondern nahm Änderungen vor, die die Autorin genau beobachtet und interpretiert. Durch kleine Weglassungen erhalten die Churer Todesbilder eine andere Bedeutung als die Holzschnittfolge Holbeins. In Chur fällt etwa die Kritik an der Kirche und ihren Vertretern weg. Weber erklärt diesen Befund plausibel als Rücksichtnahme auf den bischöflichen Auftraggeber. Man könnte, bei aller Vorsicht, auf die Bildung und die geistesgeschichtliche Stellung des Künstlers schließen, was die Autorin aber unterlässt. Der Künstler hatte Holbeins Kritik an der Kirche sehr wohl verstanden und wusste genau, was er wegzulassen oder zu verändern hatte.
Wie es auch die Forschung seit Längerem tut, geht Weber von mehreren Künstlerhänden aus. Das große Rätsel des unbekannten Künstlers (oder der unbekannten Künstler) bleibt indes bestehen – Weber erwähnt die vielen Zuschreibungen, ist dabei aber sehr zurückhaltend und verzichtet auf Spekulationen. Die Churer Todesbilder sind ganz singulär; weit und breit ist kein vergleichbares Werk zu finden. Wer so gut zu kopieren versteht wie der Künstler von Chur, entwickelt kaum einen eigenen Stil und entschwindet stattdessen im Dunkel der Anonymität.
Der zweite umfangreiche Hauptteil von Webers Werk besteht aus einem mustergültigen Katalog: Jede Szene, jedes Sockelfeld und jedes Brett wird vorgestellt, beschrieben und mit zahlreichen Informationen über Inschriften, Bibelstellen, Erhaltungszustand, Restaurierungsgeschichte und so weiter versehen. Auch die im Laufe vieler Jahrzehnte gemachten Aufnahmen des Zyklus werden hervorragend dokumentiert.
Mit ihrem feinsinnigen Blick für Details hat Gaby Weber hier ein Standardwerk geschaffen. Viele interessante Beobachtungen, große Genauigkeit, klare Darstellung, bewusster Umgang mit der Sprache, gute Aufnahmen und eine ansprechende Buchgestaltung zeichnen ihren Text aus. Die Churer Todesbilder, ein kulturgeschichtlich herausragendes Werk, haben somit eine ihnen zustehende ausgezeichnete wissenschaftliche Bearbeitung erhalten.
Ein Beitrag aus der Mittelalter-Redaktion der Universität Marburg
|
||