Das Team von 54books hat sich zusammengesetzt, um das Jahr 2018 Revue passieren zu lassen. Der geneigte Leser möchte, so er sich dazu berufen fühlt, gerne aufgeworfene Fragen ebenso in den Kommentaren beantworten. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, den Zuspruch und das Mitlesen in 2018 und im Voraus für dasselbe in den kommenden Jahren.
1. Welches war das beste Buch, das du 2018 gelesen hast?
Tilman: Der Eindruck ist noch frisch, das beste Buch ’18 las ich gerade erst: Maya Angelou – Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Das hat mir die Schuhe ausgezogen. Außerdem mochte ich Tante Julia und der Kunstschreiber bzw. (in der neuen Übersetzung) Tante Julia und der Schreibkünstler von Vargas Llosa sehr. Das habe ich mal vor hundert Jahren gelesen und hatte es jetzt für meine Reise nach Peru im Gepäck. Gute Unterhaltung ohne platt zu sein. Apropos Ausland, nach Peru war ich in Bolivien, daher las ich vorher Die Affekte von Rodrigo Hasbún, das knallt!
Simon: Am meisten beeindruckt und zum Nachdenken gebracht hat mich Bettina Wilperts nichts, was uns passiert. Ob es DAS beste Buch war, kann ich nicht sagen, aber es ist mir am meisten positiv im Kopf geblieben aus diesem Jahr.
Katharina: Habe dieses Jahr sehr viele sehr gute Bücher gelesen, und dann habe ich gerade mal wieder “A Christmas Carol” von Dickens gelesen. Dickens. Man sollte nur noch Dickens lesen. Allein wie der Häuser beschreibt.
Samuel: Heinz Helles “Die Überwindung der Schwerkraft”
Berit: Ich habe, nachdem ich es ewig geplant hatte, endlich Audre Lordes Sister Outsider. Essays and Speeches by Audre Lorde gelesen und es war großartig. Danach hatte ich die Gelegenheit mit einigen Freundinnen und Bekannten in einem Gruppenchat via Skype über das Buch zu sprechen und es war wirklich bewegend, wie sehr es alle berührt hatte. Außerdem hat das Buch Match Deleted: Tinder Shorts von Sarah Berger bei mir nachhaltigen Eindruck hinterlassen, weil ich die Erzählweise innovativ und inspirierend fand.
Elif: Am meisten beeindruckt hat mich Bleib bei mir von Ayòbámi Adébáyò. Mit Du wolltest es doch von Louise O’Neill und Was ist schon normal? von Holly Bourne sind aber auch ein paar eindrucksvolle Jugendromane erschienen, die sich mit Themen wie Rape Culture und Feminismus auseinandersetzen. Max Czolleks Desintegriert euch! zähle ich auch dazu, hat mir sehr gut gefallen.
Matthias: Ich lese ja nicht so wahnsinnig viel. Das Buch, das mich 2018 am meisten fasziniert hat, habe ich vor 2018 angefangen und werde ich dieses Jahr nicht mehr abschließen, nämlich Uwe Johnsons Jahrestage. Max Czollek fand ich aber auch sehr klasse.
2. Welches war das schlechteste Buch, das du 2018 gelesen hast?
Simon: Ohne wenn und aber Andreas Eschbachs NSA – Nationales Sicherheits-Amt, das hat in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht den Vogel abgeschossen.
Tilman: Boah, gab schon paar schlechte. Die siebte Sprachfunktion hat mich enttäuscht. Vieles war einfach so ein Grundrauschen, was nicht so richtig schlecht war, aber eben auch nicht gut.
Katharina: Habe ich alle rechtzeitig abgebrochen.
Samuel: Christian Torklers “Der Platz an der Sonne”
Berit: Mir hat Donna Haraways Unruhig bleiben: Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän nicht gefallen, das mag aber auch an mir liegen.
Elif: Ohne Zweifel Peter Stamms Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt. So nichtssagend. Ja, er spielt mit Zukunft und Vergangenheit und bla, aber im Grunde will ein alter Typ nur die ganze Zeit was mit einer jungen Frau haben und ist ganz melancholisch. Wie gefühlt jede 0815-Geschichte eines weißen, (mittel)alten Mannes. Vielleicht bin ich dadurch auch einfach nicht das Zielpublikum. Wäre auch meine Antwort für die nächste Frage, weil ich wirklich nichts aus diesem Buch ziehen konnte.
Matthias: Richard David Precht, Jäger, Hirten, Kritiker. Ein durchweg ärgerlicher, vorhersagbarer, schlecht gemachter und zu allem Überfluss heftig nach rechts anschlussfähiger Schinken. Den habe ich auch für 54books rezensiert.
Tilman: Ich muss mich hier nochmal einschalten und Bezug auf Elif nehmen. Ich war bei Peter Stamm völlig ratlos, was genau an diesem Buch erzählenswert ist, “nichtssagend” trifft es perfekt. Wäre Walser jünger, er schriebe Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt.
3. Das überflüssigste Buch 2018 war?
Tilman: Ich finde diese ganzen Aufgüsse von alten Texten immer fürchterlich überflüssig. Stuckrad-Barre nennt das selbstentlarvend immer Remix, verkauft sich wie geschnitten Brot, gönn ich ihm – aber wenn jetzt jeder Internetschreiberling anfängt nur seine alten (also die letzten zwei Jahre) Texte aus dem Internet zusammenzusuchen und zu drucken .. schade um das Papier und das Geld und die Zeit und das Internet.
Simon: Martin Walsers Gar alles oder Briefe an eine Unbekannte, das waren vermutlich einfach Texte, die Walser noch rumliegen hatte, die er irgendwie zusammengeschraubt hat und weil Martin Walser drauf steht, wirds gedruckt. Auch überflüssig fand ich Marc-Uwe Klings Qualityland, das war nur platte Pauschalkritik und banaler Hihi-Humor.
Katharina: “Zusammenleben” von Leander Scholz, ein Buch, das so tut, als wäre ganz Deutschland eine Kleinfamilie aus der Mittelschicht.
Samuel: “Die Hungrigen und die Satten” von Timur Vernes
Berit: Überflüssige Bücher gab es einige, mich ärgern besonders “Debattenbücher” von Menschen, die mit einer sich verändernden Gesellschaft nicht klarkommen, der Schutzheilige dieser schmierigen Nische ist sicher Thilo Sarrazin.
Matthias: Im Zweifel immer der neue Maschmeyer.
Tilman: Es gibt einen neuen Maschmeyer?
4. Welches war die interessanteste Feuilleton-Debatte/der interessanteste Feuilleton-Artikel des Jahres?
Katharina: Ganz pauschal würde ich ja sagen, dass das Feuilleton an sich interessant ist und dass da viele, viele, viele interessante und lesenswerte Sachen geschrieben worden sind, dass es viele spannende Rezensionen gegeben hat und dass das Feuilleton halt häufig leider gerade da am uninteressantesten wird, wo es sich am meisten darum bemüht, interessant zu sein, eben deswegen, weil es oft sehr bemüht wirkt, wie Schattenboxen oder wie ein angestrengter Kompromiss.
Simon: Persönlich fand ich die Debatte – wenn man das in diesem Fall so nennen kann – im Anschluss an die Poetikvorlesung von Christian Kracht sehr interessant.
Berit: Ich habe gerne die Beiträge von Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski zu digitalen und Tech-Themen in der NZZ gelesen.
Matthias: »After the Fall«, Adam Gopniks gigantischer Rezensionsessay von Patrick Sharkeys Buch Uneasy Peace über das faszinierendste soziale Phänomen der letzten Jahrzehnte, nämlich den drastischen und nachhaltigen Rückgang der Kriminalität; und »Safer Spaces«, Jia Tolentinos Reportage über evidenzbasierte Maßnahmen, um sexuelle Übergriffe auf amerikanischen Hochschulcampi zu reduzieren. Beides natürlich im New Yorker. (Ist das Feuilleton? Ich behaupte einfach mal: Im New Yorker ist immer alles Feuilleton.)
5. Welches war die überflüssigste Feuillleton-Debatte/der überflüssigste Feuilleton-Artikel des Jahres? [Welches war die Feuilleton-Debatte, die am weitesten vom wirklichen Leser entfernt war?]
Katharina: Die “Debatte” um Simon Strauß war ein phänomenaler Tiefflug, den zu unterbieten auch in kommender Zeit schwierig werden wird – immerhin haben sich in ihrem Kontext aber einige mühevoll als Ulknudeln positionieren können, die zwar Angst vor dem angenommenen Männlichkeitsbild von Simon Strauß haben, gerne aber öffentlich auf ihre Begeisterung für Haftbefehl hinweisen, als würden nicht tausende Teenager dessen “Rollenprosa”, sowohl die misogyne wie die antisemitische, sehr unironisch hören und auswendig lernen. Da sieht man halt, dass es eigentlich nicht so sehr um sachliche Fragen oder Inhalte ging, sondern viel mehr um die Positionierung im literarischen und kulturellen Feld.
Berit: Die Kollegah-Debatte hat mich sehr genervt und führte teilweise zu wirklichen Meisterwerken selbstgerechter Verblödung. Ich wäre dankbar, wenn ich in 2019 nie wieder Rollenprosageschwafel und Grenzüberschreitungsanhimmelei von saturierten Feuilletonbros hören muss.
Simon: Ich schließe mich hier Berit an!
Matthias: Wie seit Jahren war auch 2018 nahezu jede Äußerung des Feuilletons zu Verkehrsthemen großer Unfug, und den Vogel haben wie immer die Einlassungen von Ulf Poschardt zum Thema Autofahren abgeschossen. Möglicherweise hat auch Rainer Meyer, dem es aus mir komplett unverständlichen Gründen sogar von seriösen Medien gestattet wird, unter dem infantilen Pseudonym »Don Alphonso« zu schreiben, etwas zum Thema Auto gesagt, das könnte dann sogar noch schlimmer sein, ich traue mich aber nicht nachzuschauen, weil mich das dümmer machen würde.
6. Das beste/schlechteste lektürebegleitende Lebensmittel 2018?
Tilman: Habe mir gestern die Hände eingecremt – das war die Hölle, alle Seiten fettig.
Simon: Das beste war und ist ohne Frage heißer Ingwer mit Zitrone und Honig, aber so stark, dass es milchig ist, sonst kann man es auch lassen. Am schlechtesten alles, was fettig ist, da hat Tilman recht!
Katharina: Wenn man sich allerdings die Hände nicht eincremt und zu trockener Haut neigt und dann zu eingerissene Haut an den Fingern hat, die auch manchmal blutet, ist das auch nicht gut, dann hat man Blutflecken im Buch.
Samuel: Buttrige Artischockenblätter
Berit: Sehr gut und richtig sind Kaffee und Lakritz, sehr schlecht sind Lutschbonbons, die einem die Zähne zur Maulsperre zusammenkleben, wenn man abgelenkt beim Lesen darauf herumkaut.
Elif: Bei mir gibt es nur Mate. All day, every day.
Matthias: Ich esse und trinke eigentlich selten beim Lesen von Büchern. Beim Lesen am Bildschirm schaufle ich in mich hinein, was eben da ist, und muss dazu feststellen, dass die Bunten Schnecken von Haribo echt was taugen. Wie immer enttäuschend: Paprikachips in zu großer Menge.
7. Der unnötigste sachliche Fehler in einem Artikel/Buch im Jahr 2018 war….?
Katharina: Als ob mir sowas auffiele.
Samuel: Deportationen nach Auschwitz im Sommer 1939 stattfinden zu lassen (in einem Familienroman)
Berit: Mir ist keiner aufgefallen, vielleicht lese ich nicht genau genug?
Simon: Ich erinnere mich, irgendwo einen gesehen zu haben, aber offenbar war er nicht gravierend genug, mhm.
Matthias: Michael Naumann in seiner Rezension der Tagebücher von Lion Feuchtwanger: »Arno Schönberg«. Dass der Großjournalist das einfach so hinschrieb und die größte deutschsprachige Wochenzeitung des Universums es unkorrigiert durchwinkte – das war ein Lehrstück in Sachen deutscher Medienbetrieb. Es sind die Kleinigkeiten und Äußerlichkeiten, die den Kampfgeist ausmachen (glaubt das nicht mir Ungedientem, glaubt es Norman Schwarzkopf jr., den ich damit sinngemäß zitiere).
8. Ulkigste Äußerung einer Person des öffentlichen Lebens zum Buchmarkt 2018?
Katharina: “Was fehlt, ist eine Arbeiterliteratur, die erzählt, was Menschen überall in Deutschland weg von Linkspartei und SPD in die Arme der AfD treibt.” (Ulf Poschardt) Als gäbe es dafür nicht Sachbücher und als gäbe es nicht – inzwischen bekanntermaßen – auch sehr finanzkräftige Unterstützer der AfD, deren Motivation ja auch ganz spannend wäre. Was fehlt, ist eine Arbeiterliteratur, die nicht der argumentativen Verzweckung von irgendwem untergeordnet ist.
Samuel: Waren mehrere … man müsse Christian Kracht jedes Wort 1:1 so abnehmen, wie er es in Frankfurt anlässlich seiner Poetikdozentur vorgetragen habe, kam bei vielen Berichten einer Verkennung der Ambivalenz des inszenierten literarischen Sprechens im hyperöffentlichen Raum der Vorlesung gleich, in dem ja beides zugleich möglich ist: Aufrichtigkeit und Maskerade, Transparenz und Opazität.
Berit: Die Reaktionen von zentralen Instanzen des Buchbetriebs auf die Leserschwundstudie des Börsenvereins und den durch die Digitalisierung ausgelösten Marktveränderungen schwankten zwischen völliger Fassungslosigkeit angesichts eines seit Jahren absehbaren Paradigmenwandels und wirklich amüsant-verzweifelten Anrufen einer Art Buchhygges, in der das Buch dann rasch auf eine Ebene mit dem Gläschen Wein oder einer entspannten Yoga-Einheit gesetzt wurde. Lesen als “Oase der Entschleunigung” und die Zeitdiebe aus Michael Endes Momo als Metapher für die Digitalisierung.
Matthias: Ganz eindeutig die Forderung danach, die Anzahl der Neuerscheinungen im gesamten Markt zu reduzieren, weil ja niemand mehr alles lesen könne. Das macht aus Lesen ein komplettistisches Hobby wie Münzensammeln und erklärt zudem alle Bücher für irgendwie gegeneinander austauschbar. Unfug, wie auch immer man es dreht und wendet.
9. Hast du 2018 ein Buch wiedergelesen oder wiederentdeckt?
Tilman: Ja, der oben erwähnte Llosa, das war wirklich schön. Außerdem habe ich meine jährliche Dosis Die Welt von Gestern nicht verpasst. Grandioses Buch!
Simon: Ich habe noch einmal Jakob Noltes Alff gelesen, das mich vor vier Jahren vom Hocker gerissen hat und ich habe zufrieden festgestellt, dass es mich immer noch begeistert. Außerdem im Zuge meiner Dissertation sogar zweimal Jack Kerouacs On the Road, das war vor allem interessant, weil ich es zuletzt mit 19 gelesen hatte und einen völlig anderen Blick darauf hatte.
Katharina: Habe “Das Ungeheuer” von Terézia Mora nochmal gelesen und wieder sehr gemocht – ich weiß gar nicht mehr, warum ich “Der einzige Mann auf dem Kontinent” so unfassbar zäh fand, vielleicht sollte ich das auch nochmal lesen.
Samuel: Weiß nicht, ob das als “Wiederentdeckung” zählt, aber César Airas “Stausee” von 2000 (Droschl) ist sehr irre / merkwürdig / toll.
Berit: Herman Bang wiedergelesen, Herman Bang weiterhin gemocht.
Elif: Äh, ich leshöre grade nur Harry Potter und der Halbblutprinz wieder. Es ist immer noch sehr gut.
Matthias: Ich habe Mutanten auf Andromeda von Klaus Frühauf gelesen, ein Buch, das mich in meiner Kindheit so fasziniert hat, dass ich es ca. viermal gelesen habe. Und was soll ich sagen? Es ist Science-Fiction-Meterware aus der DDR, spannend, aber etwas hölzern geschrieben, hochwertig hergestellt, avantgardistisch illustriert, linientreu und letzten Endes langweilig. Ich habe ein ganzes Regalbrett mit dem Zeug, allmählich sollte ich es doch mal lernen.
10. Hat sich 2018 dein Leseverhalten verändert?
Tilman: Nicht das Lesen an sich, aber der Besitzstand. Schlechte Bücher verlassen meinen Haushalt – meist gratis auf die Fensterbank. Ich brauche Platz im Kopf, im Regal und im Herzen.
Simon: Sehr! 2018 war mein erstes Jahr auf Twitter und ich habe so viele Menschen (Wissenschaftler*innen, Autor*innen und Verlage) kennengelernt, die meine Perspektive auf Literatur sehr erweitert und verschoben haben.
Katharina: Nein, aber ich finde mein eigenes Leseverhalten inzwischen derart unerträglich, weil ich so langsam lese, dass ich mir vorgenommen habe, 2019 endlich nur noch schnell und oberflächlich und ohne Notizen zu lesen. Man kommt ja sonst zu nichts.
Samuel: Vielleicht ist es rationaler geworden, um das hässliche Wort “ökonomisch” zu vermeiden. Habe schneller den Drang, ein Buch nach 10, 20 Seiten als lesenswert bzw. abbrechbar zu rubrizieren, das hat ab und zu den Effekt, dem Buch nicht ausreichend viel Chancen-Freiraum zu geben, in dem es sich entfalten könnte.
Berit: Ich begleite mein Lesen noch mehr als früher bei Twitter und führe dort die interessantesten Gespräche über Texte, das war sehr bereichernd. Mein Lesen verändert sich ständig, gerade lese ich Abends manchmal wieder Print und nicht mehr nur eBooks.
Elif: Für mich war das ein Lyrik-Jahr. So viele Gedichtbände wie in 2018 habe ich noch nie gekauft und gelesen.
Matthias: Ich habe tatsächlich mal ein bisschen mehr gelesen als sonst. Also immer noch fast nichts, aber mehr als die letzten Jahre. Danke, 54books!
11. Welcher Indie-Verlag hat 2018 immer noch zu wenig Aufmerksamkeit erhalten?
Tilman: Jeder. Toll die Aufmerksamkeit für Sebastian Guggolz! Aber bitte noch mehr Aufmerksamkeit für Christiane Frohmann, für den Lilienfeld Verlag und alles Gutverkäufliche von Random House, Bonnier und Holtzbrinck!
Simon: Der Frohmann Verlag, der hat mich auf jeden Fall mit der spannendsten – für mich neuen – Literatur konfrontiert. Sehr gefreut hat mich die große Aufmerksamkeit für den Verbrecher Verlag dank Manja Präkels Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß.
Katharina: Neben den schon genannten vermutlich Kookbooks. Ah ja, und ich mag den Elif Verlag. Der macht schöne Bücher, in manchen kommen Mäuse vor. Albino macht auch gute Sachen. Ansonsten mag ich alle Verlage, die klingen wie Brauereien, also beispielsweise Schöffling.
Samuel: Diaphanes, ed[ition] cetera, Wunderhorn Verlag
Berit: Reinecke & Voß macht spannende Lyrik. Mikrotext, Guggolz und Frohmann sind ebenfalls großartig. Noch mehr mediale Aufmerksamkeit würde ich außerdem Reprodukt gönnen, die machen wunderschöne Bücher, besonders die Kindercomics sollten in jedem Kinderzimmer stehen.
Matthias: Im Zweifel alle, es sei denn, sie korrigieren nicht ordentlich, das braucht kein Mensch.
12. Welche ist deine Katze des Jahres?
Tilman: Die Katze meiner Mutter: Bebra. Sie ist benannt nach einer sehr hässlichen, hessischen Stadt. Meine Schwester behauptet, das sei ihre Idee gewesen. Das ist natürlich Unfug: Ich war es.
Katharina: Meine.
Simon: In meinem Leben gibt es keine Katzen und das ist sehr schade.
Samuel: Meiner (ein Kater). Er heißt Heng, wie der luxemburgische Großherzog, ist dementsprechend edel. Er leckt sich immer sehr aristokratisch das Fell und guckt wie der letzte Snob. Und er trinkt ausschließlich Évian – wie Madonna oder so.
Berit: Ich habe ein wenig Angst vor Katzen, schaue sie mir aber gerne aus der Ferne an. Christiane Frohmanns Kater Laser gefiel mir sehr gut, als ich ihn traf. Er war wunderschön wildtigrig und wollte nicht auf meinem Schoß sitzen – Perfekt!
Elif: Die Katzen von Sarper Duman. Besuch der Instagramseite auf eigene Gefahr – ihr werdet vielleicht schmelzen, Herzchenaugen kriegen, weinen, euch verlieben und die Seite nie wieder verlassen. Er adoptiert regelmäßig Straßenkatzen, spielt mit ihnen Klavier und hat inzwischen keine Ahnung wie viele.
Matthias: Meine Katzen des Jahres sind selbstverständlich Chewbacca (aka Chewie aka Tchou-tchou) und Fluse (aka Flusi aka Flou-flou), die beiden Katzen, die meine Frau und ich diesen Sommer adoptiert haben.
13. Welcher literarische Trend wird 2019 vorherrschen?
Tilman: Das gänzlich unliterarische Scheißbuch. Das kann sowohl der x-te Promiquatsch sein (von Promis, die das Leben erklären, bis zu Promis, die literarische dilettieren) als auch diese ganze andere Massmarket Mist. Ich habe sowieso die Hoffnung aufgegeben, nicht nur für 2019.
Simon: Ich habe die Hoffnung, dass es noch mehr Literatur geben wird, die sich der Schreibweisen und der Kommunikation annimmt, die im digitalen Raum immer mehr Alltag werden. Außerdem denke ich, dass noch einiges zu #metoo erscheinen wird, das vielleicht nicht direkt darauf Bezug nimmt, aber das Thema Geschlechterverhältnis/Machtstrukturen aufgreift. Außerdem scheint, wenn man sich in den Verlagsankündigungen umschaut, das Thema “dystopische Zukunft” weiterhin im Trend zu sein.
Katharina: Ich glaube tatsächlich, dass die Klassenfrage mehr und mehr zurückkommt – in der Theorie wie in der Literatur. Es wird Romane zu #unten geben und man kann nur hoffen, dass sie sich nicht mehrheitlich in Klischees und/oder Sozialromantik verheddern. Persönlich würde ich mir einen dauerhaften Trend hin zu einer Romanlänge von maximal 250 Seiten wünschen. Man kommt ja zu nichts.
Samuel: Die Deklination von Heimat in allen möglichen Fällen: kritisch, affirmativ, sarkastisch, naiv. Die normative Engführung von Relevanz und Literatur: Nur Bücher, die einen auf den ersten Blick ersichtlichen / konsumierbaren gesellschaftskritischen Beitrag liefern, sind “IN DIESEN ZEITEN” gefragt. Bücher, die es sich und der Leserschaft schwieriger machen, sind fatales Geplänkel zur falschen Zeit. Das wird die Unachtsamkeit gegenüber sprachlicher Verfahren sowie die Diskreditierung des Ästhetischen zugunsten einer Idee von Literatur als (er-)klärendem Diagnose-Service befeuern. (Ist aber auch schon länger so.) Positiv, hoffentlich, als Trend: dass mehr über Repräsentationen nachgedacht wird, wer wie bei wem auftritt, wem welcher Raum zugestanden wird, etc., zugleich hoffe ich, dass es auch hier nicht zu so einer Engführung kommt nach dem Motto: Ausschließlich Bücher, die eine Diversitätsquote erfüllen, sind wertvolle Bücher. Aber die Frage wird hoffentlich stärker gestellt und klüger beantwortet als bisher.
Berit: Ich prognostiziere eine Verstärkung des Trends zur Lyrik, auch vermehrt mit ästhetischen Verfahren, die dem digitalen Raum entstammen. Außerdem werden wir weiterhin die Tier- und Pflanzenwelt auf Buchdeckeln finden – Käfer, Vögel, Fische, Farne usw. Mit dieser gestalterischen Faszination für Flora und Fauna schleicht sich meiner Meinung nach die latente Wahrnehmung von Klimakatastrophe und Artenschwund auf die Cover. Persönlich hoffe ich daher auf Bücher, die sich auch zwischen den Buchdeckeln mit innovativen erzählerischen Verfahren mit dem Klimawandel befassen, gerne auch in ästhetisch herausfordernder Art und Weise, beispielsweise in Langgedichten oder mit phantastischen Elementen.
Matthias: Im Sachbuchbereich geht der Trend weiter Richtung Krempel und Nachahmertitel, vermute ich. Plus vermutlich eine Lawine billig runtergeschriebener Politsachbücher über den Wachwechsel bei der deutschen Christdemokratie und verwandte Phänomene.
14. Auf welche Neuerscheinung 2019 freust du dich besonders?
Tilman: Das Buch von Berit, das im Herbst 2019 bei Schöffling erscheint.
Katharina: Was Tilman sagt. Und es gibt einen neuen Roman von Streeruwitz, die ich gerne lese.
Simon: Was Tilman sagt. Und ich bin auf Yannic Han Biao Federers Debüt gespannt.
Samuel: Ann Cottens “Lyophilia”, Sibylle Bergs “GRM”, bien sûr auch Berits Roman, was sonst?
Berit: Ich freue mich sehr auf all die norwegischen Bücher, die zur Buchmesse erscheinen werden, ganz besonders darauf, dass nun auch meine Freunde Johan Harstads Max, Mischa und die Tet-Offensive lesen können. (Es wäre außerdem gelogen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich mich riesig auf mein eigenes Buch freue.)
Elif: Schließe mich allen an. Außerdem freue ich mich auf Eure Heimat ist unser Albtraum, Schamlos, beides aus der Perpektive von migrantischen und/oder muslimischen Menschen und auf die Jugendbücher On the Come Up und King of Scars.
Matthias: Was Tilman sagt. Und möglicherweise die Neuedition von Kants Kritik der Urteilskraft in der Akademie-Ausgabe, ich habe gehört, eventuell wird die tatsächlich bald mal fertig.
15. Welche Neuerscheinung 2019 lässt du lieber liegen?
Katharina: Gibt es wirklich noch Leute, die sich auf den neuen Roman von Houellebecq freuen? Ich habe den wirklich mal sehr gerne gelesen, “Die Möglichkeit einer Insel” ist einer meiner Lieblingsromane aus der internationalen Gegenwartsliteratur, aber der schreibt doch auch schon länger einfach nur immer wieder dasselbe Buch mit wechselnden “Zeitdiagnosen”, und wenn ich mir die Zeit erklären lassen will, lese ich Sachbücher von Leuten, die noch bei Trost sind, bei Houellebecq habe ich da meine Zweifel, schon allein, weil er einen Blick für soziale Themen haben mag, einen sehr männlichen, aber immerhin einen Blick – für politische Fragen hat er keinen. Und dieses “der arme einsame Mann in der sozialen Kälte unserer Zeit”-Ding reicht halt irgendwann vielleicht als literarischer Zugang auch nicht mehr, um abendfüllend zu sein.
Simon: Jedes Buch, das mir penetrant etwas erklären will: Sei es meine Generation, den Rechtsruck oder was auch immer.
Samuel: Jan Brandts “Ein Haus auf dem Land”
Berit: Selbstbespiegelnde Bücher arrivierter Autoren, wer interessiert sich schon für die filzigen Flusen aus deren Bauchnabel. Außerdem habe ich die Faustregel, dass ich nie Bücher lese, die kultige Kiezgrößen romantisieren.
Matthias: Grundsätzlich lasse ich jedes Buch liegen, das aus der Feder einer dieser typischen deutschen Themenpundits kommt. Wir haben ja für jedes wissenschaftliche Thema in Deutschland jemanden, der dafür als Experte herumgereicht wird, ohne ein nennenswertes Standing in der entsprechenden akademischen Disziplin zu haben. Leider muss ich den Quatsch trotzdem manchmal rezensieren.
16. Welchen (vergessenen) Klassiker sollte man 2019 wiederlesen bzw. neulesen?
Tilman: Ich werde mir Die Elenden von Hugo reinknattern, außerdem Große Erwartungen von Dickens und Die Auferstehung von Tolstoi, ob man das soll – das weiß ich erst hinterher.
Simon: Wolfgang Borcherts Gesamtwerk (ist ja leider nicht so lang). Ich werde mir im kommenden Jahr mal Hannah Arendt und Simone de Beauvoir vornehmen.
Katharina: 2019 ist Fontane-Jahr und Fontane mag ich. Ansonsten kann man halt mal wieder Gedichte von Lasker-Schüler lesen. Grundsätzlich will ich aber sowieso viel mehr Bücher von toten Menschen lesen – die schreiben einem keine nöligen eMails und außerdem gibt es so viele Klassiker und man kommt ja zu nichts.
Samuel: In der Hinsicht bin ich leider so ein kanonistischer Idiot, der sagt: die Novellen von Heinrich von Kleist.
Berit: Gedichte von Sibylla Schwarz sollte man mal anschauen, weil Barocklyrik fetzt. Ich werde 2019 etwas von der Norwegerin Cora Sandel lesen (Norwegen ist Buchmessegastland 2019) und etwas aus der Sandalen-Serie des dänischen Gladiator Verlages, die spannende nicht-kanonisierte Klassiker wiederauflegen.
Elif: Ich habe mir vorgenommen, Tess of the d’Urbervilles und Rebecca endlich zu lesen. Der ein oder andere Roman von Jane Austen könnte auch wieder dabei sein.
Matthias: Wie gesagt, ich bin immer noch an den Jahrestagen dran.
17. Wird es Print 2020 noch geben?
Tilman: Klar, Promis erscheinen nicht als ebook!
Katharina: Print lebt ewig weiter, wird aber eben zunehmend ein Liebhaber-Ding und verliert weiter an Einfluss. Stand neulich in einem Glückskeks (auch Print).
Simon: Solange Richard David Precht vor Regalen posieren will, wird es gedruckte Bücher geben.
Samuel: Na ja.
Berit: Spannender ist doch die Frage, ob es 2020 in Flaschen abgefüllten Buchseitengeruch und Bücher auf Esspapier geben wird!?
Elif: Solange es Bookstagram und Booktube gibt, wird Print leben. Was soll man sonst fotografieren und in die Kamera halten? E-Reader sehen nicht hübsch genug aus.
Matthias: Natürlich.
18. Welches ist dein liebster Knallkörper?
Tilman: Ich halte es da wie mit Kfz – Hauptsache schön laut!
Katharina: Seit ich sehr alt bin, also seit 2012, schätze ich es nicht mehr so, wenn es knallt und kracht. Da fällt mir ein, man hätte hier einen Wortwitz mit “Kracht” unterbringen können. Zu spät.
Berit: In Island gibt es so winzige Militärfahrzeuge/Panzer mit Böllerantrieb, die eine kurze Strecke fahren und dabei Funken sprühen. Daraus haben wir einmal eine sehr lange Reihe gebaut, dann den ersten angezündet und die Kettenreaktion beobachtet. Es war großartig!
Matthias: Als möglicherweise deutschester Mensch der Welt und allgemeiner Normcore-Typ bin ich tatsächlich ganz angetan von diesen großen Pappkisten, die man hinstellt, an einer Seite anzündet und die dann den Rest von alleine machen. Aber immer nur auf eine waagerechte Oberfläche, Kinder.
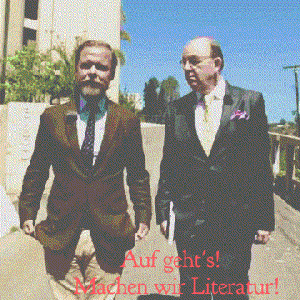







 n Schädel verpasst, wirft die Gewalt, die Physis, die es enthält schmerzhaft körperlich auf die Leserin zurück. Ein solches Buch scheint sein lesendes Gegenüber zum Kampf zu fordern und meint damit nicht ein ehrenvolles und regelngeleitetes Duell, sondern ein Kampf mit Beißen, Hauen und Stechen. So wie Ally Kleins Debütroman Carter (Droschl 2018). Wer gesehen hat, wie sich die Autorin während
n Schädel verpasst, wirft die Gewalt, die Physis, die es enthält schmerzhaft körperlich auf die Leserin zurück. Ein solches Buch scheint sein lesendes Gegenüber zum Kampf zu fordern und meint damit nicht ein ehrenvolles und regelngeleitetes Duell, sondern ein Kampf mit Beißen, Hauen und Stechen. So wie Ally Kleins Debütroman Carter (Droschl 2018). Wer gesehen hat, wie sich die Autorin während 


 Vor diesem Hintergrund wirkt nicht nur der gegenwärtig unter Konservativen beliebte Begriff der „jüdisch-christlichen Leitkultur“ zynisch, sondern auch die Annahme, man müsste sich 2018 noch intensiv mit rechtem Gedankengut auseinandersetzen, um diesem angemessen zu
Vor diesem Hintergrund wirkt nicht nur der gegenwärtig unter Konservativen beliebte Begriff der „jüdisch-christlichen Leitkultur“ zynisch, sondern auch die Annahme, man müsste sich 2018 noch intensiv mit rechtem Gedankengut auseinandersetzen, um diesem angemessen zu  Allerdings hat die überraschend hitzige Debatte um Stokowskis Entscheidung die Unverwüstlichkeit der irrigen Annahme, es entspräche demokratischen Werten,
Allerdings hat die überraschend hitzige Debatte um Stokowskis Entscheidung die Unverwüstlichkeit der irrigen Annahme, es entspräche demokratischen Werten,  Differenz gehört also tatsächlich zum Pluralismus dazu, aber es ist kein Verbleiben in der Echokammer, wenn man daran erinnert, dass selbst in einer pluralistischen Demokratie Meinungen und Aussagen nicht tolerierbar sind, die die tatsächliche Differenz einer Gesellschaft zum Feind erklärt haben. Man kann niemandem seinen Dünkel und seine Vorurteile verbieten, aber man muss sie auch nicht zur validen Diskussionsgrundlage erklären. Es gibt einen Unterschied, ob man “Deutschland wird von einer Umvolkung bedroht” oder “Wie können wir mit dem Zuwachs migrantischer Mitbürger*innen angemessen umgehen” sagt und diskutiert. Das wissen wir, es ist bloß die Länge eines ungemordeten Menschenlebens her, dass dieses Land die Missachtung dieses Unterschieds in all seiner mörderischen Brutalität zu verantworten hatte.
Differenz gehört also tatsächlich zum Pluralismus dazu, aber es ist kein Verbleiben in der Echokammer, wenn man daran erinnert, dass selbst in einer pluralistischen Demokratie Meinungen und Aussagen nicht tolerierbar sind, die die tatsächliche Differenz einer Gesellschaft zum Feind erklärt haben. Man kann niemandem seinen Dünkel und seine Vorurteile verbieten, aber man muss sie auch nicht zur validen Diskussionsgrundlage erklären. Es gibt einen Unterschied, ob man “Deutschland wird von einer Umvolkung bedroht” oder “Wie können wir mit dem Zuwachs migrantischer Mitbürger*innen angemessen umgehen” sagt und diskutiert. Das wissen wir, es ist bloß die Länge eines ungemordeten Menschenlebens her, dass dieses Land die Missachtung dieses Unterschieds in all seiner mörderischen Brutalität zu verantworten hatte.  Die Frage, wie das möglich ist, greift die Politikwissenschaftlerin
Die Frage, wie das möglich ist, greift die Politikwissenschaftlerin  Natürlich steht das soziale Zusammenleben immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zu abstrakten Prinzipien. Doch nur ein politisches Einzelkind würde „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ mit Harmonie verwechseln. Welche freien und gleichen Geschwister streiten sich nicht? Wir brauchen keine Harmonie, sondern vor allem Respekt. Wer den Respekt und die Achtung vor der Würde aller Menschen verweigert, sollte stärker sanktioniert und ausgegrenzt werden. Man kann auch ohne eine direkte Auseinandersetzung erfolgreich widersprechen, nämlich indem man so wie Margarete Stokowski selbstbewusst und konsequent für das eintritt, woran man glaubt. Die Debatte mit rechts zur wichtigen demokratischen Aufgabe zu erklären und dabei die Bedenken und Anliegen kleinerer oder schwächerer Gruppen auf später zu verschieben, wenn die gute Zeit ohne Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und andere Formen der Diskriminierung anbricht, ist illusorisch, weil wir schlicht anerkennen müssen, dass all dies eben keine Abweichung und Ausnahme ist. Es geht nicht darum, dass eine fiktive Mitte sich wohl fühlt, sondern möglichst alle Gesellschaftsmitglieder. Das Selbstverständnis einer genuin pluralistischen Gemeinschaft darf also nicht nur davon geprägt sein, wie sich die Mehrheit sieht und was sie möchte. Eine Lehre aus der deutschen Geschichte, die immer wieder formuliert wird, ist doch gerade, dass sich vor allem im Umgang mit Minderheiten zeigt, wie gerecht eine Gesellschaft ist. Das demokratische Wir muss immer wieder neu verhandelt werden, um konstruktiv zu sein. Max Czollek lässt das in seinem vielgelobten Buch
Natürlich steht das soziale Zusammenleben immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zu abstrakten Prinzipien. Doch nur ein politisches Einzelkind würde „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ mit Harmonie verwechseln. Welche freien und gleichen Geschwister streiten sich nicht? Wir brauchen keine Harmonie, sondern vor allem Respekt. Wer den Respekt und die Achtung vor der Würde aller Menschen verweigert, sollte stärker sanktioniert und ausgegrenzt werden. Man kann auch ohne eine direkte Auseinandersetzung erfolgreich widersprechen, nämlich indem man so wie Margarete Stokowski selbstbewusst und konsequent für das eintritt, woran man glaubt. Die Debatte mit rechts zur wichtigen demokratischen Aufgabe zu erklären und dabei die Bedenken und Anliegen kleinerer oder schwächerer Gruppen auf später zu verschieben, wenn die gute Zeit ohne Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und andere Formen der Diskriminierung anbricht, ist illusorisch, weil wir schlicht anerkennen müssen, dass all dies eben keine Abweichung und Ausnahme ist. Es geht nicht darum, dass eine fiktive Mitte sich wohl fühlt, sondern möglichst alle Gesellschaftsmitglieder. Das Selbstverständnis einer genuin pluralistischen Gemeinschaft darf also nicht nur davon geprägt sein, wie sich die Mehrheit sieht und was sie möchte. Eine Lehre aus der deutschen Geschichte, die immer wieder formuliert wird, ist doch gerade, dass sich vor allem im Umgang mit Minderheiten zeigt, wie gerecht eine Gesellschaft ist. Das demokratische Wir muss immer wieder neu verhandelt werden, um konstruktiv zu sein. Max Czollek lässt das in seinem vielgelobten Buch 


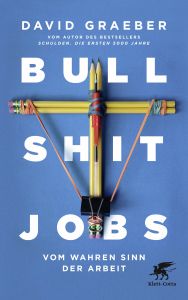 Die fünf Grundtypen von Bullshitjobs erkennt Graeber dabei in den Lakaien, den Schlägern, den Flickschustern, den Kästchenankreuzern und den Aufgabenverteilern. Der Lakai ist nur dafür da die Arbeit derer zu erledigen, die sich den Lakai halten, weil sie es eben können. Streng gesehen ist also nicht der Job des Lakaien Bullshit, sondern der des Chefs. Schläger sind Menschen, deren Tätigkeit ein aggressives Element beinhaltet, die aber – und das ist entscheidend – nur deshalb existieren, weil andere Menschen sie anstellen. Paradebeispiel wären Streitkräfte, die nur deshalb notwendig sind, weil andere Länder ebenfalls Streitkräfte haben. In diese Kategorien fallen für Graeber die meisten Lobbyisten, PR-Spezialisten, Telefonwerber und Unternehmensanwälte. Der Flickschuster wiederum ist nur dafür da Probleme zu lösen, die es eigentlich nicht geben sollte, insbesondere die Fehler auszubessern, die Vorgesetzte verursacht haben. Kästchenankreuzer sind Angestellte, die einem Unternehmen dabei helfen so zu tun als würden sie Dinge tun. Klassisches Beispiel ist die Erledigung von Bürokratie um ihrer selbst willen. Zuletzt der Aufgabenverteiler, der lediglich Arbeit an andere verteilt, er ist das Gegenteil von einem Lakaien, er ist kein unnötiger Untergebener, sondern ein unnötiger Vorgesetzter.
Die fünf Grundtypen von Bullshitjobs erkennt Graeber dabei in den Lakaien, den Schlägern, den Flickschustern, den Kästchenankreuzern und den Aufgabenverteilern. Der Lakai ist nur dafür da die Arbeit derer zu erledigen, die sich den Lakai halten, weil sie es eben können. Streng gesehen ist also nicht der Job des Lakaien Bullshit, sondern der des Chefs. Schläger sind Menschen, deren Tätigkeit ein aggressives Element beinhaltet, die aber – und das ist entscheidend – nur deshalb existieren, weil andere Menschen sie anstellen. Paradebeispiel wären Streitkräfte, die nur deshalb notwendig sind, weil andere Länder ebenfalls Streitkräfte haben. In diese Kategorien fallen für Graeber die meisten Lobbyisten, PR-Spezialisten, Telefonwerber und Unternehmensanwälte. Der Flickschuster wiederum ist nur dafür da Probleme zu lösen, die es eigentlich nicht geben sollte, insbesondere die Fehler auszubessern, die Vorgesetzte verursacht haben. Kästchenankreuzer sind Angestellte, die einem Unternehmen dabei helfen so zu tun als würden sie Dinge tun. Klassisches Beispiel ist die Erledigung von Bürokratie um ihrer selbst willen. Zuletzt der Aufgabenverteiler, der lediglich Arbeit an andere verteilt, er ist das Gegenteil von einem Lakaien, er ist kein unnötiger Untergebener, sondern ein unnötiger Vorgesetzter. Bullshitjobs‘ bester Freund ist die Digitalisierung. Das führt zu weiteren Problemen, denn bisher ist unsere Gesellschaft so zugeschnitten, dass nur Geld bekommt, wer dafür arbeitet. Für viele Tätigkeiten ist heute aber kein trotteliger Mensch von Nöten, sondern das kann wunderbar ein Maschinchen erledigen. Ohne das Geld aus seinem (Bullshit-)Job kann aber das Konsument nicht konsumieren und dem Unternehmer mit seinen Maschinen dessen Produkte abkaufen.
Bullshitjobs‘ bester Freund ist die Digitalisierung. Das führt zu weiteren Problemen, denn bisher ist unsere Gesellschaft so zugeschnitten, dass nur Geld bekommt, wer dafür arbeitet. Für viele Tätigkeiten ist heute aber kein trotteliger Mensch von Nöten, sondern das kann wunderbar ein Maschinchen erledigen. Ohne das Geld aus seinem (Bullshit-)Job kann aber das Konsument nicht konsumieren und dem Unternehmer mit seinen Maschinen dessen Produkte abkaufen.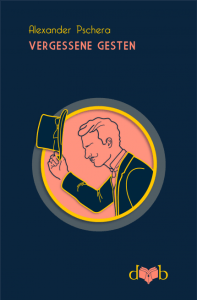 Wundgeschlagen also von der Erkenntnis des bevorstehenden Untergangs unserer Gesellschaft, las ich noch Alexander Pscheras Vergessene Gesten, das im kleinen Wiener Verlag
Wundgeschlagen also von der Erkenntnis des bevorstehenden Untergangs unserer Gesellschaft, las ich noch Alexander Pscheras Vergessene Gesten, das im kleinen Wiener Verlag 
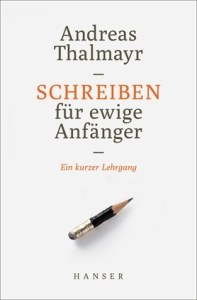 Umso erstaunlicher ist daher die Veröffentlichung eines Buches namens Schreiben für ewige Anfänger: ein kurzer Lehrgang in eben diesem Hanser Verlag. Dieser schmale Band für 16 Euro enthält über zwanzig Briefe eines alten Schriftstellers an einen (fiktiven?) jungen Kollegen. Wer nun aber Schreibtipps erwartete, wird schnell enttäuscht. Hier wird plauderig-onkelhaft erzählt, wie ein Buch „im Betrieb“ entsteht. Das ist auf so unbeholfene Art und Weise langweilig und bemüht, dass man zwangsläufig die Frage auftaucht, warum genau man ein solches Buch veröffentlichen sollte. Beim besten Willen fällt mir kein einziger Mensch ein, dem dieses Buch von Nutzen sein könnte.
Umso erstaunlicher ist daher die Veröffentlichung eines Buches namens Schreiben für ewige Anfänger: ein kurzer Lehrgang in eben diesem Hanser Verlag. Dieser schmale Band für 16 Euro enthält über zwanzig Briefe eines alten Schriftstellers an einen (fiktiven?) jungen Kollegen. Wer nun aber Schreibtipps erwartete, wird schnell enttäuscht. Hier wird plauderig-onkelhaft erzählt, wie ein Buch „im Betrieb“ entsteht. Das ist auf so unbeholfene Art und Weise langweilig und bemüht, dass man zwangsläufig die Frage auftaucht, warum genau man ein solches Buch veröffentlichen sollte. Beim besten Willen fällt mir kein einziger Mensch ein, dem dieses Buch von Nutzen sein könnte.