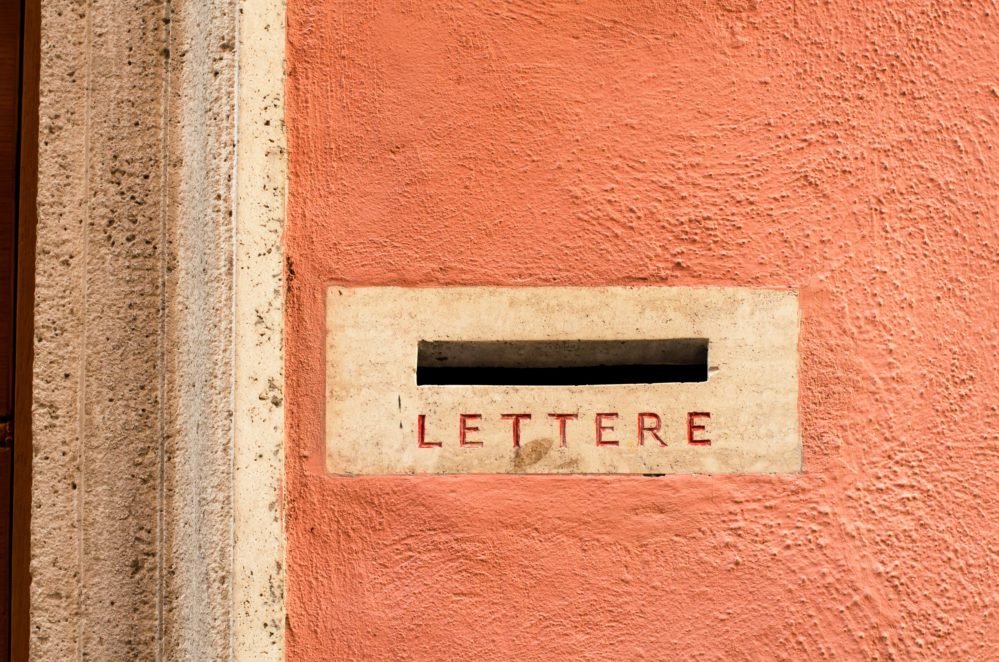Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die xenophobe Massenregression beschädigt wird.
Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung in den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.
Wenn Sie ebenfalls zu der Gemeinsamen Entstörung 2018 als Unterzeichner*in beitragen wollen, bitten wir Sie, Ihren Namen mit sämtlichen Titeln, Positionen, Berufen und etwaig vorhandenen Ehrungen in die Kommentare zu posten. Wir werden Sie mit Freude in die folgende Liste aufnehmen.
Die Unterzeichnenden
Monika Abbas, Bloggerin, Mensch
Sandro Abbate, Arbeiterkind, Kulturwissenschaftler und Inhaltsfabrikant elektronischer Logbücher
Heike Baller, M.A., Recherchemeisterin, Seminarleiterin, Wissensteilerin, Bloggerin, Leserin
Michael Bauer, denkender Mensch und Schreiber, Polarisationsbeobachter und Humanist mit Würde, Rentner mit IT-Hintergrund, 51 Jahre, lebendig
Catherine Beck, Freie Lektorin ohne Blog
Zoë Beck, schriftstellernde, übersetzende und verlegende Feministin
Anette Becker, Diplom-Übersetzerin, Bloggerin
Kai Becker, Theaterpädagoge, Übersetzer und Verfassungspatriot
Ratgar Beckmann, Gatte, Vater, Freund und Kollege, Cosmopolit
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Ina Beintner, Psychologische Psychotherapeutin, Wissenschaftlerin, Autorin, Mutter, linksgrünversifft und meistens gut gelaunt
Sarah Berger, keine richtige Autorin bei Frohmann Verlag, Intellektuelle, Essayistin, Menschin
Dr. Sebastian Berweck, Pianist und sonst auch noch viel
Dr. Mirjam Bitter, Literaturübersetzerin mit Nachwuchspreis, Web-Redakteurin, Literaturwissenschaftlerin mit Kulturwissenschaftspreis, Feministin, Mutter, Morgenmuffel, Liebhaberin von Tanz und Gesang sowie Gelegenheitsbloggerin
Ludger Blanke, Absolvent des Bischöflichen Knabenkonvikts Collegium Johanneum zu Ostbevern und der Deutschen Film- und Fernsehakademie zu Berlin, ehemaliges Mitglied des Personalrats des ZDF-Hauptstadtstudios, Autor, Rechercheur, Bildgestalter, Filmemacher, Fotograf, Dramaturg, allgemeiner Trouble-Shooter und manchmal -Maker
Marlies Blauth, Flüchtlingstochter, Ruhrgebietskind, Synästhetikerin, Bildende Künstlerin und Lyrikerin
Thomas Blum, M.A., Feuilletonredakteur der Tageszeitung neues deutschland, Autor des offiziellen Beitrags der Wochenzeitung Jungle World zum »Mauerlied-Wettbewerb« der Deutschen Burschenschaft (2002) und Experte für Umvolkung
Daniel Bönisch, Geschäftsführer und Gründer der UEBERBIT GmbH
Dr. Marten Brandt
Simone Buchholz, abgebrochenes Philosophiestudium, aber street credibility
Elisabeth Buck, Autorin, Dozentin, Musikpädagogin, Großmutter, Hobbyornithologin
Prof. Frank Bungarten, Musiker, ganz strenger Hochschullehrer, Mann mit einer den Deutschen Volkskörper bedrohenden Ehefrau
Rolf A. Burkart, Künstler, Schriftsteller, Ex-Verleger, Ex-Galerist, drei Mal Zeitschriftenredakteur und Herausgeber, Intensiv-Scheiterer, Psychonaut, vor allem Mensch in allen Kulturen, fürchte das Eigene mehr als das Fremde. Nur die Nächsten könnten mir schaden (Einsicht eines Traumatisierten)
Isabella Caldart, Dank Ta-Nehisi Coates, Julia Wolf und dem Feuilleton der SZ die neue Galionsfigur des Widerstands (nur echt mit revolutionärem Gesichtsausdruck und Baskenmütze)
Carlos Cipa, Komponist, Pianist, Produzent, Musiker
Caroline Cleveland, Studentin in Philosophie und Sinologie, Indianerin, Kampfkünstlerin; Schülerin der Dialektik, Mensch mit Behinderung, Empath, Philosophin, Feministin
Kristoffer Cornils, Musikjournalist
Daniela Cox, Mensch, Liebhaber des Guten, Wahren und Schönen
Dipl.-Sozialpäd. (FH) Andrea Daniel, Leserin, Bloggerin, Gern-Reisende
Asal Dardan, Diplom-Kulturwissenschaftlerin und unlustige Twitterin
Julian Denzel, Student
Robin Detje, Integrationsbeauftragter für Literatur aus Fremdkulturen
Prof. Dr. med. Thomas Deufel, Staatssekretär a.D., Arzt und Wissenschaftler, Zuhörer, Leser, Mitstreiter
Thilo Dierkes, Mini- und Midijobber
Elisabeth Dietz; Redakteurin, Succubus
Mareike Dietzel, M.A., deutsche Philologin und Feministin
Stefan Diezmann, Verlagshersteller, Blogger, Musiker
Dipl.-Bibl. (FH) Susanne Dirkwinkel, gebürtige Ostwestfälin, leidenschaftliche Wahlhamburgerin; macht irgendwas mit Seekarten
Dr. phil. Christina Dongowski, Influencerin & Zerspanungskompetenz zertifiziert
Anke Dörsam, Autorin und Dramaturgin
Jan Drees, Redakteur
Erik Drescher, Flötist, Kurator, und vieles mehr, aber noch mehr nix
Robert Dupuis, Anarcho-Zionist, Kosmopolit, Bücherwurm, exzessiver Zeitungsleser
Moritz Eggert, Komponist, Pianist, Sänger, Blogger, Dirigent, Autor, Hochschulprofessor
Tim Eisenlohr, Jugend in der Ostberliner Opposition (Berliner Umweltbibliothek), heute Vorsitzender einer internationalen Flüchtlingshilfsorganisation
Axel von Ernst, Verleger
Davide Casali Eschmann
Samael Falkner, Experte für fein nuancierte Kurztexte zur Publikation in digitalen Medien und althergebrachte Marketingwerkzeuge, gebürtiger Leipziger
Matthias Fiedler, ehem. Jurastudent, Kommunikator, Vater eines lieben kleinen Schlaufuchses und Studienrat für eh alles
Hartmut Finkeldey
Dipl.-Volkswirt Thomas Finn, Werbekaufmann, Schriftsteller, Theater- und Drehbuchautor, Preisträger, Kaufmannssohn, Ältester von vier Geschwistern, Hanseat, Raucher und Döner-Liebhaber
Claus Fischer, Europäer, freier Journalist, Redakteur und Moderator im ARD-Hörfunk aus der weltoffenen Handels- und Musikstadt Leipzig, die auch zu Sachsen gehört
Thomas Fischer, Exil-Dresdner, wasmitbüchern, bei wbv Media, Bielefeld
Uwe Fischer, Mitmenschenarbeitender, Immermalehrenamtler, unversiffter Gutmensch
Jana Franke, Tänzerin, Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin, Autorin, Mutter
Brigitte von Freyberg, M.A., Feministin
Rüdiger von Freyberg – Pandimensionalist, Hausmann, Autor, Progessivträumer und Vorübergänger
Klaus N. Frick, Redakteur (Science Fiction) und Gelegenheitsautor (Fantasy, Punkrock)
Amelie Fried, Autorin und linksgrün versiffte Gutmenschin aus Leidenschaft
Marc-Oliver Frisch, M.A., Elektropopsternchen, Kritiker, Übersetzer und Doktorand der Literaturwissenschaft
Christiane Frohmann, Verlegerin, Autorin und Dozentin für Allgemeine und Vergleichende sowie Angewandte Literaturwissenschaft an der FU Berlin
Dr. Antje Galuschka, Gutmensch (ich glaube an das Gute im Menschen), Alltagsfeministin, engagiert gegen hate speech
Dipl.-Inf. Kai Gärtner, System-Administrator, Flüchtlingshelfer, Philanthrop
Timm Gärtner, Sohn seit den 80ern, davor nicht. Menschenfreund
Moritz Gause, Parkplatzpoet, vordringlich an Brückenbau interessierter Pangaeaner
Prof. Dr. Miriam Gebhardt, Historikerin
Dr.phil. Barbara Geilich, Sin(n)ologin, Ohrenzeugin, Ichoufilia
Andreas Geißler, Mensch & Bibliothekar, bekennender Velosoph und ehrenamtlicher Brei-Tester
Berit Glanz, Binäralchemistin
Jacky Gleich, Illustratorin, Dozentin, Malerin, Menschin, Mutter
Tanja Gottlewski, IT System-Kauffrau, Fotofuzzi, Wolkenkratzer- und Bloggerin
Svenja Gräfen, Autorin und Feministin from the bottom of her heart
Bärbel Greiler-Unrath, Menschin, Mangerin eines Familienunternehmens, Mama, Adoptivmama, Göttergattin, Katzendompteuse, Hundeversteherin, Diakonin, Vesperkirchenmama, Gemeindeseelsorgerin, Erzieherin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Prozessbegleiterin für Inklusion, Dipl.-Optimistin und Lebenskünstlerin
David Gray alias Ulf Torreck, Raucher, Romancier, Filmfan, Ex-Punker, Ex-Kleinstadtbewohner, Angehöriger verschiedener Subkulturen, Büchersammler, Gassigeher bei Utopia (Windhündin), regelmäßiger Empfänger rechtsextremer Drohmessages, Kaffeetrinker, Vorleser, Entertainer und Veranstalter von Krimilesungen
Judith Greiß, Diplom-Sozialpädagogin, Therapeutin, Dozentin, Ehefrau, Freundin, Lernende
Dipl.-Phys. Jan Groh, seine Ego ebenfalls gerne grandiosidierender schriftstellernder Medizinjournalist und Träger des einzigen jemals verliehenen Alfred-Döblin-Werkstattpreises der Akademie der Künste und des Literarischen Colloquiums, hundeführender Kleingrundbesitzer in Brandenburg
lic. phil. Remo Grolimund, Historiker & Qualitätstroll
Dincer Gücyeter, Verleger
Madeleine Gullert, Redakteurin
Negin Habibi, Gitarristin, Instrumentalpädagogin, potentielle Deutschlandbeschädigerin
Dr. Hans-Martin Gutsch, Träger des goldenen deutschen Tanzabzeichens, Sportbootführerschein (Binnen)
Ariane Gramelspacher, Fotografin und Medienwissenschaftlerin, Deutsch-Haitianerin, Hamburg
Ingrid Haag, Autorin, Lektorin, Redakteurin, Diplom-Kauffrau
Kat Hacheney Cat Wrestler, Economic Migrant, and Writer
Martin Haldenmair, M.A., Journalist
Jeannette Hagen, Autorin, Coach, Humanistin
Elisabeth R. Hager, Autorin
Komponistin, Vorstand MOGiS e.V. – eine Stimme für Betroffene
Samuel Hamen, Head of Fiction
Thomas Hanke, Linguist, Lektor, Springer-Diplom (von keinem der Verlage)
Heiko Hauenstein, Softwareentwicklung, Grafik & E-Learning
David Häußer, Musiker und Herausgeber des FICKO-Magazins für gute Sachen und gegen schlechte
Kilian Hecker, Schriftstellerdarsteller, akademischer Abschuss
Karl-Heinz Heihse, linksgrüner Biergartenphilosoph und Bahnhofsklatscher
Katharina Herrmann, akademischer Mittelbau
Katharina Hierling, Lektorin
Herbert Hindringer, Autor
Mathias Hofter, München, Geisteswissenschaftler und Zugroaster
Andreas Homann, Designer, Hamburg
Dr. Martin Hufner, Musikjournalist
Norbert Hupbach, linksgrüner Buchhändler aus Dresden
Evelyn Javadi, intellektuelle Arbeitsberaterin
Sarah Elise Bischof Jørgensen, M.A., Runologin, Schabrackentapir-Zoologin & legitime Thronfolgerin von Harald Blauzahn
Uwe Kalkowski, Kaffeehaussitzer
Christoph Kappes, Unterschrei_Bär
Andrea Karimé, Schriftstellerin, Sprachensammlerin und – erfinderin, Lehrerin, Tier-, Kinder- und Menschenfreundin, Wolkenkratzerin, Geschichtenerzählerin
Jenny Keck, Leserin
Florian Kessler, Lektor
Alexander Keuk, Komponist, Musikjournalist, Autor
Jochen Kienbaum, Journalist, Blogger und Widerborst
Dr. Juan Martin Koch, Chefredakteur neue musikzeitung
Sandra Klöss, linksgrün-versiffte Theaterschaffende für von den Systemparteien geförderte radikalfeministische-queere-multikulti-mixedabled- Projekte ohne Heimatbezug, ehrenamtliche Deutschlandhasserin, Antifa Supporterin seit 1993, Lesbe, M.A. in Theaterwissenschaft / Kulturelle Kommunikation und Anglistik / Amerikanistik, Freischwimmer Bronze und Ehrenstandartenträgerin bei Fähnlein Fieselschweif
Ulrich Kreppein, Komponist, Hochschullehrer, Gutmensch, Mitmensch, Zuhörer, Leser und noch dies und das
Jennifer Kroll, Verlegerin
Dipl.-Med. Anne Kuhlmeyer, Anästhesistin, Psychotherapeutin, Schriftstellerin, Feministin, Jüdin, Mutter
Dipl.-Ing. Kerstin Kuhnekath, Autorin, Hörspiel-Macherin, Architektin
Anette Lang-Coiro, Mutter
Stefanie Leo, Kinderbuchmensch
Sofie Lichtenstein, Autorin und Herausgeberin
Christian Linker (“Nomen est Omen”, lt. “AfD Sachsen aktuell Nr.32/2017); Autor
Arne List, Kampfbund für den Wiederaufbau der APPD
Richard Lorenz, Schriftsteller
Daniel Lücking, (studierter) Online- und Kulturjournalist
Prof. Dr. Mira Mann
Martin Manthe, Dresdner
Grit Maroske, Menschin, Antifaschistin, sächsische Überlebenskünstlerin und Autorin
Frank J. Martens, Ev. Pfarrer, Läufer, kaffeeverliebt, Schulmensch und Seelenfritze
Dorothea Martin, Geschichten & Das wilde Dutzend
Kristina Massel, Rechtsanwältin, geflüchtete Ostdeutsche, Kunstturnerin a.D.
Karl Ludger Menke, Leser
Miriam Michel, Künstlerin und Performerin, Achtsamkeits-Avantgarde
Stefan Möller, Texter, Aufsichtsratsmitglied der Nordstadt braut! eG, zweifacher Zoff-im-Zoo-Nordstadt-open-Sieger
Tine Mothes, geb. Blümenkohl, diesdas, jenes, seit 1984
Katharina S. Müller, Komponistin und Geigerin
Dipl.-Bibliothekar Marius Müller, Faschingsprinz a.D.
Michaela Maria Müller, Autorin und Journalistin
Tina Müller, Mensch, Sozialarbeiterin
Wolfgang Müller, Dipl. Ing. (arch.), Ruinenbauer und -bewohner alias Wolfgang Müller-Hinterhaus, Verfasser eines geheimen Romans über ein seltsames Land mit seltsamen Bewohnern,…
Tabea Naumann, Flüchtlingskind (DDR), Pfarrtochter, Geisteswissenschaftlerin, Feministin und DaZ-Lehrerin, was mit Marketing
Anselm Neft, staatsfinanzierte Antifa
Fabian Neidhardt, Straßenpoet (M.A.), Sprecher (B.A.) & Botschafter des Lächelns
Nicole Neubauer, Schriftstellerin und Rechtsanwältin
Dr. Peter Neumann, Schriftsteller und Philosoph
Susanne Nietzsche, Krankenschwester, Ehefrau, Mutter, gebranntes DDR-Kind, deshalb dankbare, jedoch nicht kritiklose Bundesbürgerin, Sonnenanbeterin, Gutmensch(in)
Rudi Nuss, Autor
Gérard Otremba, Journalist
Thomas Ott, Buchhändler, verzauberter Homosexualist, nichtreligiöser Arm-Bürger, Kopfbahnhof-Befürworter und nicht-rechtsversiffter Deutscher
Markus Ostermair, Sohn aus kleinbäuerlichem Hause, Abiturient auf dem zweiten Bildungsweg, Germanist, Anglist, freier Autor, Übersetzer
Peter Perner, Mensch und Volkswirt im Ruhestand
Dipl.-Soz. Jörg Peter, stellv. Schulleiter, Autor, Mitglied im Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen e. V.
Prof. Dr. Dirk Pilz, UdK Berlin
Dr. Oliver Plaschka, Doktor von was mit Büchern, Autor mit Preisen
Heike Pohl, Freie Journalistin, Fotografin, Bloggerin, Ehrenamtlerin, Flüchtlingshelferin und Menschenfreundin
Chris Popp, Onlineredakteur, Biolebensmitteldealer, Buch-, Musik- und Seriennerd, Mensch, Erdling
Dr. Thomas Poser, Literaturwissenschaftler
Dr. Patrice G. Poutrus, Zeithistoriker, ziemlich bemühter, aber mäßig erfolgreicher Gutmensch mit Migrationshintern.
Manja Präkels, preisboxende Vorleserin mit Hang zur Analogsynthese/Antifa-Agentin
Christiane Quincke, Theologin, Bloggerin, Preisträgerin, Gutmenschin, Kaffeetrinkerin, Nichtraucherin, Worteliebhaberin
Dr. Daniel Hans Rapoport, Spross einer jüdischen Wissenschaftlerdynastie, Diplooom-Chemiker, Mikroskopentwickler, Zelltechnologie, Essayist, Bloggerin
Bernhard Rasche, Theologe, Rhöner
Holger Reichard, Buchautor und Blogger
J. Marc Reichow, Musiker
Dr. Kirsten Reimers, freie Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin
Marc Richter, Vollzeitingenieur und Teilzeitblogger
Nikola Richter, “Digital”-Verlegerin
Janine Rumrich, Betriebswirtin, Stipendiatin und Buchbloggerin
Veronika Rusch, Schriftstellerin, Juristin, Gutmensch, denkendes Wesen
Dr. Mithu Melanie Sanyal, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin
Dr. Hanno Sauer, Philosoph
Lea Sauer, Autorin
Margarete Sautter, Rentnerin Jahrgang 1938, Augenzeugin der Verbrechen, Verfassungspatriotin
Michael Scheiner, Spessarträuber, Pressesprecher, Journalist, Redakteur, Amateurfotograf, Gernesser, wackeliger Skifahrer (selten), gutgläubiger Feminist, scheinheiliger Gutmensch, einstiger Sozi-Al-Pädagoge, Schönheits-Sehnsüchtler
Edgar Schuster, Bücherdealer
Antje Schwarz – schreibt, lacht, redet, steitet – Gattung Mensch
Uwe Sinha, Indogermane, Informatiker, Südberliner, Vater
Luise Schitteck, (Zwischen-)Buchhändlerin, Studienabbrecherin, Tochter eines brandenburgischen Wirtschaftsflüchtlings
Udo Schewietzek
Niklas Schleicher, Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Systematische Theologie und Ethik)
RA Heinrich Schmitz, Strafverteidiger, Kolumnist
Sigune Schnabel, Lyrikerin und studierte Literaturübersetzerin
Dipl.-Ing. Christian Schneider, Übersetzer
Stefan Schneider, Mensch, Diakon, Klangdialogiker, Gold-im-Gegenüber-Sucher, Hoffnungsvoller
Jan Schönherr, Übersetzer
Dr. Dietrich Schotte, Philosoph
Marie-Luise Schrader, unabhängige Literaturattachée
Jasmin Schreiber, Biologin, Journalistin und Autorin
Bob Schroeder, Witze
Christian Schruff, Radiojournalist für ARD-Anstalten, leidenschaftlicher Musikvermittler
Prof. Dr. Holger Schulze, Kulturwissenschaftler
Katrin Schuster, Redakteurin, Möglichst-bald-wieder-Bloggerin
Leonhard F. Seidl, schriftstellernde, aktivistische Bratkartoffel mit getöteten Tomaten und linksdrehenden Gutmenschkulturen mit Stachelbeeren
Gianna Slomka, Magistra Artium der Amerikanistik, Romanistik und Buchwissenschaft, Lektorin
Marcus Smolarek, Küchensystemtheoretiker
Dr. Enno Stahl, Autor, Literaturwissenschaftler
Daniel Stähr, M.Sc., Doktorand der Ökonomie
Birgit Steffen, contentpoetin, Mutter, Aktivistin im Asozialen Netzwerk, Panentheistin, Mitglied der Asylindustrie a.D.
Tom Steinert, hauptberuflich Lebenskünstler, Vater und ehrenamtlicher Gratwanderer
Katja Stögmüller, Kleinbürgerliche auf künstlerischen Abwegen, linksgrünversiffter Gutmensch, Anhängerin unserer Grundwerte
Stefan Stögmüller, Long Distance Runner
Daniel Stolba, Satireautor, Werber, Buchtrailerproduzent, Führerschein Klasse 3
Wolke Strahl, M.Eng., Umweltschutz, Menschenrechtsfanatikerin, Verfassungspatriotin
Alexander Strauch, Komponist, Festivalmacher, Blogger, Super-Gutmensch, Münchner Kindl
Michael Strobel, macht was mit Büchern
Leander Sukov, Schriftsteller, Redakteur, Chefbandit bei Kunstbande GbR
Sophie Sumburane, Autorin und Aktivistin
Dr. Thomas Thielen, Komparatist, Linguist, Dialektiker, Didaktiker, Pädagoge, Musiker (t)
Florian Tietgen, Schriftsteller, Lektor
Saskia Trebing, professionelle Briefeschreiberin
Dana Tretter, Übersetzerin, Kulturschaffende, Mutti, desorientierte Hobbyfeministin, angepasste möchtegern Altpunkerin
Sabine Unger, Mensch, Sonnen-Liebhaberin, Baustellenarbeiterin, Köchin bei „Kochen für Weltbürger“, Johannisbeersaftliebhaberin, Gestalterin, Baustellenarbeiterin, Künstlerin
Dipl.-Wirt.-Ing. Henri Vogel, Germanist, Theologe, Schreiberling
Dr. Steffen Voss, linksgrünversiffter Homolobbyist
Silvia Walter, Mutter, Bloggerin, Mensch
Dr. Matthias Warkus, Philosoph
Sophie Weigand, Professional Reading Artist
Hannah Weiland, Psychologiestudentin im Endstadium, hoffentlich bald Forscherin
Klaus-Dieter Welker, Ex-Heimkind, Ex-Sozialarbeiter, ehrenamtlicher “Friedhofswärter”, Mensch und Vater
Kathrin Weßling, Kathrin Weßling
Tilman Winterling, Rechtsanwalt
Julia Wolf, Autorin
Martina Wunderer, Lektorin
Thore Würger, Boss
Dipl.-Psych. Christine Wunnicke, M.A., Schriftstellerin, Übersetzerin, Teilzeit-Fachfrau für altjapanische Waffentechniken




 Es handelt sich in der Tat wieder einmal (wie bei
Es handelt sich in der Tat wieder einmal (wie bei 
 Bajohrs Band ist ganz im Einklang mit der digitalen Poetik, die Kenneth Goldsmith in
Bajohrs Band ist ganz im Einklang mit der digitalen Poetik, die Kenneth Goldsmith in  „Für das SZ-Magazin fertigte Joachim Kaiser gern kunstvolle Interviews aus den Sätzen verstorbener Größen.“
„Für das SZ-Magazin fertigte Joachim Kaiser gern kunstvolle Interviews aus den Sätzen verstorbener Größen.“




 So funktioniert über weite Strecken das ganze Werk: Es nimmt sich irgendwelche Phänomene her (entweder per Anekdote oder durch bloße Behauptung), entledigt sie jedes prüfbaren Kontexts, der irgendwie Informationen dazu liefern könnte, wie groß oder klein ihre tatsächliche Bedeutung ist, und reiht sie in eine Erzählung ein, die längst geschrieben ist. Diese Erzählung lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Die USA betreiben seit Langem erfolgreich eine auf Verarmung der Menschheit und Verwüstung der Erde zugunsten des Einflusses einer winzigen, mächtigen Elite gerichtete neokoloniale Politik. Flankiert wird dieser Feldzug durch identitätspolitische Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Menschen infantil, dumm, empfindlich, narzisstisch und sich untereinander spinnefeind werden, sodass sie keinen Widerstand leisten. (Es sind in der Tat »die Behörden der USA«, die weltweit für antirassistisches Gedankengut oder Empfindlichkeit für weiße Privilegien verantwortlich sind, weil die USA die Welt »mit Dekolonialisierung […] kolonialisieren«; 38f.) Alles in allem war alles noch nie so schlimm wie heute und alles wird immer schlimmer (16 ff.). Es handelt sich wirklich um ein ganz altmodisches, klassisch antiamerikanisches Buch. Man fühlt sich bei der Lektüre immer wieder mitten in die Nullerjahre zurückversetzt. Dass so etwas wie der Krieg in Syrien möglicherweise nicht allein auf amerikanischem Mist gewachsen sein könnte, wird nirgendwo auch nur in Erwägung gezogen. Ein irgendwie empirisch gestützter diachroner und globaler Blick auf Phänomene wie Armut, Ungleichheit, Krankheit und Krieg, der das ausgebreitete Höllenpanorama relativieren könnte, geschieht schlicht nicht. Das Buch ist ein Buch für heterosexuelle weiße Europäer, da mache man sich nichts vor.
So funktioniert über weite Strecken das ganze Werk: Es nimmt sich irgendwelche Phänomene her (entweder per Anekdote oder durch bloße Behauptung), entledigt sie jedes prüfbaren Kontexts, der irgendwie Informationen dazu liefern könnte, wie groß oder klein ihre tatsächliche Bedeutung ist, und reiht sie in eine Erzählung ein, die längst geschrieben ist. Diese Erzählung lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Die USA betreiben seit Langem erfolgreich eine auf Verarmung der Menschheit und Verwüstung der Erde zugunsten des Einflusses einer winzigen, mächtigen Elite gerichtete neokoloniale Politik. Flankiert wird dieser Feldzug durch identitätspolitische Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Menschen infantil, dumm, empfindlich, narzisstisch und sich untereinander spinnefeind werden, sodass sie keinen Widerstand leisten. (Es sind in der Tat »die Behörden der USA«, die weltweit für antirassistisches Gedankengut oder Empfindlichkeit für weiße Privilegien verantwortlich sind, weil die USA die Welt »mit Dekolonialisierung […] kolonialisieren«; 38f.) Alles in allem war alles noch nie so schlimm wie heute und alles wird immer schlimmer (16 ff.). Es handelt sich wirklich um ein ganz altmodisches, klassisch antiamerikanisches Buch. Man fühlt sich bei der Lektüre immer wieder mitten in die Nullerjahre zurückversetzt. Dass so etwas wie der Krieg in Syrien möglicherweise nicht allein auf amerikanischem Mist gewachsen sein könnte, wird nirgendwo auch nur in Erwägung gezogen. Ein irgendwie empirisch gestützter diachroner und globaler Blick auf Phänomene wie Armut, Ungleichheit, Krankheit und Krieg, der das ausgebreitete Höllenpanorama relativieren könnte, geschieht schlicht nicht. Das Buch ist ein Buch für heterosexuelle weiße Europäer, da mache man sich nichts vor.