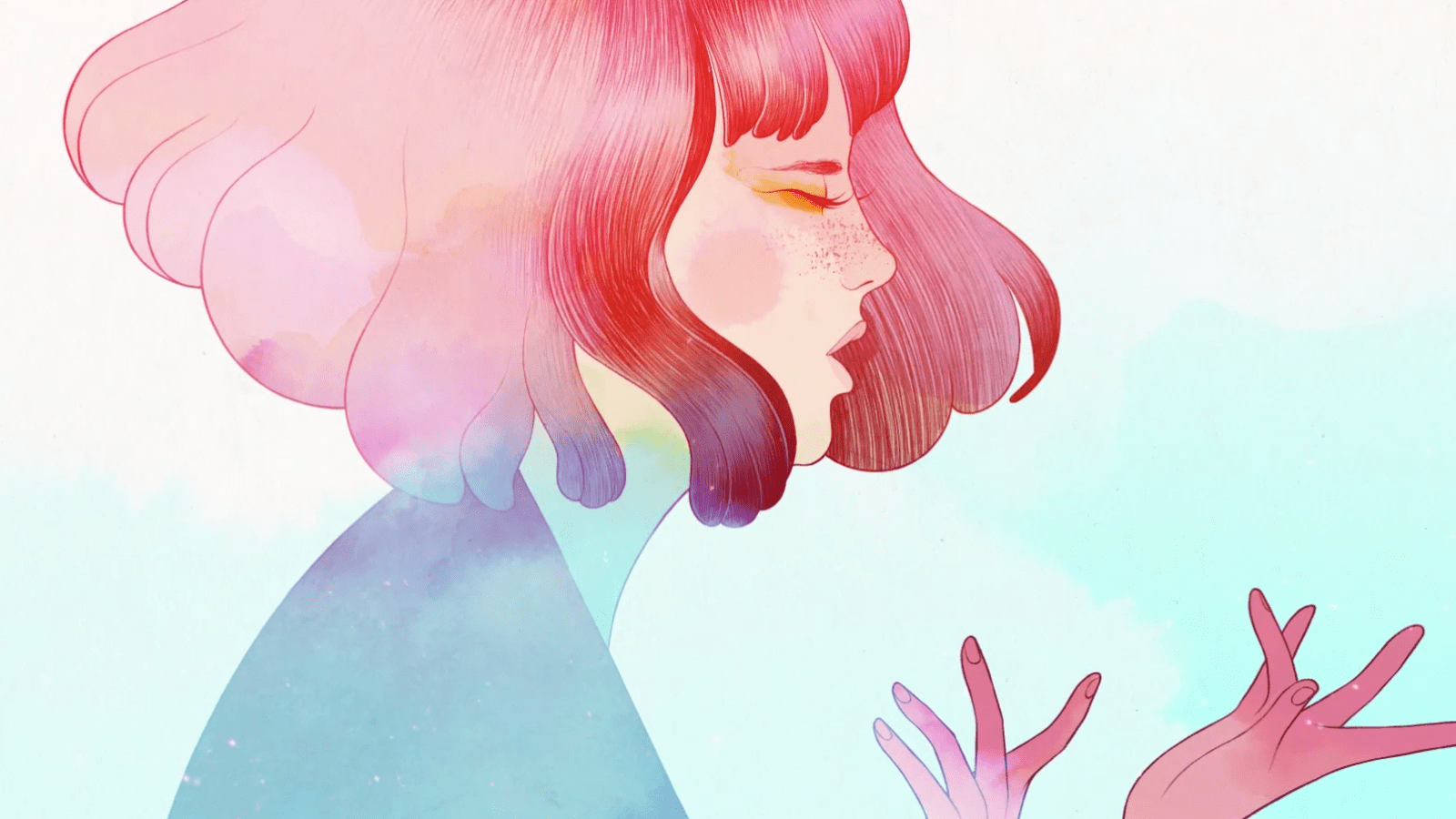Neue Kolumne: Queering Literaturbetrieb
In den letzten Jahren ist ein Trend queerer Literatur auszumachen, in Übersetzung feiern Autor*innen wie Ocean Vuong, Maggie Nelson oder Edouard Louis große Erfolge. Dennoch haben queere Autor*innen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, aber auch im Literaturbetrieb, immer noch zu wenig Präsenz und Mitspracherecht. Diskriminierung, Sexismus, LGBTIQ+-Feindlichkeiten und Ignoranz gehören leider weiterhin zum Alltag. Die neue Kolumne Queering Literaturbetrieb widmet sich in kurzen Essays den Dissonanzen zwischen Literaturproduktion und Verlagswesen. Sie fragt nach dringlichen Themen und Diskursen innerhalb der Gruppe der queeren Schreibenden. Eva Tepest, Katja Anton Cronauer, Kevin Junk und Alexander Graeff haben sich als Autor*innen zusammengeschlossen, um mit dieser neuen Kolumne den aktuellen Wasserstand der queeren, deutschsprachigen Literatur auszuloten. Sie wollen mit ihren Essays individuelle Erfahrungen aus den verschiedenen Berufs- und Lebensrealitäten zusammentragen und zugleich ein größeres Bild von aktuellen Chancen, Ambivalenzen und Missständen aufzeigen.
Eine Kolumne von Katja Anton Cronauer
“Ich würde für andere Menschen gerne irgendwann das Vorbild sein, das ich als Jugendlicher nie hatte,” schreibt Linus Giese in seinem autobiografischen Buch Ich bin Linus: Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war (Rowohlt Taschenbuch, 2020), das im August dieses Jahres erschienen ist und es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Vor allem in dem Kapitel Queere Vorbilder schreibt Giese über die Wichtigkeit von Vorbildern und dass er sich „mehr Filme und Serien mit trans Menschen” wünscht, was sicher auch für Bücher gilt. Er beschreibt, wie befreiend und erleichternd es sein kann, Geschichten von Menschen zu sehen und zu lesen, die sind wie eins selbst. Vorbilder ebnen den Weg, um zu sich stehen zu können und um anderen Menschen zu vermitteln, dass es okay ist, trans oder queer zu sein. In diesem Sinne enthält auch das Buch Queer Heroes (Prestel Junior, 2020) von Arabelle Sicardi 53 inspirierende Kurzporträts queerer Künstler:innen, Schriftsteller:innen, Wissenschaftler:innen, Unternehmer:innen, Sportler:innen und Aktivist:innen, darunter sechs trans Personen.
Sind trans Themen also in der Literatur angekommen? Haben wir ausreichend Repräsentation dieser Bevölkerungsgruppe? Leider nicht. Trans Themen sind eklatant unterrepräsentiert. Mit der Qualität steht es auch nicht zum Besten. Was Intergeschlechtlichkeit und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten angeht, sieht es sogar noch schlechter aus (Queer Heroes ist, was die Darstellung von inter und nicht-binären Menschen betrifft, exemplarisch: Es enthält nur ein Porträt einer intergeschlechtlichen und keine Porträts von nicht-binären Personen.). Woran liegt das? Doch zunächst einmal:
Wieviele Bücher zum Thema gibt es?
Dieses Jahr werden laut buchhandel.de insgesamt 153265 [1] Titel (Bücher und e-Books – alle Zahlen vom 13.09.2020) veröffentlicht. Eine Stichwortsuche nach den Begriffen transgender, transgeschlechtlich, transsexuell, transident sowie den zugehörigen Substantiven (mit den Suchbegriffen transgender,*, transsexu*, transident* und transgeschl*) liefert lediglich 183 Titel. Das entspricht 0,12% aller in diesem Jahr veröffentlichten Titel. Schätzungen für den Anteil von trans Menschen in der Bevölkerung liegen bei 0,25 bis 0,6%. Damit ist das Thema Trans eindeutig unterrepräsentiert.
Beim Thema Intergeschlechtlichkeit (Stichwortsuche intergeschl* und intersex*) sieht es noch schlechter aus, dazu gibt es sogar nur 31 Titel, was 0,02% entspricht. Laut der Vereinten Nationen und einer Studie von Anne Fausto-Sterling (siehe S. 51 in Sexing the Body) liegt der Anteil an inter Menschen jedoch bei 1,7%. Die Unterrepräsentation in der Literatur ist hier somit noch ausgeprägter als beim Thema Trans.
Wieviele Menschen in Deutschland sich als nicht-binär verorten ist nicht bekannt. Im Rahmen der ZEIT-Vermächtnisstudie 2016 gaben von 3.104 Befragten 3,3% an, „entweder ein anderes Geschlecht zu haben als bei ihrer Geburt zugewiesen oder sich schlicht nicht als weiblich oder männlich zu definieren“. [2] Ohne die Prozentzahlen für inter und trans Personen, bleiben hier noch zwischen 1,00 und 1,35%. Suche ich auf buchhandel.de mit dem Stichwort nicht-binär, erhalte ich zwei Treffer, von denen sich ein Buch jedoch dem Thema Inter widmet und bei dem anderen unklar ist, ob es tatsächlich um nicht-binäre Geschlechtsidentität geht. Die von Eliah Lüthi herausgegebene Anthologie beHindert& verRückt: Worte_Gebärden_Bilder finden (edition assemblage, 2020), die Beitrage von nicht-binären Personen enthält, erscheint dagegen nicht. Doch selbst wenn mensch in Betracht zieht, dass bei einigen, vermutlich wenigen, Büchern im Sortiment von buchhandel.de die korrekten Stichwörter fehlen, sind trans, inter und nicht-binäre (tin) Menschen in der Literatur insgesamt eindeutig unterrepräsentiert.
Es wäre jedoch keine sinnvolle Lösung, den Anteil an Büchern, die tin Charaktere enthalten oder von tin Autor:innen geschrieben sind, bei bestehenden Standards lediglich zu erhöhen und einfach mehr Bücher zu veröffentlichen, die sich diesen Themen widmen. Gerade in einem Bereich, über den in großen Teilen der Leser:innenschaft noch immer viel Unwissen herrscht, ist es mit der simplen Erhöhung von Repräsentation nicht getan. Denn selbst unter den Büchern, die es hier schon gibt, finden sich zahlreiche, die ihrem Thema nicht gerecht werden. Als Betreiber von trans*fabel – einem Webshop mit Büchern und Kunst zum Thema jenseits des 2-Geschlechtersystems, habe ich den Anspruch, die Bücher vor Aufnahme in den Shop möglichst zu lesen. Auch um für eine gewisse Qualität zu sorgen. Eine oft frustrierende Aufgabe.
Qualitativ fragliche Buchinhalte
Viele der veröffentlichten Bücher stellen tin Personen als Sensation dar, misgendern oder exotisieren sie, wie Frankissstein von Jeannette Winterson (Kein & Aber, 2019), in dem wiederholt auf die vergrößerte Klitoris eines trans Mannes hingewiesen wird und dieser von anderen Charakteren auch immer wieder als Mädchen bezeichnet wird. Die Körperlichkeit von trans Menschen wird dadurch auf ihre vermeintliche Andersartigkeit reduziert, die Aufmerksamkeit erzeugen soll, transphobes Verhalten wiederum wird normalisiert anstatt ein Gegenbeispiel zu realer Diskriminierung zu liefern. Häufig werden tin Charaktere auch lediglich benutzt, um für Verwirrung zu sorgen, wie in Mordfällen, wenn sich spätestens bei der Obduktion herausstellt, dass die getötete Frau einen Körper hat, dem bei Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen wurde, oder wie in Ellison Coopers Thriller Todeskäfig (Ullstein Taschenbuch Verlag, 2018), in dem ein Verdächtiger schließlich als Täter ausgeschlossen wird, als er sich als trans outet, da der Täter an seinem Opfer Sperma hinterlassen hat. Auf diese Weise werden tin Menschen und ihre Körper objektifiziert. Statt sie als Individuen darzustellen, liegt der Fokus darauf, ihre körperlichen Eigenschaften für die Entwicklung der Story einzusetzen.
In anderen Büchern werden negative Empfindungen gegenüber eigener Körper derart in den Mittelpunkt gestellt, dass kein Raum bleibt für die Bejahung z. B. intergeschlechtlicher Körper und Empowerment. Gleichzeitig werden die Folgen von Zwangs-OPs an Kindern, durch die bereits in sehr jungen Jahren der Körper in normierte Vorstellungen gezwungen werden soll, nicht thematisiert oder heruntergespielt. Während inter Menschen oft als monströs dargestellt werden, gelten sie in anderen Fällen zum Teil als die besseren Menschen, manchmal gar mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. So auch in dem 2020 erschienenen Buch Arkadien von Emmanuelle Bayamack-Tam, in dem Intergeschlechtlichkeit mal als „krankhafte Mutation“ oder „Irrtum der Natur”, mal als „sagenhafte Metamorphose“ oder „Zukunft der Menschen“ bezeichnet wird und dabei die Adjektive trans und intersexuell synonym verwendet werden. Die Mythisierung und romantische Verklärung von Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtermodell einordnen, ist aber genauso eine Zurschaustellung von körperlicher Realität wie die Ausnutzung als kurioses Detail einer Erzählung. Neben diesen problematischen Darstellungen von tin Charakteren, finden sich in vielen Büchern auch Heterosexismen, Rassismen und z. B. Diskriminierung nach Alter oder Körperumfang. Und das selbst in Büchern, die ausdrücklich die Absicht äußern, Themen wie Trans und TIN Raum und Repräsentation zu geben und denen mensch ein Bewusstsein für den diskriminierungsfreien Umgang mit Körpern zutrauen könnte. Das Kinderbuch Der Katze ist es ganz egal von Franz Orghandl (Klett Kinderbuch, 2020) erzähle, so der Verlag, vom „Transgender-Kind Jennifer” und sei keine „Problemgeschichte”. Ein Kind darin wird durchweg als der „dicke Gabriel“ bezeichnet, der zudem noch gerade die vierte Klasse wiederholt. Keine andere Person bekommt ein Körper-beschreibendes Adjektiv vorangestellt. Bis auf Jennifers ebenfalls dicken Vater, dessen Körperumfang mehrfach betont wird: Der Papa „blättert mit seinen dicken Fingern” durch ein Heft, landet mit „einem Plumps”, als er sich setzt, und „schlägt mit seiner Speckhand aufs Autodach“. Die anderen, allesamt schlank dargestellten Personen erhalten keine entsprechenden Zuschreibungen. Ein weiteres Beispiel ist der Jugendroman Und morgen sag ich es von Doris Meißner-Johannknecht (Löwenherz, 2018). Laut Verlag thematisiert das Buch „Identität und Geschlecht in einer sensibel und klug erzählten Geschichte und schenkt einen neuen Blick auf die für viele noch immer schwierige Thematik Transgender.” Hier sieht die Hauptfigur Paul vom Balkon aus in einer Hollywoodschaukel aufgrund mangelnder Brille ein „schwarze[s] Riesenteil”, das sich als Mensch entpuppt, dessen „schwarze” Hautfarbe wiederholt thematisiert wird, während die weißen Charaktere nur dann als weiß bezeichnet werden, als sie auf einer Party die einzigen Weißen sind. Auch hier zeigt sich, dass die reine Darstellung und Thematisierung von trans und tin Menschen noch keine diskriminierungsfreie Repräsentation garantiert, wenn körperliche Merkmale weiterhin stigmatisiert werden. Die meisten dieser Bücher werden von nicht-tin Personen geschrieben.
Ein positives Beispiel für einen Roman, der gelungen ist und in dem nicht, wie sonst häufig, einer medizinischen Sichtweise gefolgt wird, die tin Menschen pathologisiert, ist Sasha Marianna Salzmanns Roman Außer sich (Suhrkamp, 2018). Die Identitätssuche der Hauptfigur Alissa/Ali wird erzählt ohne diese oder andere trans Charaktere in Schubladen zu pressen. Wie selbstverständlich wird von einer Frau am Pissoir geschrieben, die ihren „Schwanz” in der Hand hält. Alissa/Ali gelangt selbstbestimmt und ohne sich Ärzt:innen gegenüber beweisen zu müssen an Testosteron. Auch sonst werden keine Krankheitsbilder hervorgerufen. Denn tin zu sein, ist keine Krankheit und auch kein psychologisches Problem. Informationen hierüber finden sich online, aber auch in Büchern. Genauso wie über die vielen unnötigen OPs an inter Kindern, die negative, lebenslange gesundheitliche Folgen haben, und über die herabwürdigenden Prozesse, die trans Menschen durchlaufen müssen, um die für sie notwendigen Behandlungen zu erhalten.
Wenn Nicht-Marginalisierte über Marginalisierte schreiben
Trotz der Fülle an verfügbaren Informationen scheinen die wenigsten nicht-tin Autor:innen ausreichend zu recherchieren, wenn es um die Darstellung fiktiver tin Charaktere geht. Zudem scheinen sie tin Charaktere häufig nur wegen zugeschriebener Eigenschaften oder als „special effect“ einzusetzen. Löbliche Ausnahmen sind die Bücher Bus 57 von Dashka Slater (Loewe, 2019) über eine:n agender Jugendliche:n und der Thriller Verschnitt von Jennifer Hauff (mainbook, 2020) zum Thema Inter. Bus 57 basiert auf einer wahren Geschichte. Slater hat den Gerichtsprozess, der den wahren Begebenheiten folgte, monatelang verfolgt, mit Beteiligten gesprochen, Hintergründe recherchiert und sich über nicht-binäre Geschlechtsidentitäten informiert. Das Buch Verschnitt handelt von einer OP-Schwester, die sich an einem Kinderchirurgen, der geschlechtsverändernde Operationen an Kleinkindern vornimmt, rächen will. Vorbild dieses Arztes ist Dr. Money, der die von ihm erzwungene Geschlechtsänderung von David Reimer in den 1970ern fälschlicherweise als Erfolg pries und als Argument für Operationen an inter Kindern nutzte. Hauff hat sich u. a. mit Dr. Milton Diamond getroffen, der die fürchterlichen Auswirkungen der Behandlung durch Dr. Money auf Reimers Leben publik gemacht hatte, und sich gegen die Einstufung von Intergeschlechtlichkeit als Krankheit und Zwangs-OPs an inter Kindern einsetzte.
Im Rahmen von trans*fabel, aber auch als Person, die sich als trans und genderqueer verortet, interessiere ich mich natürlich auch für Bücher, die von tin Autor:innen selbst geschrieben werden. Ich erwarte ein Spektrum, das dem meines Bekanntenkreises ähnelt. Doch:
Welche tin Autor:innen werden veröffentlicht?
Mehrheitlich sind es Autobiografien, die von tin (vor allem trans) Autor:innen auf den Buchmarkt gelangen und im Literaturbetrieb publik gemacht werden. „Geboren als Mädchen, leben als Mann“ – so oder so ähnlich lautet häufig der Untertitel oder heißt es im Klappentext. Vom „falschen Körper“ ist, auch in neueren Büchern, viel die Rede. Nun sind das häufig Eigenzuschreibungen, die für trans Menschen jedoch nicht generalisiert werden dürfen. Trans und TIN sind keine Kategorien mit fest zugeschriebenen Eigenschaften und den stets gleichen Selbstwahrnehmungen. Manche trans Menschen fühlen sich im falschen Körper. Für andere ist ihr Körper richtig, ob sie nun körperliche Veränderungen vornehmen oder nicht. Viele sagen, sie sind seit Geburt weiblich/männlich/nicht-binär; ihnen wurde lediglich aufgrund äußerer Körpermerkmale ein falsches Geschlecht zugewiesen. Warum findet das so wenig Eingang in die Literatur? Ist das für die Vermarktung zu komplex und zu abseits der etablierten zwei Geschlechter?
Veröffentlicht werden offensichtlich vor allem trans Autor:innen, die sehr Intimes erzählen, von ihrem Leidensdruck, ihrer Körperdysphorie, also dem Unwohlsein mit dem eigenen Körper, den medizinischen Behandlungen und Diskriminierungserfahrungen. Während dies für viele Realitäten sind, fehlen häufig die positiven Erfahrungen, die Unterstützung und Solidarität, die tin Personen erhalten, und die erlangte Ausgeglichenheit, die damit einhergeht, öffentlich zu sich stehen zu können (ob nun mit oder ohne Hormoneinnahme, OPs, Namensänderung etc.). Autobiografische Bücher, die empowernd sind, keinen zwingenden Leidens- und Transitionsweg aufzeigen gibt es wenige. Ausnahmen sind die Bücher von Ika Elvau, Jayrôme C. Robinet, Thomas Page McBee und Paul B. Preciado.
Nun schreiben tin Autor:innen ja nicht nur Autobiografien. Neben einigen Romanen, die bei großen Verlagen erschienen sind, gibt es Prosa- und Lyrik-Bücher bei kleinen Verlagen wie Edition Assemblage und im Selfpublishing. Hier finde ich Darstellungen und Eigenrepräsentationen, die über Stereotype und binäre Geschlechtsidentitäten hinausgehen. Im Idealfall zeigt sich hier auch ein Bewusstsein weiterer gesellschaftlicher Diskriminierungen, die thematisiert und intersektional mitgedacht werden (Intersektionalität bezeichnet die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsprozesse). Leider sind sie die Ausnahme.
Trends und Tokenisierung
Neben der oben erwähnten Verkaufsfaktoren Sensationalisierung und Exotisierung, werden in vielen der Bücher Frauen und Männer stereotypisch dargestellt. Das ist auch in vielen Büchern, die nicht zum Thema TIN sind der Fall. Doch allein die Bedeutungen von trans, inter und nicht-binär sollte darauf hinweisen, dass diese Stereotypen oft, bewusst und unbewusst, unterlaufen werden. Bei Autobiografien von trans Menschen könnte dieses Stereotypisieren zum Teil daran liegen, dass diese sich gegenüber Ärzt:innen, Krankenkassen und der Gesellschaft beweisen müssen und dabei fast schon gezwungen sind, Rollenklischees, u. a. mit Aussagen wie „Ich denke wie ein Mann“, zu erfüllen, damit sie ihre körperliche Transition beginnen können. Das legitimiert jedoch weder diese zu propagieren, noch fast ausschließlich solche Bücher zu veröffentlichen.
Insgesamt wird somit nur ein kleines Segment aller tin Menschen publiziert und dargestellt. So entsteht der Eindruck eines vermeintlichen Kollektivs, in dem alle, mehr oder minder, die gleichen Erfahrungen durchmachen. Fallen tin Menschen dann nicht in diese Kategorie, stoßen sie auf noch mehr Unverständnis und Intoleranz. Häufig wissen Menschen nicht, was nicht-binär in Bezug auf Geschlechtsidentität bedeutet und bestehen darauf, andere Menschen durch Pronomen oder Anrede in eine der Kategorien männlich oder weiblich zu stecken. Sie akzeptieren nicht, wenn ein Mensch sich trotz vermeintlich weiblichem Äußeren und ohne Testosteron nehmen zu wollen, als Mann identifiziert. Oder fragen sich, wieso die Person sich nicht eindeutig männlich kleidet und gibt.
Die publizierten und in Fiktionen dargestellten tin Personen wirken denn auch wie eine Art Token oder anders ausgedrückt wie Alibipersonen, um zu zeigen: Wir sind inklusiv; wir publizieren Bücher über tin Menschen. Oder vielleicht ist es nur ein Aufspringen auf einen Trend, denn Bücher zum Thema Trans verkaufen sich; zu Inter eher nicht. In Zukunft könnte die Anzahl deutschsprachiger Bücher über nicht-binäre Geschlechtsidentitäten sich erhöhen; in der englischsprachigen Literatur gibt es hierzu schon mehr Veröffentlichungen.
Damit haben wir einige Antworten auf eine wichtige Frage zur Veröffentlichung von Literatur zum Thema TIN: „Welche Angehörige welcher marginalisierten Gruppen werden gemäß Vertriebs- und Vermarktungslogiken als Token eines mutmaßlichen Kollektivs herausgestellt, welche nicht?“
Doch was ist nötig, um die Vielfalt von tin Personen in der Literatur widerzuspiegeln?
Recherche, Eigenrepräsentation und Mut
Zum einen sollten wir darauf achten, dass keine diskriminierenden Inhalte publiziert und die Intersektionalität von Diskriminierung mitgedacht wird. Alle Autor:innen sollten sich hier zu mehr Recherche verpflichten und nicht-tin Autor:innen zusätzlich zu mehr Recherche zum Thema TIN. Außerdem ist wichtig, dass mehr tin Autor:innen veröffentlicht werden, damit diese direkt ihre Erfahrungen mitteilen können und was ihnen wichtig ist. Und ich wünsche mir im Literaturbetrieb etwas Mut zu Neuem, um die Vielfalt der tin Community abzubilden, samt genderfluider Glitzerwesen, die ständig ihr Pronomen wechseln oder keins benutzen, und tin Menschen, die so „normal wie du und ich” sind.
[1] Hier sind Doppelaufführungen mit dabei. Da dies jedoch auch in den Stichwortsuchen der Fall ist, ändert dies die Prozentzahlen nicht wesentlich.
[2] Tania Witte: Andersrum ist auch nicht besser: Willkommen im Mainstream. In: Zeit Online. 15. Juni 2017. https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-06/trans-gender-non-binary-sexuelle-identitaet
Photo by Delia Giandeini on Unsplash
Der Aufkleber auf dem Foto stammt von Clara Fridolin Biller (@fffridolin_)


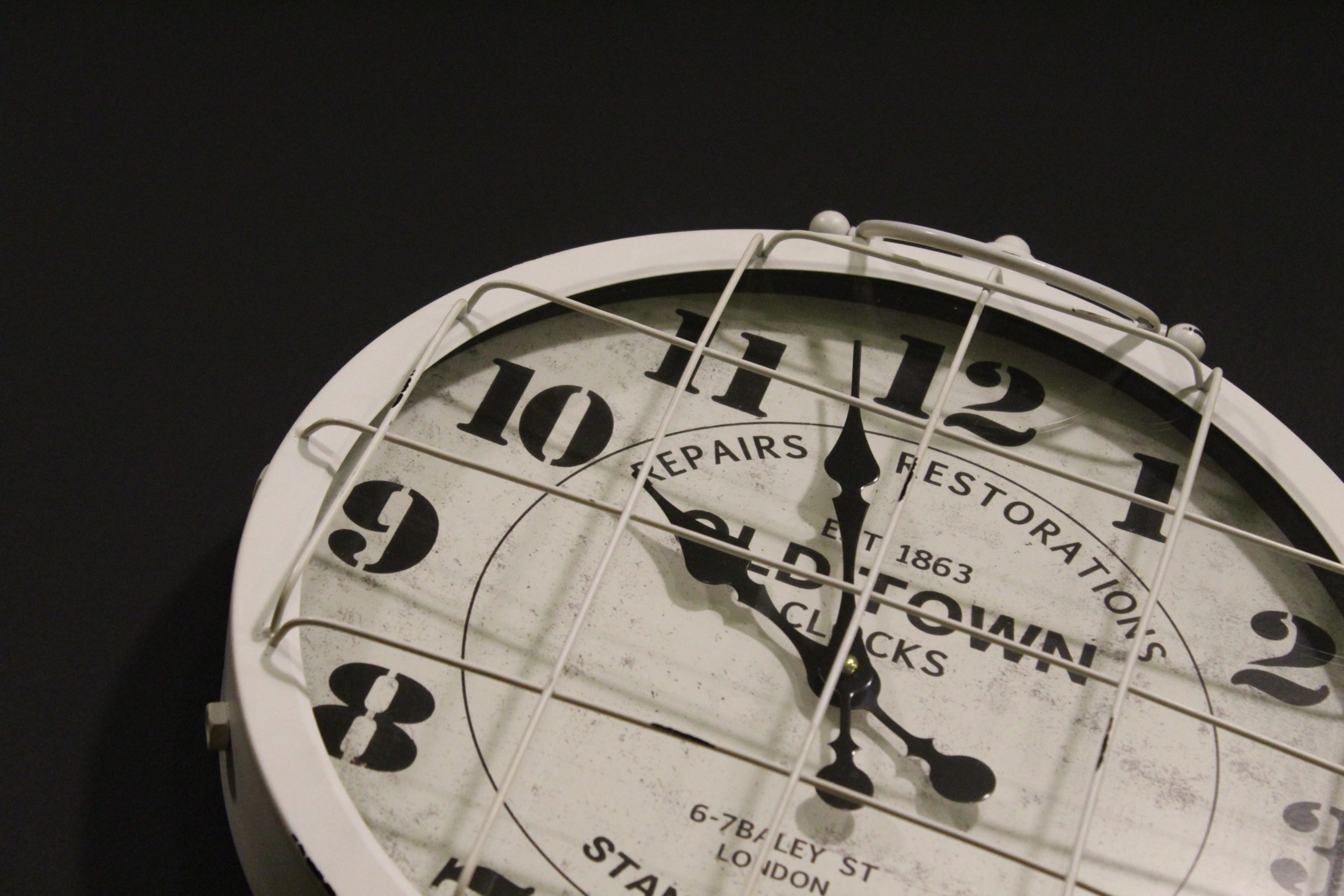






 vergangenen Jahr in Ein Mann seiner Klasse beschrieben, wie ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, das Gewalt, Verwahrlosung und Vernachlässigung durch Familie und Gesellschaft ausgesetzt ist, seinen Weg aus diesem Umfeld findet. Die Protagonistin in Streulicht wächst auf den ersten Blick in ähnlichen Umständen auf. Vater und Mutter streiten viel und manchmal kommt es zu Gewalt. Dann muss sie zum Großvater, der in der Wohnung im Erdgeschoss wohnt. Die Wohnung ist oft schmutzig, Hausaufgaben macht sie, während nebenher Talkshows laufen, und der Vater muss nachts aus der Kneipe abgeholt werden. Doch zu diesen Umständen, in denen die Erzählerin aufwächst, kommt zusätzlich die Diskriminierung, der sie aufgrund der Herkunft ihrer Mutter und des Vornamens, den ihre Eltern ihr gegeben haben, ausgesetzt ist. All diese Lebensumstände signalisieren für die deutsche Mehrheitsgesellschaft einen bestimmten Platz, an den die Erzählerin gehört. Dass sie an diesem Ort aber nicht bleibt, davon handelt Streulicht.
vergangenen Jahr in Ein Mann seiner Klasse beschrieben, wie ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, das Gewalt, Verwahrlosung und Vernachlässigung durch Familie und Gesellschaft ausgesetzt ist, seinen Weg aus diesem Umfeld findet. Die Protagonistin in Streulicht wächst auf den ersten Blick in ähnlichen Umständen auf. Vater und Mutter streiten viel und manchmal kommt es zu Gewalt. Dann muss sie zum Großvater, der in der Wohnung im Erdgeschoss wohnt. Die Wohnung ist oft schmutzig, Hausaufgaben macht sie, während nebenher Talkshows laufen, und der Vater muss nachts aus der Kneipe abgeholt werden. Doch zu diesen Umständen, in denen die Erzählerin aufwächst, kommt zusätzlich die Diskriminierung, der sie aufgrund der Herkunft ihrer Mutter und des Vornamens, den ihre Eltern ihr gegeben haben, ausgesetzt ist. All diese Lebensumstände signalisieren für die deutsche Mehrheitsgesellschaft einen bestimmten Platz, an den die Erzählerin gehört. Dass sie an diesem Ort aber nicht bleibt, davon handelt Streulicht.