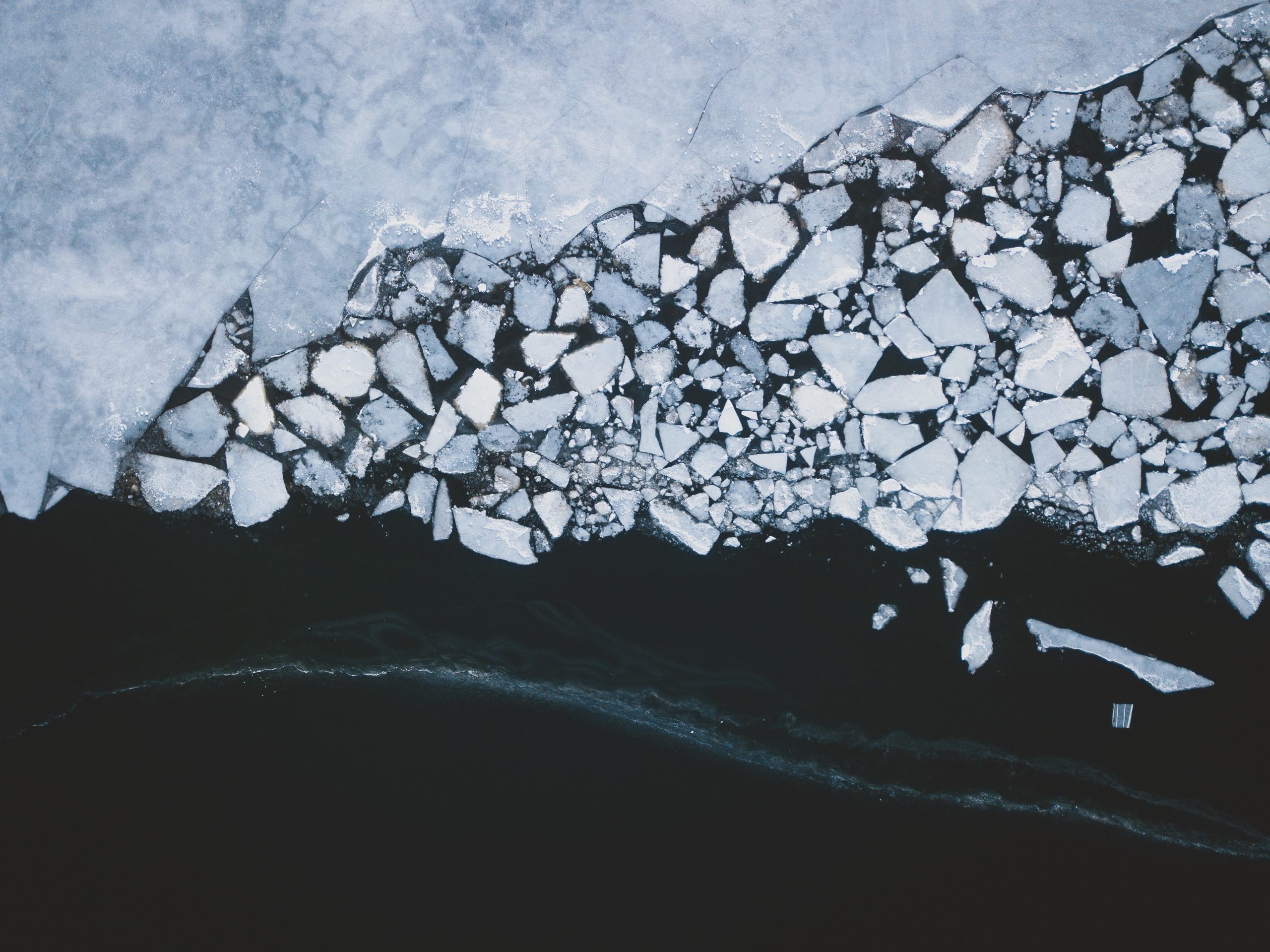Tagebücher als Krisenphänomen: Während der Corona-Pandemie tauchten vielerorts und in verschiedenen medialen Formaten Journale auf und werden zum Teil bis heute weiter fortgesetzt. Die Konjunktur des Tagebuchs wurde auch vom Feuilleton schnell als Thema aufgegriffen, wenn auch nicht unbedingt mit positiver Wertung. Julia Encke schrieb in der FAS vom 5. April von „Gedankenkitsch“ und urteilte, dass „mit diesem ganzen hohlen Pathos und der Trostprosa […] gar nichts gewonnen“ sei. Marie Schmidt verschob in der Süddeutschen Zeitung vom 16. April den Akzent ein wenig. Auch sie beschreibt zwar das „Protokoll der Krise“ als so „vielstimmig und wirr wie die Krise selbst“, stellt aber die Frage, wie denn überhaupt literarisch über sie zu schreiben sei. Beide greifen in ihren Beiträgen Fragen auf, die Kathrin Röggla schon in einem Text in der FAZ vom 21. März mit dem Titel „Prognosefieber“ thematisiert hatte: dass jene Versuche des Auf- und Mitschreibens vor allem in Hinblick auf Verschiebungen in der Zeitwahrnehmung zu perspektivieren seien. Literatur müsse sich einmal mehr als Zeitkunst beweisen. Diese Forderung steht im Kontext unzähliger Äußerungen zur Zeitwahrnehmung in der Corona-Pandemie, die im Philosophie-Magazin genauso zu finden sind wie im Tagesspiegel, in den Twitter-Timelines genauso wie in den angesprochenen Tagebüchern. Um diese geht es im Folgenden im Besonderen. Als Gegenstand der Diskussion im DFG-Forschungsprojekt „Schreibweisen der Gegenwart. Zeitreflexion und literarische Verfahren nach der Digitalisierung“ an der Universität Greifswald dienten insbesondere das kollektive Tagebuch auf 54books, das Journal von Carolin Emcke in der Süddeutschen Zeitung sowie das mehrstimmige Tagebuch auf der Internetseite des Literaturhauses Graz unter Beteiligung von Kathrin Röggla.
(Wollte ja immer dabei sein, wenn „Geschichte passiert“, Kubakrise und sowas. Findet man auch nur, wenn man den Ausgang schon kennt, wird mir gerade so bewusst.)
— ellebil (@ellebil) March 15, 2020
Welchen Wert haben Tagebücher, die wissend für die Öffentlichkeit geschrieben werden? Unter einem Tagebuch versteht man zunächst die Sammlung intimster Gedanken, es ist eine Form der privaten Reflexion, es wird nicht geschrieben, um eine Wirkung auf Lesende zu haben. Besondere Formen stellen die Journale von Literat*innen dar, da diese sich der nachträglichen Veröffentlichung vielleicht schon beim Verfassen bewusst waren. Bei den Corona-Tagebüchern, die momentan überall und in jeder Form (als Video, Podcast oder Text) zu finden sind, gibt es verschiedene Ansätze. Teils schreiben (oder streamen) Privatpersonen, teils Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, wie etwa der Wirtschaft. Es sind häufig Texte von Menschen, die von Entschleunigung sprechen und diese auch persönlich im Home-Office in den eigenen vier Wänden, oft mit Balkon oder Garten, wahrnehmen. Verzerrt es nicht die Realität, wenn hauptsächlich die dokumentieren, die vom Kampf gegen die Pandemie am wenigsten spüren? Wenn sie nicht aus dem Krankenhaus, dem Supermarkt oder vom Leben auf der Straße berichten, was für eine Funktion haben die Tagebücher dann? Sie versuchen, den Ausnahmezustand festzuhalten, zu verarbeiten, zu bewerten, jedoch nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen. Wie der Hashtag #weareallinthistogether vermitteln die Tagebücher Trost und stiften Gemeinschaft. Aus ihnen ist herauszulesen, dass die Monothematik der Coronapandemie und der gesteigerte Nachrichtenkonsum mehr und mehr Menschen bedrücken. Für wen sind die öffentlichen Tagebücher dann geschrieben? Wenn das gegenwärtige Publikum nicht interessiert ist, bleibt der Blick in die Zukunft. Coronatagebücher sind Dokumente, die für die Zeit nach Corona geschrieben werden und vermutlich auch im Herbstprogramm der Verlage zahlreich vorhanden sein werden.
Auf dem Blog 54books ensteht ein kollektives Tagebuch von 29 Autor*innen, das mit dem Ziel geführt wird, Veränderungen zu dokumentieren und u.a. Tweets zu archivieren. Das gemeinsame Schreiben an einem Projekt, das die durch die Pandemie geschlossenen Landesgrenzen überwindet, führt schon während des Entstehungsprozesses zur psychischen Erleichterung bei den Autor*innen: „Ich merke, wie gut mir das Schreiben an diesem kollektiven Tagebuch tut. Manchmal, wenn ich eine Notiz hinterlassen will, sehe ich, dass andere gerade auch schreiben, und ich stelle mir vor, wie sie irgendwo auf dem europäischen Festland vor ihren Bildschirmen sitzen und tippen und korrigieren, während ich hier an meinem Schreibtisch auf der Insel genau das Gleiche mache. Eine Gemeinschaft von Schreibenden in Zeiten der sozialen Distanz“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books). Die unmittelbare Gegenwart im Schreibprozess kombiniert mit der Gleichzeitigkeit des Schreibens als Erfahrung gemeinsamer Gegenwart steht der verzögerten Veröffentlichung gegenüber: Die Texte sind schon veraltet, wenn sie erscheinen.
Es sind Spannungsverhältnisse, die die Zeitwahrnehmung dominieren: Hartmut Rosa spricht von einer erzwungenen Entschleunigung, die für uns körperlich und wirtschaftlich spürbar ist. Diese Lücke, die die scheinbar freie Zeit mit sich bringt, wird nach Rosa von der „mediale[n] Berichterstattung über das Fortschreiten der Epidemie in Echtzeit […| symptomatisch“ ausgefüllt. „Das soziokulturelle Leben spaltet sich gerade in ein physisch entschleunigtes ‚realweltliches‘ und ein hyperventilierendes digitales Leben.“ Auch in den Tagebüchern von 54books spiegelt sich dieser Aspekt wider. Auf der einen Seite wird die Entschleunigung des Alltags bemerkt, die sich bei einem Autor sogar auf das Lesetempo auswirkt: „Ich lese mehr, ich lese langsamer“ (Viktor Funk, 54books). Auf der anderen Seite steht ein zunehmendes Unwohlsein, das sich im Umgang mit den Sozialen Medien entwickelt: „Die Menge an Berichterstattung und digitalem Lärm steht in einem schwer aushaltbaren Missverständnis zur (scheinbaren?) Ungewissheit der Situation“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books). Oder: „Ich lese regelmäßig twitter und merke, dass es nicht gut tut, ich es aber auch nicht lassen kann. Jede*r postet ständig Artikel wie es jetzt weitergehen könnte. Es entstehen Diskussionen über Fake-News, die heute keine Fake-News mehr sind. Alle regen sich auf, niemand weiß genaues“ (Charlotte Jahnz, 54books). Die Stimmung ist angespannt und dominiert von der Sorge um eine ungewisse Zukunft. Marlene Kayen, die Vorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs, begründet in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung die Konjunktur des Tagebuchschreibens wie folgt: „Ich habe den Eindruck, dass sie sich einen kleinen Fluchtraum aufbauen, in den sie sich zurückziehen und ungefiltert Sachen aufschreiben. Vielleicht lassen sich deshalb an Tagebüchern so gut psychische Entwicklungen beobachten.“ In den Journalen werden nur die subjektiven Wahrnehmungen der Pandemie festgehalten, hier wird die enge Verknüpfung von persönlicher Wahrnehmung und Zeit besonders deutlich. Es ist eine gegenwärtige Fokussierung auf den Moment, ein Konservieren des Jetzt und eine Form der Beruhigung, da es für den Moment des Schreibens nur um das Jetzt geht. Die wegfallende, gewohnte Strukturierung eines Tages, verbunden mit dem Warten auf Neuigkeiten und das Ende der Pandemie, führen zu einem Schwebezustand, zu einem Leben neben der Zeit. Maike Ladage schreibt dazu auf 54books: „Immerzu verwundert. Ausnahmezustand ständig präsent, gleichzeitig seltsames Aus-der-Zeit-Fallen und ganz Gegenwärtig-sein.“ Das tägliche Schreiben liefert den Rhythmus, der dem Alltag mittlerweile fehlt, selbst die Bus- und Zugpläne folgen nun einer anderen Zeitrechnung: „Seit Mittwoch ist jetzt immer Samstag. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben eine neue Zeitrechnung für uns angefangen.“ (Rike Hoppe, 54books)
Zuletzt sind Tagebücher aber auch eine Form, etwas von sich zu konservieren und zurückzulassen, weil selbst der eigene Ausgang ungewiss ist. Das Schreiben tritt somit dem Vanitas-Gedanken entgegen, der durch den Tod als definitiven Endpunkt der Lebenszeit aktuell präsenter ist: „Die Verheerungen, die das Virus anrichtet, sind unserer Fantasie überlassen. Sterbende bleiben isoliert, nicht einmal Angehörige dürfen zu ihnen. Der Weg, den letztlich jeder allein geht, ist nun ein einsamer. Ihre Gesichter sehen wir dann manchmal doch: Wenn sie uns aus italienischen Todesanzeigen entgegenblicken, noch aus dem Leben, aus ihrer Vergangenheit in unsere Gegenwart“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books).
***
Bis vor einigen Wochen war es noch die Digitalisierung, die von vielen für eine grundlegend veränderte Zeitwahrnehmung, eine radikale Fokussierung auf die Gegenwart und einen neuen Begriff von Gegenwart verantwortlich gemacht wurde. Dabei war nicht immer klar, ob durch die digitalen Medien nun eine „breite Gegenwart“ (Gumbrecht) entstanden ist, die von nicht vergehenden Vergangenheiten überschwemmt wird, oder ob der „present shock“ (Rushkoff) im Gegenteil eine Kultur des Präsentismus hervorgebracht hat, in der Vergangenes instantan vergessen wird. Und auch die Frage, ob alles immer schneller wird, wenn alles jetzt passiert, oder vielmehr Stagnation und Stillstand zu verzeichnen sind, blieb zwischen den divers zirkulierenden gegenwartsdiagnostischen Statusmeldungen offen. Einig war man sich nur darin, dass sich die Wahrnehmung und das Verständnis von Gegenwart krisenhaft verändert haben und dass diese Veränderungen mit dem Schlagwort der Digitalisierung erfasst und begründet werden können.
Das neue Coronavirus sorgt nun für eine merkwürdige Überlagerung und Verschiebung dieser Thesen, Debatten und Szenarien, für eine verschobene Wiederholung, die die einschlägigen Stichworte aus dem Digitalisierungsdiskurs – weltweite Netzwerke der Übertragung, der Zustand des always-on, permanente Aktualisierung – wie auch die entsprechende Krisenrhetorik auf einer anderen Ebene reproduziert und reanimiert. „In der Krise, die uns alle derzeit so fordert, erleben wir einen Moment enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“, stellt, wie viele andere, Ende März 2020 der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Armin Laschet fest und folgert: „Das Jetzt fordert unsere ganze Aufmerksamkeit.“ Hier werden nun nicht die digitalen Medien, die alles auf die Gegenwart ausrichten, als Verursacher einer Krise identifiziert, der „Moment enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“ wird vielmehr auf ein Virus zurückgeführt. Auf ein infektiöses, halblebendiges Etwas, das, wie zwischenzeitig spekuliert wurde, auf „nassen Märkten“, zwischen weggespültem Blut und Dreck, von Tieren auf den Menschen übergesprungen sein soll, mittlerweile aber weltweit zirkuliert und mehr oder weniger zeitgleich die ganze Menschheit betrifft.
Dass viele darüber im Modus ständig aktualisierter, sich schnell ausbreitender Updates informiert werden, ist dann aber doch wieder der Digitalisierung geschuldet, die das etablierte System der Massenmedien durch die Kanäle der Sozialen Medien maßgeblich ergänzt und erweitert, sodass sich ein merkwürdige Parallelität der Topik des Viralen ergibt: Der exponentiellen Ausbreitung des Virus korrespondiert in noch nicht hinreichend berechneten Ausmaßen die rasante, durchaus treffend als ‚viral‘ bezeichnete Ausbreitung von Nachrichten, Gerüchten und individuellen Statusmeldungen zum Virus – und mithin auch die Ausbreitung der Auffassung, dass es unsere Zeitwahrnehmung grundlegend verändert. Verstärkt wird dieser Eindruck auch dadurch, dass dieses Coronavirus neu ist und seine Aktivitäten wie deren Folgen in vielen Hinsichten unabsehbar sind. Selbst diejenigen, die sich professionell mit Viren befassen, wissen immer noch vergleichsweise wenig über es und müssen den zwischenzeitig erreichten Wissenstand permanent revidieren, korrigieren und aktualisieren.
Auch deshalb liegt es nahe, dass der unübersichtlich mehrgleisigen Zirkulation viraler Prozesse zwischen Menschen und Medien geradezu massenhaft mit dem Schreiben von Tagebüchern begegnet wird. Der Rekurs auf ein etabliertes, spätestens seit Samuel Pepys Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert zudem epidemieerprobtes Medium ermöglicht es, den diffus global zirkulierenden Bedrohungsszenarien mit einer individuell begrenzten, selbst fokussierten Perspektive zu begegnen, die durch die Veröffentlichung in den Sozialen Medien aber zugleich den Anschluss an andere oder auch den öffentlichen Diskurs ermöglicht, über die vermeintlich eigene Filterblase oder die weiter ausgreifenden Netzwerke digital vermittelter Kommunikation.
Als Medium der Fokussierung auf die Gegenwart, mit dem man das, was aktuell passiert, Tag für Tag festhalten kann, in dem Veränderungen (wie auch deren Ausbleiben) schrittweise notiert, reflektiert und, gegebenenfalls gleich am nächsten Tag, revidiert werden können, wirkt das Tagebuch der derzeitigen Situation auf besondere Weise angemessen. Da es zugleich einen Rahmen bildet, in dem ohnehin häufig über Zeitverhältnisse reflektiert wird, insbesondere über die Aporien und Paradoxien der schriftlich vermittelten Gegenwartsfixierung, ergeben sich schnell weitere Interferenzen mit eben der Situation, die durch das Virus entstanden ist.
Viele der aktuell entstehenden Corona-Tagebücher thematisieren nicht nur, sondern reproduzieren auch selbst jenes Neben- und Miteinander von Verlangsamung und Beschleunigung, das auch im politischen Diskurs den Eindruck eines „Moments enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“ prägt. Einerseits liegt die „Halbwertszeit vom Neuigkeitswert“, wie Kathrin Röggla in ihrem Corona-Tagebuch auf der Website des Literaturhauses Graz feststellt, „bei ca. sechs Stunden“, andererseits ist, wie sie nahezu zeitgleich in einer Tageszeitung, der FAZ, ergänzt, „das öffentliche Leben stillgestellt, das Sozialleben eingefroren“. „Ich kann nicht Schritt halten, der Diskurs bewegt sich in rasender Geschwindigkeit vorwärts, die Situation kann sich jederzeit ändern. Was heute dementiert wird, ist morgen Realität“, reflektiert Röggla eine auch in vielen anderen Corona-Tagebüchern geteilte Wahrnehmung der aktuellen Situation. Wenn sie feststellt, dass sich alles „zu schnell“ bewegt und alles „morgen“ schon „durch neue Nachrichten“ abgelöst wird, beschreibt sie zugleich aber auch den üblichen Aktualisierungsmodus von Tagebuch und Tageszeitung. Der zeigt allerdings, trotz digitaler Vernetzung, in der gegenwärtigen Situation geradezu überdeutlich seine Grenzen: „Ich komme also nicht durch zu der Gegenwart der Lesenden“, schreibt Röggla angesichts einer fünftägigen Verzögerung bei der Veröffentlichung des Online-Tagebuchs, „bin irgendwie in der Vorzeit zuhause, aus der ich wie hinter dicken Glasscheiben winken kann, während es, kaum dass ich es niedergeschrieben habe, schon heißen kann: ‚Ha, damals, als wir noch diese Probleme hatten!‘“ Dieses eher redaktionell denn medial verursachte Problem verschiebt sich nochmals im Blick auf den Zeitindex der Maßnahmen und Prognosen, mit denen der Ausbreitung des Virus begegnet wird. Da man immer erst ein, zwei Wochen später wissen kann, was die aktuell durchgeführten Maßnahmen gebracht haben, ist im Prinzip auch die unmittelbare Gegenwart schon von dicken Glasscheiben umstellt, die verspätete Einsichten, verfrühte Aktivitäten und angemessene Aktualisierungen nicht immer als solche sichtbar machen (was aber vielen auch schon vor Corona als Kennzeichen der Gegenwart galt).
Röggla hebt noch eine weitere Form dieser Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hervor, die gegenwärtig besonders deutlich hervortritt, aber genau genommen auch schon früher zu beobachten war: „Während immer neue Nachrichten hereinbrechen in immer engmaschigerem Takt, deren Hyperaktualität seltsamerweise noch nicht einmal enervierend wirkt, verhält es sich doch oft so, als würde ich das immer Gleiche lesen.“ Die monothematische Fokussierung nahezu aller Kommunikationsmedien zeitigt ihre hypnotischen, zugleich aufregenden wie beruhigenden Effekte nicht zuletzt dadurch, dass permanent auf allen Kanälen gesendet wird, auch wenn es, wie häufig, nichts, zumindest nichts Neues zu melden gibt. Die vielen Tagebücher und die ungezählten Statusmeldungen in Sachen Corona, die viele Timelines der Sozialen Medien wie einen monothematisch fokussierten Gruppenchat erscheinen lassen, reflektieren diese Konstellation gewissermaßen in Echtzeit – und setzen sie eben dadurch im Modus der Logik des Viralen auch fort.
„Kann es sein“, fragt sich Thomas Stangl im Grazer Corona-Tagebuch, „dass all das, was uns eben noch als gegenwärtig, aktuell, dringlich erschienen ist, von nun an völlig fremd wird, weil sich einfach das Koordinatensystem geändert hat?“ Und Kathrin Röggla schreibt: „Werde ich jetzt eine Springerin zwischen den Zeiten (Gegenwart, Zukunft 1 und Zukunft 2, rasende Vergangenheit)? Zukunft ist durch die drohende Destabilisierung auf heikle Weise wieder vielfältig geworden, die breite Gegenwart beendet. Diese Schwierigkeiten werden uns noch lange begleiten. Es ist nicht abzusehen, was das heißt, dass jetzt eine neue Ära beginnt.“ Der Vorschlag, den Röggla im Nachdenken über die Rolle von Prognosen aus ihren eigenen Prognosen ableitet, ist so einfach wie komplex und bildet nicht zuletzt einen brauchbaren Gegenentwurf zu der von Paolo Giordano in seinem Corona-Tagebuch schon jetzt in Buchform vorliegenden Forderung, „der Epidemie einen Sinn zu geben“.
Röggla setzt auf das Programm einer Literatur, das möglicherweise auch deshalb angemessen und zeitgemäß wirkt, weil es für viele – auch für Röggla – nur bedingt ein grundlegend neues Koordinatensystem oder den Beginn einer neuen Ära in Aussicht stellt: „Eigentlich wären Texte ja hilfreich, die versuchen, die Lage zu erkennen, und insofern sich doch der konkreten Beschreibung des Alltags zuwenden, aber eben einer, die nicht auf etwas hinaus will, der Matrix eines Alarmismus genauso wenig wie dem Programm einer Weltrettung folgend, einer der gemischten Realitäten, die dem Nebeneinanderher von neuer Logik, alten Problemen, unerwarteten Auswirkungen der Situation gerecht wird. […] Es wird ein Arbeiten mit verschiedenen Zeitmodi sein müssen, die Zeitebenen müssen wieder in Kontakt miteinander kommen, und so wird sich Literatur in dieser Situation mehr denn je als Zeitkunst erweisen müssen.“
(Eckhard Schumacher)
***
Durch die Veröffentlichung im Wochentakt verlieren die Corona-Tagebücher bereits ihren unmittelbaren Tagesbezug: Es werden schon beim Lesen nur Rückblicke vermittelt, man denke beispielsweise an die inzwischen selbstverständlichen Kontaktsperren, die in den jeweiligen Beiträgen gerade erst erlebt werden. In dem Sinne ermöglichen Corona-Tagebücher auch schon Tage nach ihrer Veröffentlichung ein kollektives Erinnern an gemeinsam erlebte Maßnahmen, vertraute Gedankengänge werden dort noch einmal aufgerollt; sie haben aber auch eine schwierige Beziehung zu der gegenwärtigen Lektüre, streuen noch mehr Reflexionen in die Monothematik der Coronapandemie und geben Einblick in einen veränderten Alltag, dem die aktuell Lesenden bereits selbst ausgesetzt sind. Dementsprechend tragen sie zur Stiftung einer kollektiven Identität bei und dienen als Orientierungshilfe, funktionieren aber vor allem als (kulturelle) Archive für folgende Generationen, indem die Tagebücher als gewählte Publikationsform Authentizität und Teilhabe vermitteln können.
Gemeinsam ist den Tagebüchern allen: die Zeitphasen sind beleuchteter denn je. Ein rasantes Tempo in der Ausbreitung des Virus und die folgenden politischen Maßnahmen lassen Beiträge und Gedanken schnell als überholt erscheinen, die Berichterstattung in Echtzeit und die Omnipräsenz des Themas in den Nachrichten führen nicht selten zu dem Eindruck einer sich überschlagenden Gegenwart. Kathrin Röggla erkennt in ihren Beiträgen zum Corona-Tagebuch des Literaturhauses Graz darin ihre eigene Position als Schreibende, in der sie „nicht durch zu der Gegenwart der Lesenden“ kommen könne und stattdessen in der „Vorzeit zuhause“ sei.
Eben dort empfindet Nava Ebrahimi bereits den Ausspruch ihres Sohnes, er habe im Traum mit seiner Oma Pizza gegessen, „wie ein Echo aus einer anderen Zeit“. Schon die Monate vor Corona liegen im Zeitempfinden so weit zurück, dass die Vergangenheit weiter wegrückt, nicht mehr erreichbar ist. Die jetzt so erwünschte „Normalität“ wird wie aus einer anderen Welt erlebt, in der sich Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr richtig aneinanderfügen können. Der durch die Pandemie empfundene Orientierungsverlust wird von den einen durch eine Flucht in ihre Erinnerungen an vergangene Zeiten, Kindheitsmomente und frühere Reisen kompensiert, andere versetzen sich in eine imaginierte Nach-Corona-Welt, in der die Möglichkeiten wieder unbegrenzt erscheinen. Carolin Emcke hingegen stört sich in ihrem Tagebuch in der Süddeutschen Zeitung an den vielen Fragen des „Danach“, des Erinnerns an die Pandemie. Sie seien bloß „ein Fluchthelfer der Phantasie“, stattdessen empfindet sie die Gegenwart, ihre Gegenwart, als übrig gebliebenen Handlungsraum, der „sich verwandeln lässt in etwas, das [ihr] gehört“.
So unterschiedlich das Zeitempfinden bereits innerhalb der Tagebücher ist, so wenig bildet es dennoch das Empfinden derjenigen ab, die gar nicht die Zeit haben, um über das Verhältnis der Zeiten zu sinnieren. Tagebuch zu schreiben ist auch ein Privileg. Wenn der Soziologieprofessor Hartmut Rosa in einem Interview mit dem Philosophie Magazin äußert, dass wir nun dem „Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus“ entfliehen könnten und jetzt Zeit hätten, kann dies angesichts der Sorge um das finanzielle, vor allem aber gesundheitliche Überleben vieler und der intensiven Mehrbelastung systemrelevanter Berufe schwer für die Gesellschaft insgesamt greifen. Trotzdem sieht Rosa das Potenzial eines kollektiven Resonanzmomentes und damit von etwas kollektiv Neuem sowie die Chance, dem „Hamsterrad“ unserer auf Steigerung fixierten Gesellschaft zu entkommen und stattdessen zu entschleunigen. Es wird sich zeigen, wie allgemeingültig sich der Eindruck von Entschleunigung und einem anderen Lebenstakt halten kann, oder ob es, angesichts der jetzt schon wieder öffnenden Geschäfte und Lockerungen, für manche nur ein kurzer Ausflug in ein langsameres, verändertes Leben war. Vielleicht wird sich das Zeitverständnis nicht so monumental ändern, wie es aktuell stellenweise vermutet wird, sicher ist bloß: Die Zeit ist spürbarer geworden. Lebenszeit, Gesprächszeit, Kontaktzeit, Arbeits- und Freizeit werden für manche aus einer neuen Perspektive beleuchtet, für andere sind sie schwieriger einzuteilen, aber ob die Pandemie zur kollektiven Erfahrung eines neuen Zeitempfindens führt, wird sich angesichts der heterogenen Lebensrealitäten zeigen müssen.
(Annica Brommann)
***
Die Krisentagebücher, die jetzt geschrieben werden, offenbaren auch eine Krise des Tagebuchschreibens – zumindest jenen Tagebuchschreibens, das versucht, die Krise zu erklären. Und sie offenbaren die Krise der Krise: Hartmut Rosa sieht die (Corona-)Krise als Bestätigung dessen, was ihm ohnehin bereits klar war: Dass die Krise der Dauerzustand ist, schon lange die Normalität ersetzt hat. Was will man also noch sagen bzw. schreiben? Und warum soll das jemand lesen? Wer überhaupt? Jemand aus der Zukunft? Schreiben für eine ‚neue Normalität‘, wie sie heute beschworen wird?
Marlene Streeruwitz schreibt auf ihrer persönlichen Homepage darüber‚ wie „die Welt geworden“ ist, ihren selbstbewusst bis augenzwinkernd betitelten „Covid19 Roman“. Es ist nicht irgendeiner, keiner unter vielen – es ist „Der Covid19 Roman“. Darin geht es um Betty, die ihr Haus nicht verlassen kann und die von Versionen ihrer selbst und ihren Gewissensbissen heimgesucht wird. Der Roman gibt sich in der Betitelung der einzelnen Kapitel als Fortsetzungsserie aus, die bis heute (21. April 2020) eine Season mit zehn Folgen hat – wie gemacht zum Durchbingen. Dieses online verfügbare und fortgesetzte Schreiben macht zumindest ein Angebot, was den Lektüremodus in Zeiten der Coronakrise angeht: Lesen und Scrollen und Geschriebenes inhalieren, bis nichts mehr da ist. Wenn dann die Browseraktualisierung per F5-Taste kein Update mehr bringt, steht man da, alleingelassen vor so viel Gegenwart, mit der man etwas anfangen muss – wie nach einem sonntäglichen Netflix-Binge. Vor einem ähnlichen Problem (einer ähnlichen Krise?) steht auch das Schreiben in Streeruwitz’ ‚Covid19 Roman‘. Es versucht, täglich neu anzusetzen, um einer Gegenwart zu begegnen, die gerade jetzt vor einem steht. Als „Fläche. Ohne Richtungen“, wie es dort heißt. Dauert Gegenwart nur drei Sekunden oder wird sie hier flächig und erhält damit ein ganz anderes Format? Wenn die Corona-Tagebücher eines zeigen, dann, dass irgendwann der Vektor, das Koordinatensystem abhandenkommt, wenn man nicht mehr für die Zukunft schreibt oder versucht, die Gegenwart, die vor und unmittelbar hinter einem liegt, auf eine Prognose hin zu befragen. Irgendwann ist alles nur noch da. Wie eine Fläche.
„Wenn alles jetzt passiert“, so der Untertitel der deutschen Übersetzung von Douglas Rushkoffs Digitalisierungskritik Present Shock, dann kann das auch ganz ohne Akzeleration zu viel sein. Nehmen wir einmal an, die Gegenwart dauert wirklich nur drei Sekunden, dann kommt ja trotzdem direkt danach noch eine. Und noch eine und wieder eine. „I can’t stand feeling like this another second, and the seconds keep coming on and on.” So versucht Kate Gompert, eine Figur aus dem 1996 erschienenen Roman Infinite Jest von David Foster Wallace, auszudrücken, wie sich die Depression anfühlt, unter der sie leidet. Die Gegenwart prasselt auf uns ein, gerade jetzt, als Sturzregen von Sekunden (während die Tagebuchlektüre zumindest die Einsicht zu Tage gefördert hat, dass es in der Wirklichkeit schon seit Wochen nicht mehr geregnet hat). Der Vergleich mit der Depression scheint nicht allzu abwegig, so schreibt auch Marie Schmidt in der Süddeutschen Zeitung vom 16. April, Streeruwitz’ Texte handelten davon, „[w]ie sich die Gegenwart depressionsähnlich aufwölbt.“ Während Carolin Emckes Journal-Texte in der gleichen Zeitung flanierend und die Welt observierend Kreuzberg umschreiten, kommt hier die Risikogruppe zu Wort. Diejenigen, die die Wohnung nicht verlassen können und die in diesen Zeiten von… vor lauter Gegenwart nicht wissen, wohin. Das (Tagebuch-)Schreiben als therapeutische Maßnahme? Ein Schreiben, das nicht bereits im Moment des Entstehens auf Rezeption aus ist, das vielleicht sogar gar nicht um sie weiß, nur für sich schreibt, befreit von Aktualitätszwang?
Die Normalität, die Krise, die Gegenwart und wie man sie aufschreibt. Bei aller Aktualitätsforderung: Es scheint, als sei es gerade die Leere dieser Zeit, dem das Tagebuchschreiben begegnen könnte.
***
Wann bricht ein Tagebuch ab? Kann man sich dafür entscheiden aufzuhören? Die Form der täglichen Eintragung könnte prinzipiell bis zum Tod des oder der Schreibenden fortgesetzt werden. Angenommen, der Anlass der Tagebücher, die die Corona-Pandemie begleiten, ist eine dreifache Verschiebung in der Zeitwahrnehmung: Erstens ein Bruch, der ein Bewusstsein der eigenen Geschichtlichkeit eröffnet. Zweitens die konkrete Erfahrung eines Stillstands oder einer permanenten Gegenwart, ohne dass ein Danach denkbar wäre. Diese Erfahrung ist drittens begleitet von einer verstärkten Wahrnehmung insbesondere digitaler Informationsverbreitung als eine Form der Beschleunigung. Wann wäre es unter diesen Voraussetzungen Zeit, die Corona-Tagebücher wieder zu beenden?
Der Bruch in der Zeit macht je nach Perspektive entweder etwas ganz anderes sichtbar oder gerade das, was sowieso schon da war, aber nicht gesehen wurde. Beispiel für ersteres wäre das Corona-Tagebuch in 54books, dessen Anstoß die Vermutung ist, einer grundlegenden Transformation beizuwohnen: „In diesem kollektiven Tagebuch wollen wir sammeln, wie der grassierende Virus unser Leben, Vorstellungen von Gesellschaft, politische Debatten und die Sprache selbst verändert.“ Auch bei Carolin Emcke, die für die Süddeutsche Zeitung in einem „Journal“ „politische-persönliche Notizen“ aufzeichnet, findet sich die Rede von „Wörtern, deren Bedeutungen sich verschieben“. Gerade in der ersten Woche akzentuiert Emcke die zeitliche Dimension der Verschiebung: 1. durch ein Zitat aus Büchners Leonce und Lena, in dem vom Aus-der-Zeit-Gehen die Rede ist; 2. durch die Kontrastierung ewig göttlicher Gegenwart, die sich in der Musik Bachs zeige, mit den täglichen Aktualisierungen zur Lage; und 3. durch verschiedene Formulierungen, die um einen Takt und einen Rhythmus der Zeit kreisen, der wieder in Einklang mit dem individuellen Rhythmus gebracht werden müsse. Im Gegensatz dazu steht die zweite Lesart. Der Bruch wird beispielsweise von den Beschleunigungstheoretikern Armen Avanessian und Hartmut Rosa auf je unterschiedliche Weise ins Spiel gebracht, beide sehen in ihm aber eine Bestätigung dessen, was sowieso schon vorhanden war: Gerade durch diesen Bruch werden die grundlegenden Probleme der kapitalistischen Arbeits- und Lebensweise sichtbar und die Notwendigkeit der Veränderung wird umso dringlicher. Genau genommen erkennen sie eine Kontinuität in der Makroperspektive auf das politische und wirtschaftliche System, wenn auch, zumindest bei Rosa, in der Mikroperspektive des eigenen Erlebens ebenfalls der Eindruck der Entschleunigung zu dominieren scheint.
Für die Tagebücher scheint diese Kontinuität jedoch nicht denkbar. Sie gehen vom Bruch aus und stellen ihm die Regelmäßigkeit des täglichen Aufzeichnens gegenüber. Sie setzen täglich neu an und wiederholen dadurch den Bruch, während sie ihn zugleich kompensieren. Die „Normalität“, die dem Bruch vorausgeht und die Voraussetzung des Tagebuchschreibens ist, wird im regelmäßigen Takt des Schreibens wieder aufgegriffen. Die Tagebücher werden dann irrelevant, wenn wir sie vergessen können, weil wir die Regelmäßigkeit des Aufzeichnens nicht mehr als Ausnahme wahrnehmen. Wenn die Wahrnehmung der Differenz, die der Bruch ist, der Indifferenz gewichen ist.





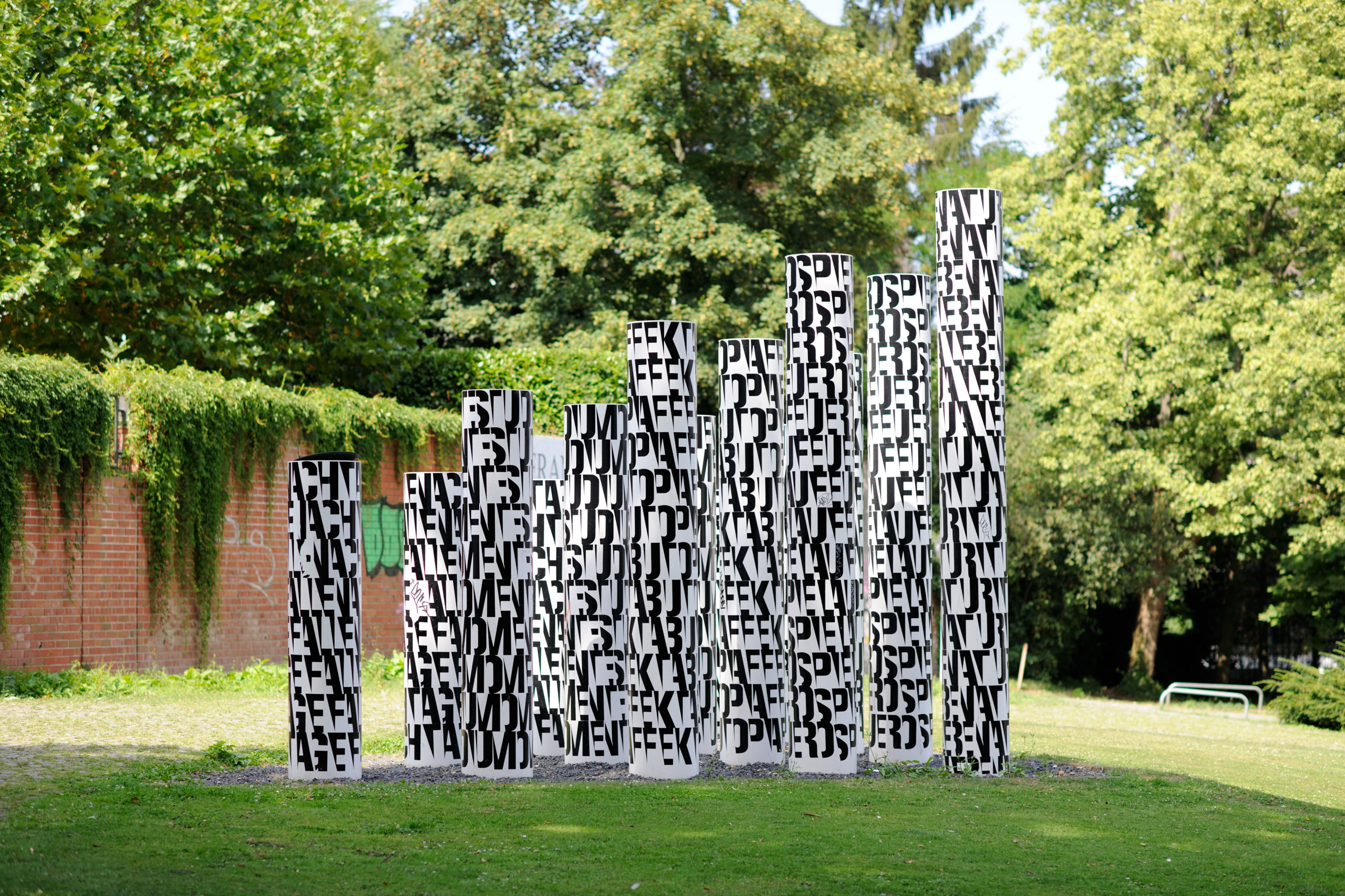

 Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.
Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.