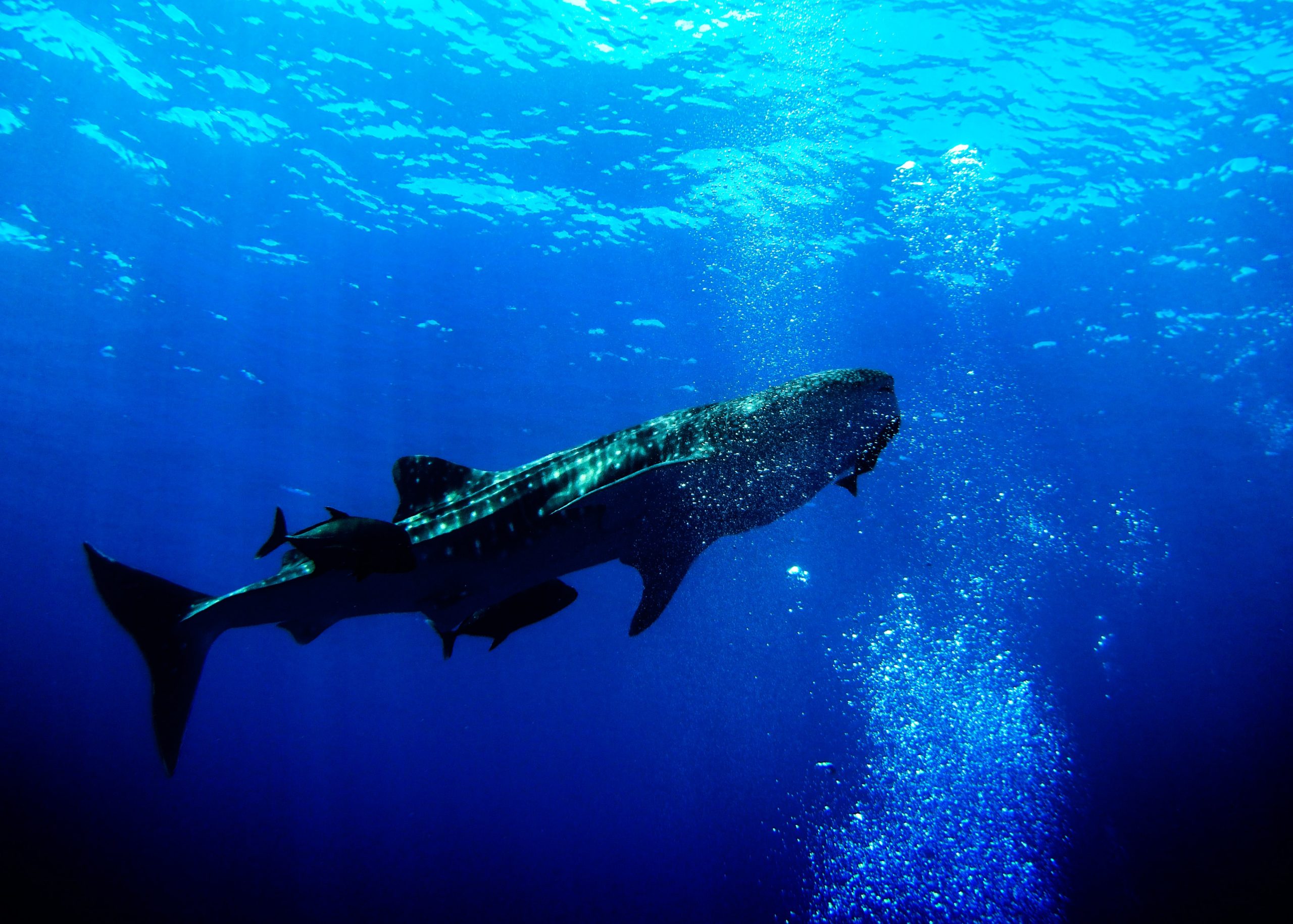Als sich am 7. Oktober 2020 auf Twitter die Nachricht vom Tode Ruth Klügers zu verbreiten begann, blickte ich auf der Plattform um mich und sah in viele aufrichtig betroffene Gesichter. Diese Gesichter musste ich nicht buchstäblich sehen, um sie wahrzunehmen, sie formten sich mittels Buchstaben, Worten, Tweets. Unter den Menschen, die da spürbar trauerten, waren auffallend viele, die wichtige Referenzpunkte in meinem persönlichen digitalen Kulturbetrieb bilden, weil sie mir Bücher empfehlen, die mir gefallen, weil sie ehrenamtliche Lektorinnen meiner Essays sind, weil sie auf Konferenzen Dinge sagen, die mich zum Denken anregen, weil ich mit ihnen gern in Verbindung bin, beruflich und privat. Mit Ruth Klüger ist offensichtlich jemand gestorben, der nicht nur für mich, sondern für Menschen im Netz, die mir wichtig sind, besondere Bedeutung hat.
In der Tagesschau am selben Abend wurde über den Tod einer anderen Person berichtet, die vor allem als Komiker bekannt geworden ist, Ruth Klügers Name wurde nicht erwähnt. Nun könnte man verschiedene mögliche Erklärungen dafür finden, warum der Tod des Komikers nachrichtenwürdig erschien, der von Ruth Klüger aber nicht, wie etwa: Die Nachricht von ihrem Tod war der Redaktion noch nicht bekannt. Wenn ich aber diese Nachricht durch den bloßen Umstand, auf Twitter zu sein, ungesucht bekommen habe, sollte eine Redaktion ebenfalls über diese Information verfügen. Eine andere mögliche Erklärung ist: Man hat sich dagegen entschieden, zu berichten, weil Klüger keine deutsche, sondern eine deutschsprachige austroamerikanische Autorin war. Auch diese Erklärung ist kaum befriedigend. Schließlich werden österreichische Autoren wie Handke und Bernhard, aber auch der tschechische Autor Kafka in Deutschland wie ein selbstverständlicher Teil der Nationalkultur behandelt, obwohl sie es faktisch nicht sind. Diese Autoren, so meine These, sind so sehr kanonisiert, dass man die Fremdanteile an ihnen gern ausblendet, um sie als Eigenes führen und fühlen zu können. Was aber die Sachlage angeht, war Ruth Klüger in Deutschland nicht weniger kanonisiert: Trägerin bedeutender Literaturpreise und des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und ihr Buch weiter leben Unterrichtsstoff an vielen deutschen Schulen. Aus mehreren Gründen taugte sie aber nicht für die beschriebene emotionale, aneignende Kanonisierung, der augenfälligste findet sich in ihrer Biografie. Ruth Klüger war eine Überlebende des Holocaust, noch dazu eine, die verweigerte, emotionalisierende Opfergeschichten zu erzählen. Von ihr konnte und kann man lernen, Gewalt nicht durch Romantisierung zu verlängern. Ihre Art des Schreibens und Sprechens war sachlich, analytisch, präzise. In Artikeln ist sie häufig als »schnoddrig« und auch »burschikos« bezeichnet worden, was, auch da, wo es liebevoll gemeint scheint, Ausdruck von Misogynie ist. Autorinnen wird kulturell tradiert und meist unbewusst unterstellt, emotional zu schreiben; tun sie es offenkundig nicht, entlaufen also der Projektion, lösen sie Unbehagen aus.
Ruth Klügers Autobiografie der Jugendzeit weiter leben [1] von 1992 ist eines der wichtigsten Bücher über die Shoa und das Erzählenmüssen des Nichtbegreifbaren. Es ist ein Buch, das trotz seiner strukturellen Paradoxie so gut funktioniert, dass man es selbst im Angesicht des furchtbaren Gegenstands gern liest, was eine herausragende ästhetische Leistung der Autorin ist. Eben, weil es, ohne dass sich der Eindruck bewussten Belehrtwerdens einstellt, Mitgefühl mit den Opfern des Holocaust auslösen und eine Vorstellung davon vermitteln kann, wieso man für die Vermeidung diskriminierender Gewalt verantwortlich ist, sollte es für immer im Lehrplan jeder deutschen Schule auf der Welt erscheinen. (Dieser Vorschlag würde am heutigen Tag in deutschen Kultusministerien vermutlich plausibler wirken, wenn der Tod der Autorin, als er am 7. Oktober bekannt wurde, in der Tagesschau der Rede wert gewesen wäre.)
Als Literaturwissenschaftlerin hat Ruth Klüger früher als andere Themen behandelt, die aktuell viel diskutiert werden, etwa Frauen lesen anders (1996), Gelesene Wirklichkeit. Fakten und Fiktionen in der Literatur (2006) und Was Frauen schreiben (2010). Nicht nur inhaltlich, auch was jargonfreies Schreiben und akademische Karriere angeht, sehen viele Frauen in ihr ein Vorbild. Hier muss aber bei aller verständlichen Identifikationsbegeisterung eine bestimmte Form respektvoller Distanz gewahrt bleiben. Es ist die gleiche Distanz, die man wahren sollte, wenn man sich als weiße cis Frau feministisch auf Audre Lorde bezieht. Um keine kulturelle Aneignung zu betreiben, muss man immer miterzählen, dass Lorde eine Schwarze und lesbische Aktivistin gewesen ist – darauf hat mich Asal Dardan einmal in einem Gespräch aufmerksam gemacht. Daher ist es wesentlich, auch Ruth Klüger nicht, indem man sich durch viele geteilte Interessen und Blickwinkel dazu hinreißen lässt, als »eine von uns« zu vereinnahmen und so das Inkommensurable des Holocaust auszublenden. Ruth Klüger hat sich mit keinem Text und auch nicht mit ihrem persönlichen Auftreten als schwesterliche Identifikationsfigur angeboten.
Man ist eher geneigt, sie mit Vokabular aus der Ästhetik des Erhabenen zu beschreiben. Auf gewohnte Weise konnte man Ruth Klüger nicht nahekommen, weil Kräfte wirkten, die weder sie noch man selbst kontrollieren konnte. Akzeptierte man aber diese Nähe mit existenziellem Abstand, stellte sich unmittelbar ein tiefes Gefühl von Achtung, Ehrfurcht und Respekt für sie und ihr Denken ein. Der erhabenen Wirkung lag dabei keinerlei geniekulthafte Selbsterhebung zugrunde. Außerordentlich war, dass Ruth Klüger Trennendes – grundsätzliche Unvereinbarkeit ebenso wie temporäre Meinungsverschiedenheiten – nicht mit Höflichkeit kaschierte. Wo es kein Wir gab, wurde es spürbar, und wenn sie etwas falsch oder unangemessen fand, sagte sie es. Eine Frau, die sich nicht die ganze Zeit entschuldigt, ist auch heute noch ungewöhnlich. In Kombination mit ihrer distanzierten Ausstrahlung hat dies auf viele Menschen wohl so irritierend gewirkt, dass man ihr das Etikett »schwierig« verpasste.
Ich habe Ruth Klüger 2011 in eben dieser Erwartung kennengelernt, auf eine schwierige Person zu treffen. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben per Mail kommunizierend ein E-Book zusammen publiziert, es war mein erstes Projekt als Verlegerin. Die Arbeit lief sehr professionell ab. Zwischendurch hatte ich einmal eine Idee, die ihr nicht gefiel, sie sagte es, ich verstand ihre Gründe, nahm von der Idee Abstand, der Rest war ein Selbstläufer.
Der Text, den wir damals als E-Book veröffentlichten, hieß Anders lesen. Bekenntnisse einer süchtigen E-Book-Leserin und darin stehen Sätze, die meine These stützen, dass »digital native« ein unsinniges Konzept und das Digitale vielmehr eine Haltung ist, die nichts mit biologischem Alter zu tun hat.
»Gelesen und geschrieben wurde aber schon vorher, jahrtausendelang, viel große Literatur und übrigens auch einige heilige Schriften. Dazu brauchte es keine Buchdeckel, sogar Papier war unnötig. Warum soll denn nun die große Tradition der Schriftlichkeit ausgerechnet von der Methode ihrer Konservierung abhängen, die sich erst am Anfang der Neuzeit durchgesetzt hat?«
Von der Agentur, die Ruth Klüger damals vertrat, wurde ich zu einem gemeinsamen Essen mit ihr eingeladen. Ich war so aufgeregt, dass ich im Verlauf des Abends meine Yves-Saint-Laurent-Tasche ins Klo fallen ließ. Trotzdem brachte ich irgendwie den Mut auf, Ruth Klüger an diesem Abend eine sehr niedliche, extrem kitschige Brosche mitzubringen und zu schenken, eine Maus mit einer Lesebrille. Es war so ein Moment, der nur entsetzlich oder großartig werden konnte. Ich hatte Glück, sie war hocherfreut.
Anlässlich der Veröffentlichung des E-Books gab es am nächsten Tag ein Bühnengespräch an der Freien Universität Berlin, bei dem Ruth Klüger einen Satz sagte, der der Buchbranche, würde sie Autorinnen zuhören, viele Buch-vs.-E-Book-Diskussionen hätte ersparen können.
»Es ist sinnlos, diese Revolution zu beklagen, sie findet einfach statt.« [2]
Während auf der Bühne eine um die 80-Jährige und eine um die 40-Jährige ihrer Begeisterung für das digitale Lesen Ausdruck verliehen, runzelte im Publikum eine um die 20-Jährige die Stirn und schwärmte wehmütig von Anstreichungen ihres Großvaters in ihr vererbten Printbüchern. Ruth Klüger und ich warfen uns tiefe Blicke zu, aufrichtig erstaunte, weil man immer wieder vergisst, dass auch junge Menschen konservativ sein können.
Beim anschließenden Essen im Restaurant fragte sie mich die üblichen Sachen, die Frauen im akademischen Rahmen einander fragen. »Kinder?« »Ja.« »Promoviert?« »Irgendwann aufgehört.« Kopfschütteln, nicht über mich, sondern über das System. Ich bat sie, mir die Geschichte mit dem übergekippten Wein zu erzählen. Ein Kollege hatte ihr, wohl weil sie zuvor auf Avancen von ihm nicht eingegangen war, hinter ihrem Rücken Antisemitismus unterstellt, was sie so empörte, dass sie ihm bei einem Universitäts-Event ein Glas Weißwein übergoss. Meine Vermutung, welcher »faule, aber gescheite Kafka-Forscher“ sich hinter S. in unterwegs verloren (2008) [3] – dort wird die Begebenheit wiedergegeben – verbarg, erwies sich als richtig. (Der reale S. war der erste Professor gewesen, von dem ich bei meinem Studienjahr in den USA hörte, dass er bei Sprechstunden die Bürotüre offen stehen lassen musste, 20 Jahre vor #metoo.) Ruth Klügers Rat, einen so dickaufgetragenen Auftritt nur einmal im Leben hinzulegen, habe ich beherzigt, er steht uns allen noch bevor. Zum Abschied sagte sie zu mir, dass ich mich erst wieder mit einem neuen Verlagsangebot bei ihr melden dürfte, wenn ich meine Dissertation abgegeben haben würde. Dies wird nun nicht mehr möglich sein. Eine befreundete Verlegerin erzählte mir, dass sie Ruth Klüger ebenfalls mal ein Projekt angetragen und diese daraufhin zurückgeschrieben hätte: »Nein danke, ich habe schon eine sehr gute E-Book-Verlegerin.«
Ruth Klüger hat erst im Alter von 60 Jahren, als sie Gastprofessorin in Göttingen war, begonnen, in deutscher Sprache zu schreiben und damit auch ihren Namen mit Deutschland zu verbinden. Am 27. Januar 2016, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, wurde den Mitgliedern des Deutschen Bundestags die Ehre zuteil, dass Ruth Klüger eine Rede vor ihnen hielt. Sie entwarf darin ein hoffnungsvolles, einen froh stimmendes Bild von Deutschland, das in den vergangenen Jahren mit dem Wiedererstarken von Nationalismus und rechter Gewalt wieder an Plausibilität verloren hat.
»Dieses Land, das vor achtzig Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, dank seiner geöffneten Grenzen und der Großherzigkeit, mit der Sie die Flut von syrischen und anderen Flüchtlingen aufgenommen haben und noch aufnehmen. Ich bin eine von den vielen Außenstehenden, die von Verwunderung zu Bewunderung übergegangen sind.« [4]
Wir sollten uns das Vertrauen von Ruth Klüger verdienen.
Die Autorin, die Literaturwissenschaftlerin, die Person Ruth Klüger hat jede Bewunderung verdient. Menschen, die sagen, dass Diskriminierungsbetroffene keine Wissenschaftler*innen sein könnten, Autobiografisches Literatur zu Boden ziehen würde und Literatur mit Haltung Ideologie wäre – sie alle werden durch sie widerlegt. Ruth Klüger ist am 6. Oktober 2020 in Irvine, Kalifornien gestorben. Ihr Name darf in Deutschland nicht vergessen werden.

[1] https://www.dtv.de/buch/ruth-klueger-weiter-leben-11950
[2] https://www.tagesspiegel.de/wissen/digital-versus-gedruckt-fu-studenten-verteidigen-das-gute-alte-buch/5831650.html
[3] https://www.dtv.de/buch/ruth-klueger-unterwegs-verloren-13913
[4] https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw04-gedenkstunde-rede-klueger-40343