Wespennest 169
JETZT NEU: Wespennest 169, „Mensch und Maschine“
Technikkritik ist eng mit dem Namen Günther Anders verknüpft. Anders unterschied zwischen prometheischem Stolz – der Erschaffung von Technik und ihre Nutzung durch den Menschen – und prometheischer Scham, dem beklemmenden Gefühl angesichts der Überlegenheit von Maschinen. In diesem Spannungsfeld loten die Texte des Schwerpunkts das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine aus, ohne in rein technikverweigernden oder technikhuldigenden Positionen zu verweilen.
 Ideengeschichtliche Entwicklungslinien in der Wahrnehmung des Menschen als Mängelwesen zeichnet Martina Heßler nach: Ihre Suche nach Mensch-Technik-Vergleichen im 20. Jahrhundert führt sie zu aktuellen Erklärungen von Fehlerhaftigkeit.
Ideengeschichtliche Entwicklungslinien in der Wahrnehmung des Menschen als Mängelwesen zeichnet Martina Heßler nach: Ihre Suche nach Mensch-Technik-Vergleichen im 20. Jahrhundert führt sie zu aktuellen Erklärungen von Fehlerhaftigkeit.
Laut Statistik spielt bei rund siebzig Prozent aller Verkehrsunfälle „menschliches Versagen“ eine ursächliche Rolle. Durchautomatisierte, bestens vernetzte Autos sollen in Zukunft Abhilfe schaffen. Der Motorjournalist David Staretz liefert eine auf das Automobil fokussierte Betrachtung menschlicher Unzulänglichkeit.
In Dietmar Daths Prosatext Leben in Kantennähe sind selbstfahrende Fahrzeuge bereits Realität und nur einer von vielen tiefgründigen gesellschaftlichen Eingriffen durch Technik. Der Autor entwirft eine post-sprachliche Scifi-Welt, in der das Verhältnis zwischen Menschen, Tieren und Maschinen in alternative Formen gefasst wird.
Welche Auswirkungen hat die zunehmende Automatisierung vieler Arbeits- und Lebensbereiche? Erwartet uns ein faires, arbeitsteiliges Zusammenleben auf höchstem technischem Niveau, in dem die ersparte Zeit für besseres Tun aufgewendet werden kann? Oder ist doch die Dystopie einer Welt realistischer, die immer weniger Menschen die Teilhabe am sozialen Leben erlaubt? Ilija Trojanow befragt Constanze Kurz und Frank Rieger zu diesen Themen.
Nicht nur in Arbeitsvorgängen wird der Mensch mehr und mehr durch Maschinen ersetzt, auch in der Sexualität finden mit der Entwicklung von interaktivem und vernetztem Sexspielzeug einschneidende Veränderungen statt: Michael Lissek diagnostiziert das Eindringen des „Pornomodus“ in unsere alltäglichen Intimbeziehungen.
Andrea Roedig spricht mit Michael Hagner über Autorschaft, Schreiben, Lesen und die Geisteswissenschaften im digitalen Zeitalter. Hagner erklärt, wie die Materialität des Buches dessen Inhalt mitbestimmt und wie Datenspeicherung als Kostenfaktor auch hinsichtlich der Digitalisierung von Büchern der Österreichischen Nationalbibliothek eine Rolle spielt. Denn: „Big brother is watching the reader.“ Und mit den gesammelten Daten über unser Leseverhalten lässt sich viel Geld verdienen.
Nicht zuletzt wurde und wird technische Entwicklung oft zu militärischen Zwecken vorangetrieben. In der „Operational Research“, einem Wissenschaftsbereich, dem sich Wolfgang Pircher in seinem Beitrag widmet, hat man während des Zweiten Weltkriegs die besten Kooperationsmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine in Luftwaffe und Marine getestet.
Angela von Rahden zieht Verbindungen zwischen Ovids Darstellungen vom ziellosen Wandel der Welt in den Metamorphosen zu den aktuellen biotechnischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Dass „Grenze“ ein relativer Begriff ist, zeigt sie anhand der Häufigkeit von Grenzpostulierungen und -überschreitungen im historischen Verlauf.
Einen Weg zwischen totaler Technikverweigerung und dem transhumanistischen Traum des optimierten Menschen eröffnet sich, so Mona Singer, in der feministischen Technikwissenschaft. Donna Haraways richtungsweisender Essay „A Cyborg Manifesto“ aus dem Jahr 1985 zeigt den Cyborg als produktive figura, die in der Lage ist, hierarchische Dichotomien wie Mann/Frau, Mensch/Tier und Mensch/Maschine zu unterwandern.
Neben diesen und weiteren Schwerpunktbeiträgen finden sich außerdem in der aktuellen Ausgabe: Alexander Pobrabinek über die Observierungstechniken des sowjetischen KGB, Hazel Rosenstrauch zum künstlerischen Selbstverständnis der jüngeren Generation und Thomas Rothschild zu Peter Henischs Roman Die kleine Figur meines Vaters. Außerdem Lyrik und Prosa von Jan Volker Röhnert, Korbinian Saltz, Lioba Happel und Ioana Pârvulescu sowie ein ausführlicher Buchbesprechungsteil unter der redaktionellen Verantwortung von Thomas Eder.

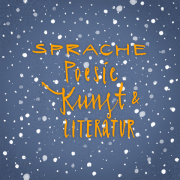
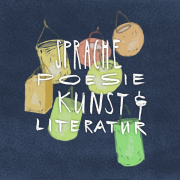
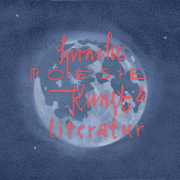
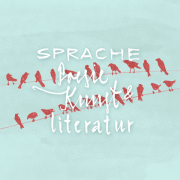
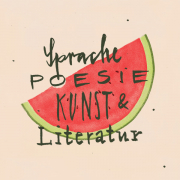
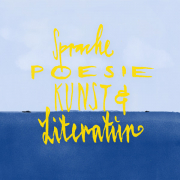
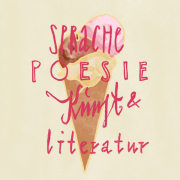

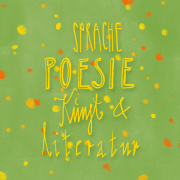
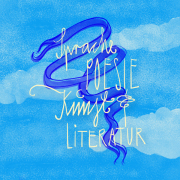
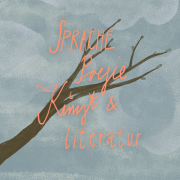
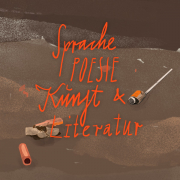
Neuen Kommentar schreiben