Es gibt wenige Autoren, die ein derart vielgestaltiges Werk hinterlassen haben wie Hugo von Hofmannsthal (1874-1929): Zarte lyrische Dramen stehen neben blutrünstigen Tragödien, Gedichte neben Filmszenarien, Moralitätenspiele neben Komödien, erfundene Gespräche neben einer großen Anzahl Essays. Die Fülle literarischer Ausdrucksformen speist sich aus einem beispiellosen Interesse am Ausprobieren unterschiedlichster Gattungen und Sprechweisen, am Durchforsten der kulturellen Überlieferung nach Spielmaterial, das sich unter der collagierenden Hand des Autors zu Werken eigener Prägung zusammenschließt.
Die unverwechselbare Physiognomie der einzelnen Werke lässt leicht übersehen, dass zwischen den einzelnen Texten ein reger Austausch an Quellen, Stoffen und Motiven bestand, wie das Œuvre überhaupt von einem Netz interner Bezüge durchzogen ist. Auch hinsichtlich ihrer Entstehung sind die Werke denkbar offen. Fast alle Werkpläne machten vielfache Metamorphosen durch und vieles blieb nach jahrelanger Arbeit schließlich als Fragment liegen. So entstand ein nach konservativen Schätzungen etwa 20.000 Seiten umfassendes Arbeitsarchiv aus Manuskripten und Notizen zu vollendeten und unvollendeten Werken sowie großen Mengen ungeordneter Zettel.
Die Kritische Hofmannsthal-Ausgabe, die seit dem Ende der sechziger Jahre im Freien Deutschen Hochstift / Frankfurter Goethe-Haus erarbeitet wird, will aus der Fülle der überlieferten Materials die Entstehung der einzelnen Werke erklären, das untergründige Netz ihrer Bezugnahmen und Verwandtschaften sichtbar machen und zugleich Einblick in den riesenhaften Nachlass des Dichters geben, ohne den das Gesamtwerk bestenfalls zur Hälfte sichtbar ist. Die Ausgabe tut dies, indem sie das Überlieferte nach Gattungen ordnet: Gedichte, Dramen, Opernlibretti, fiktive und nichtfiktive Prosa.
Wenn man Hofmannsthals schriftlichen Nachlass auf diese Weise herausgibt, bleibt am Ende auf den Schreibtischen der Editoren allerdings eine erhebliche Menge an Material zurück, das sich gegen die Einordnung in das Schema klassischer Gattungen sperrt. Dieser Bodensatz besteht aus zunächst 14 Notizbüchern und zwei Blöcken, die Hofmannsthal seit seiner frühen Jugend führte und die in der Houghton Library, Harvard University, verwahrt werden. Einige der Notizbücher sind inzwischen als Digitalisate zugänglich (siehe auf der entsprechenden Website des Website der Houghton Library unter »Journal Notebooks«). Hinzu kommt ein kaum zu übersehender Berg an losen Zetteln unterschiedlichster Provenienz. Beide Teile, die Notizbücher und die losen Zettel, die sich hinsichtlich der Textmenge ungefähr die Waage halten, enthalten die interessantesten und erstaunlichsten Dokumente zu Hofmannsthals Weltsicht.
Ein wesentlicher Teil des Gesamtkorpus, für das sich der Titel »Aufzeichnungen« durchgesetzt hat, sind Selbstzeugnisse wie Tagebuchaufzeichnungen und autobiographische Reflexionen. Hinzu kommen Lektüreverzeichnisse und eine Menge an Merkzetteln. Daneben gibt es die große Gruppe der Exzerpte, in denen Hofmannsthal für ihn bedeutsame Stellen der Weltliteratur für die Weiterverarbeitung ablegte. Andere Aufzeichnungen sind Keimzellen für künftige Werke: Motivskizzen, Aphorismen, Anekdoten sowie Reflexionen zur zeitgenössischen Literatur und zur Literaturgeschichte.
Diese unterschiedlichen Textgattungen entstanden durchaus nicht immer am heimischen Schreibtisch, sondern ebenso in der Schule, im Zug, im Bett oder im Wald, und auch die Schriftträger bezeugen die Spontaneität des Schreibimpulses: Zettel aus Notizblöcken sind ebenso darunter wie empfangene Briefe, Telegramme, Prospekte, Einladungen, Landkarten und Vorsatzblätter von Büchern. Wenn es besonders schnell gehen sollte, notierte Hofmannsthal in der Gabelsberger Kurzschrift. Man sollte meinen, die Verhältnisse in den gebundenen Notizheften seien übersichtlicher. Dies ist jedoch durchaus nicht der Fall: Hofmannsthal führte oft mehrere Hefte gleichzeitig, und er schrieb in sie hinein, wo immer der Zufall es wollte. Das konnte in der Mitte des Heftes sein, vorne oder hinten, auf leeren Seiten oder auf bereits beschriebenen.
Parallel zur chaotischen Niederschrift legte er in immerhin zwei der gebundenen Hefte Inhaltsverzeichnisse an, die das Wiederauffinden der Notizen ermöglichen sollten. Auch gibt es Querverweise und Nachträge, die deutlich machen, dass Hofmannsthal seine Aufzeichnungen immer wieder durcharbeitete. Dies geht bereits aus einem Brief Hofmannsthals an die Freundin Marie Gomperz aus dem Sommer 1892 hervor, in dem er schreibt, er blättere gerade im ›Buch mit der Kirsche‹: »[...] es steht nicht viel darin, aber für mich selbst die Anfänge von unendlichen Gedankenketten, Schlagworte, Etiquetten für Erinnerungen, Neuem, alle die gewohnten geistigen bibelots, mit denen die Köpfe von Dilettantenmenschen, wie ich bin, meubliert sind [...].«
Die Aufgabe der Editoren war es, all diese »Anfänge«, diese verstreuten Glieder eines großen Ganzen einzusammeln und sie in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Doch was ist in einem solchen Fall eine ›sinnvolle Ordnung‹? Zu dieser Frage machte der 21-jährige Hofmannsthal im Sommer 1895 selbst einen Vorschlag. Gegen Ende seiner Militärzeit und kurz vor dem gefürchteten Regimentsrennen am 11. August 1895 schrieb er an Arthur Schnitzler: »Sonntag ist das Rennen. Wenn ich an die Bretterwand hinflieg und mir das Genick brech (unwahrscheinlich, aber möglich) sollt Ihr meine vielen Notizen auf Zetteln herausgeben, in Gedankengruppen geordnet, mit einem sehr einfachen, die Associationen aufdeckenden Commentar. Denn meine Gedanken gehören alle zusammen, weil ich von der Einheit der Welt sehr stark durchdrungen bin.«
Dem Wunsch nach einem »einfachen, die Associationen aufdeckenden Commentar« kann man sich heute noch umstandslos anschließen, wobei es nach mittlerweile 100 Jahren nicht immer einfach ist, Hofmannsthals Verweise und Allusionen zu rekonstruieren. Die vorgeschlagene Ordnung des Materials nach Gedankengruppen hingegen empfiehlt sich nicht, zu umfangreich ist das Material, zu willkürlich wären die Themenbereiche. Der einzig gangbare Weg ist eine chronologische Schichtung des Überlieferten, auch wenn sie die Editoren unter den Druck stellt, für jedes Zettelchen eine Datierung angeben und rechtfertigen zu müssen. Das Material wurde also in 2138 einzelne »Aufzeichnungen« zerlegt, dann wurden diese aufgrund verschiedenster Indizien datiert und in eine zeitliche Abfolge gebracht. Auf diese Weise bietet die Edition gerade für die frühen Jahre einen kontinuierlichen Kommentar zu Hofmannsthals Leben und Schaffen, eine Art Lebenschronik in Selbstzeugnissen.
Die ersten erhaltenen Aufzeichnungen stammen aus dem Jahr 1887. Sie finden sich in einem Schulheft, in dem der dreizehnjährige Hofmannsthal seine ersten dramatischen Entwürfe niederschrieb und seine häufigen Besuche des Burgtheaters festhielt. In der Folgezeit dokumentierte er vor allem sein abundantes Lesepensum. Besonders beschäftigten Hofmannsthal in dieser Zeit die Geschichte Europas und die Entwicklung der europäischen Literatur. Er las eine ganze Reihe umfangreicher Geschichtswerke, vom Altertum bis in die Gegenwart, und wertete sie in Listen, Exzerpten und Tabellen aus. Französische, englische und italienische Autoren las er von Anfang an im Original, russische Autoren in deutscher oder französischer Übersetzung. Die Werke der klassischen Antike kannte er zum größten Teil aus griechischen und lateinischen Textausgaben.
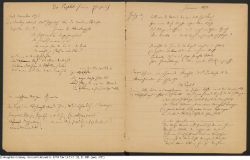

Auch Hofmannsthals problematisches Verhältnis zu Stefan George, das sich im Winter 1891/1892 zuspitzte, fand im Tagebuch seinen Niederschlag.
Aus den neunziger Jahren hat sich eine wahre Flut an Aufzeichnungen erhalten. Dieser Zustand änderte sich nach 1900 mit dem Paris-Aufenthalt, der Heirat und der Gründung eines eigenen Hausstands in Rodaun. Die Niederschriften nehmen jedoch seit dieser Zeit nicht nur ab, sie bekommen auch einen anderen Charakter. Es gibt nur noch vereinzelt Werknotizen und nur wenig biographisches Material. Auch tritt der Wille der frühen Jahre, sich alle möglichen Wissensbereiche enzyklopädisch anzueignen und das Erlernte festzuhalten, in den Hintergrund. Statt umfangreicher Exzerpte finden sich nun klar umrissene Lesefrüchte, eigene und fremde Gedankensplitter, deren Bedeutung immer auch in ihrer spezifischen sprachlichen Formung liegt. Diese Aufzeichnungen nutzte Hofmannsthal noch stärker als in früheren Zeiten für seine dichterischen und essayistischen Arbeiten. Sie sind sozusagen der Schnürboden über dem offiziellen Werk, aus dem nach Belieben Formulierungen und Motive für andere Texte bereitgestellt werden können. Das eklatanteste Beispiel ist das »Buch der Freunde« (1922), das gänzlich aus Aphorismen besteht, die Hofmannsthal in seinen Tagebüchern und auf Zetteln notierte und mit denen über Jahre hinweg, eben wie mit Freunden, in geistiger Verbindung gestanden hatte.
Herbert Steiner publizierte ab 1934 in der Zeitschrift ›Corona‹ Auszüge aus den ›Aufzeichnungen‹, 1959 legte er im S. Fischer Verlag eine erste Buchausgabe vor, die 1980 von Ingeborg Beyer-Ahlert für die von Bernd Schoeller und Rudolf Hirsch herausgegebene Taschenbuchausgabe erweitert wurde. Diese Ausgaben umfassen jedoch nur 30% des Gesamtmaterials, das nun erstmals vollständig mit kritischem Apparat und ausführlichen Erläuterungen vorliegt. Herausgeben wurden die beiden Bände von Rudolf Hirsch (1905–1996), dem langjährigen Geschäftsführer des S. Fischer Verlags und Initiator der Kritischen Ausgabe, und Ellen Ritter (1943–2011), der erfahrensten Editorin der Ausgabe. Einen Auszug aus der Edition finden Sie hier.
© Konrad Heumann
Hugo von Hofmannsthal: Aufzeichnungen. Hrsg. von Rudolf Hirsch (†) und Ellen Ritter (†) in Zusammenarbeit mit Konrad Heumann und Peter Michael Braunwarth. Redaktion: Katja Kaluga in Zusammenarbeit mit Konrad Heumann und Olivia Varwig. 2 Bände, 1047 S. (Text), 1578 S. (Erläuterungen). Frankfurt am Main 2013. (Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Bd. XXXVII/XXXVIII.)

Seit seinem 14. Lebensjahr hat Hofmannsthal kontinuierlich Eindrücke und Gedanken festgehalten, die in der Kritischen Ausgabe vollständig ediert werden. In den chronologisch geordneten Notizen finden sich persönliche Erlebnisse neben Keimzellen zu ausgeführten und verworfenen Dichtungen; es wechseln sich Reflexionen über die Aufgabe des modernen Dichters ab mit Reisediarien, Träumen oder Lese- und Titellisten, mit Exzerpten aus der gesamten Bandbreite der Weltliteratur sowie aus geschichts- und literaturwissenschaftlichen Werken. Ein ausführlicher Kommentar sowie ein Werk- und ein kommentiertes Personenregister mit über 3500 Einträgen erschließen den Text.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /