Es gibt sie, die großartigen Literaturverfilmungen – denke ich an die bildgewaltigen und mitreißenden Filme von Visconti, allen voran ›Der Leopard‹ oder ›Tod in Venedig‹, Schlöndorffs Film ›Die Blechtrommel‹ und Fassbinders Fernsehverfilmung ›Berlin Alexanderplatz‹. Man kann also nicht einmal eine Korrelation zwischen der Qualität eines Romans und der eines Films behaupten. Wer weiß, dass Antonionis befremdlicher und bezaubernder Film ›Blow up‹ frei nach der Kurzgeschichte ›Las Babas del Diabolo‹ von Cortázar entstanden ist oder Hitchcocks ›Die Vögel‹ auf der Kurzgeschichte ›The Birds‹ von Daphne du Maurier beruht? Die Kunst der Filmschaffenden ist es, ihre Infektion durch die Literatur, die Atmosphäre einer literarischen Geschichte und ihre Begeisterung für einen Stoff zur Anregung und Befruchtung ihrer subjektiven Schöpfungskraft zu nehmen.
Wer Literatur und Film liebt, wer das Theater kennt – und den Prozess vom literarischen Text zur Inszenierung so gut kennt, wie ich es mir einbilde zu tun –, ist bei der Nachricht, jemand wolle ein Stück oder einen Film aus einem Roman, einer Geschichte machen, zerrissen zwischen Angst und Freude. Vor allem Neugier entfachten alle bisherigen Versuche in mir. Einer meiner Romane, ›Liebediener‹, wurde in den letzten fünfzehn Jahren schon zweimal für mehrere Jahre optioniert, weil Filmproduzenten, Regisseure, Drehbuchautoren einen Film daraus machen wollten. Aus unterschiedlichen Gründen gaben sie ihr Vorhaben nach mehrjährigen Entwicklungsversuchen auf. Je größer der Erfolg eines Romans, umso leidenschaftlicher nicht nur die Lust, daraus einen Film zu machen – auch die Angst, oder nennen wir es Respekt, von Regisseuren und Produzenten wächst gewaltig. Vielleicht gibt es Romane, die von ihrem Lesepublikum so leidenschaftlich und geradezu intim geliebt werden, dass jede Verfilmung nur scheitern kann. Verhielt es sich mit dem ›Parfum‹ so? Eifersüchtig verurteilen Kinozuschauer später jeden Darsteller, wenn sie sich beim Lesen diesen und jenen Helden doch ganz und gar anders vorgestellt hatten, sie vermissen ihre innere Bildwelt und intime Beziehung zum Romangeschehen, sobald dieses in expliziten und ihnen vollkommen fremden Bildern auf der Leinwand erscheint.
Leicht ist es also nicht, einen Roman zu verfilmen. Es gehört nicht nur Lust oder Infektion dazu, auch Chuzpe, ein sprühender Mut und im Zweifel Eigensinn – sich an ganz entscheidenden Punkten unbedingt von der literarischen Vorlage wie auch von Zuflüsterern und mächtigen Finanziers und klugen wie streitbaren Ratgebern dezidiert zu befreien, um filmisch die innere Vision zu verdichten.
Als vor über zehn Jahren Barbara Buhl vom WDR und mit ihr die Produzentin Katrin Schlösser auf den Verlag und mich zukamen, weil sie meinen Roman ›Lagerfeuer‹ verfilmen wollten, konnte niemand ahnen, dass dieser Film zehn Jahre Entwicklungszeit und unendlich viele Hürden würde nehmen müssen. Im ersten Jahr schrieb ich auf Wunsch der Produzenten die ersten Drehbuchfassungen selbst. Wie aber sollte ich mich von meiner Architektur trennen? Von den vier Stimmen, die den Roman erzählen – den vielen kleinen, tragischen und manchmal auch hochkomischen Vignetten, von denen dieser Roman lebt? Dem spannungsvollen Wechsel zwischen Handlung, innerer Beobachtung meiner Erzählstimmen und manchen Dialogen, die deutlich machen, wie wenig vom Spürbaren und Vorhandenen überhaupt nur in Dialogen landet – wie manchmal gegensätzlich zu dem, was beispielsweise Hans denkt, das ist, was er dann zu Nelly sagt. Es gibt ein literarisches Denken und etliche Gestaltungsmöglichkeiten, die Film so nicht abbilden kann – Bildevokationen, die Film nicht auslösen kann. Aber Film kann anders erzählen und wo er gelingt, ist er nicht weniger wahrhaftig.
Im Wissen, dass ich im Januar 2005 gemeinsam mit meinen noch kleinen Kindern für ein Jahr in die Villa Massimo gehen und dort an einem neuen Roman (›Die Mittagsfrau‹) arbeiten wollte, beschloss ich Ende 2004 die Drehbucharbeit abzugeben. Der Prozess des Drehbuchschreibens war so unfassbar zeitraubend und zermürbend. Und dabei erschien mir meine Arbeit immer nur fast an die Wünsche der Redakteure und Produzenten heranzureichen. Sie erhofften sich eine Umarbeitung des vielstimmigen Romans auf eine einzelne Hauptfigur (Nelly) und eine spannende Dramaturgie. Wo ein gewisser Tiefensog im Roman aus Worten entsteht und selbst Warten zu einer geradezu komischen Hochspannung führen kann, braucht der Film eine ganz eigene Vorlage und funktioniert nach scheinbar mathematischen Gesetzen. Keines dieser Gesetze habe ich je gelernt. Ich war nie in meinem Leben in einer Schreibschule, einem Schreibkurs oder an einer Drehbuchakademie. Alles, was ich kann, ist, Bilder aus meinem Inneren in Worte fassen – Stimmen entwickeln – Geschichten, Romane schreiben. Und so fuhr ich nach Rom, lebte mich dort ein und begann mit der ›Mittagsfrau‹, während es für ›Lagerfeuer‹ etliche Veränderungen geben sollte. Neue Drehbuchautoren kamen und gingen und schließlich, noch ehe sein Film ›Novemberkind‹ das öffentliche Licht erblickte, erhielt ich von einem Filmstudenten namens Christian Schwochow eine E-Mail, in der er sich als verehrender Leser meines Romans bekannte und sich nach den Entwicklungen des Filmvorhabens erkundigte.
Auch wenn ich im Folgenden einige Drehbuchfassungen las, Kritik übte, wie auch meiner Freude an neuen dramatischen Wendungen und Umwandlungen Ausdruck gab, die Drehbuchautorin Heide Schwochow und den Regisseur Christian mal im Flüchtlingslager Berlin-Marienfelde zur Recherche traf und sie auch einmal mit einem Familienfreund zusammenbrachte, der als Wissenschaftler sowohl die DDR als auch die Unterwanderung der Forschung durch die Stasi sehr einschneidend erlebt hatte und beschreiben konnte – so achtete ich doch immer wieder auf eine gewisse Distanz. Erst diese Distanz, so glaube ich, macht es dem Neuen und Eigenen eines Filmemachers möglich, Raum und Gestalt zu gewinnen. Ich wollte keine Abfilmung meiner inneren Bilder, keine banale Illustration meines Romans – worauf ich neugierig war, war ein Wiederentdecken im anderen Medium.
Etwa beschreibe ich Nelly in meinem Roman zwar als stolze und um Würde ringende, aber ebenso als unsichere Frau, die äußerlich an das Aschenputtel aus ›Drei Nüsse für Aschenbrödel‹ erinnert, dunkelhaarig, mädchenhaft und noch sehr jung, Ende zwanzig, mit zwei Schulkindern, abgeschlossenem Studium und bereits Arbeitserfahrung in der DDR. Jördis Triebel ist rein äußerlich eine vollkommen andere Besetzung als es meinem inneren Bild entsprochen hätte. Und doch muss ich Christian und seinem sicheren Gespür in der Wahl für Jördis Triebel große Bewunderung schenken. Wer weiß, ob eine der filigranen jüngeren Schauspielerinnen jemals diese Verletzbarkeit und Stärke, jene Verzweiflung und Zartheit, Not und Schönheit – jenes Kämpfen um Würde hätte spielen können. Jördis Triebel ist eine atemberaubende Schauspielerin – und ihre Film-Nelly eine vollkommen ebenbürtige Schwester meiner Roman-Nelly.
Begeistert bin ich auch von Tristan Göbel, der Nellys Sohn Aleksej spielt, eine große Entdeckung. Gäbe es Filmpreise für Kinder – die es zum Glück nicht gibt –, so müsste er ihn wohl in diesem Jahr davontragen. Und was für eine Entdeckung für das deutsche Kino wird Anja Antonowicz sein, diese schöne aus Polen stammende Schauspielerin – die in gewisser Weise etwas wie eine vollkommen eigene und junge Variante der Krystyna im Buch verkörpert. Vielleicht teilen sie nur noch den Namen – aber man vergisst das schnell, wenn man dieser feenhaften Antonowicz zusieht. Und wie Jacky Ido meinen zweifelhaften und anziehenden John Bird spielt, das ist großartig. Hans Pischke ist mit Alexander Scheer geradezu genial besetzt, selbst wenn ihm im Film manche neurotische Szene aus dem Roman vorenthalten bleibt, ahnt der Zuschauer sofort, dass der Riss dieses Mannes nicht nur durch seine Welt, sondern durch sein ganzes Dasein verläuft.
Es sind die Nahaufnahmen und bisweilen schwindelerregenden Kameraführungen, die eine eigene Poesie entfalten – ja, etwas wie einen flechtengrünen Grundton in diesem Film zum eigenständigen Motiv machen.
Und zuletzt möchte ich die Filmmusik hervorheben. Wie häufig nerven uns Filmmusiken, erklären uns das Sichtbare und bevormunden unsere Seelenklaviatur. Die Musik in ›Westen‹, komponiert von Lorenz Dangel ist ein sehr seltener Glücksfall, da sie mit einer geradezu luftigen Neugier die Enge der Bilder kontrastiert und darin auf seltsame Weise verschärft.
Dass ich selbst einen winzigen Auftritt in dem Film erhielt, als Angestellte des französischen Geheimdienstes, die Nelly während ihrer Aufnahmeprozedur befragt, entsprang wohl gegenseitiger Neugier – wie würde ich im Film und der Film in mir sein? Als Tochter einer Schauspielerin und eines Regisseurs und unter Theater- und Filmleuten aufgewachsen, gibt es wohl kaum einen Prozess beim Drehen eines Films, der mir nicht vertraut wäre. Auch habe ich als Kind und junge Frau hin und wieder Kleinstrollen in Filmen übernommen.
Es wunderte mich nicht, dass aus Gründen der Förderung und Finanzierung der Film in Nordrhein-Westfalen gedreht wurde. Mehr als von den vielen Kameras und langen Wartezeiten am Set war ich von der Natur fasziniert, die sich diesen asphaltierten Ort, eine ehemalige Kaserne, zurückgewann. Die Architektur der 50er Jahre im Osten und Westen Deutschlands ähneln sich so sehr, dass die Verlegung des Drehortes der wahrhaftigen Anmutung des Lagers überhaupt nicht schadete.
Dem Film geschieht etwas ähnlich Kurioses wie meinem Roman damals: Über beide wird felsenfest kolportiert, es sei eine »DDR-Geschichte« und dazu ein »autobiographischer« Roman. Diese Kolportagen zeugen von einer mehr als oberflächlichen Wahrnehmung – denn beides ist falsch. Der Roman spielt mitten im Westen. Er handelt von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in die Bundesrepublik kommen. Während Hans im Osten in der politischen Opposition agiert hat, im Gefängnis war, reklamiert Nelly ganz entschieden ein Recht auf das Private. Sie möchte sich nicht politisch vereinnahmen lassen, nicht im Osten und auch nicht im Westen, weder als Informantin noch als Sprachrohr, und auch das Etikett »politischer Flüchtling«, mit dem mancher Vorteil verbunden wäre, ist ihr zutiefst suspekt. ›Lagerfeuer‹ spielt in einem Flüchtlingslager, derer es bis heute viele in unserem Land gibt. Während in den 60er bis 80er Jahren die Flüchtlinge in Deutschland vor allem aus Osteuropa, dem sogenannten Ostblock und auch der DDR kamen, wurden dieselben Lager zwischenzeitlich für Spätaussiedler wie auch für die Kriegsflüchtlinge aus dem Balkan und werden sie heute für Flüchtlinge aus Afghanistan, Irak, Iran, Syrien und anderen armen Ländern der Welt genutzt. Mein Roman zeigt am Beispiel unterschiedlicher Lebenswege und der damaligen Zeit, Ende der 70er Jahre, mit welcher Großzügigkeit, manchmal aber auch grotesken Borniertheit und Bürokratie unser westliches Deutschland Wohlstand, Glück und Aufnahme verwalten. In dieser Bürokratie brechen sich Stolz und Würde, Herkunft und Identität von Flüchtlingen. Die Flüchtlinge stranden oft für Monate und Jahre in einem Wartesaal, den man vielleicht eher als Bahnhof bezeichnen muss, da kaum jemand während des Wartens an demselben Ort geborgen wäre – allein die individuellen wie offiziellen Bedingungen für die Asylanträge verändern sich innerhalb der Wartezeit. Wir wundern uns heute, warum so wenige gut ausgebildete Flüchtlinge und Immigranten nach Deutschland kommen. Ein Roman wie ›Lagerfeuer‹ und mit ihm auch der Film ›Westen‹ erzählen etwas davon. Mit unserem Bürokratiewahn wie auch mitunter Despektierlichkeit und Ignoranz gegenüber verfolgten, flüchtigen und armen Menschen heißen wir diese Menschen nicht willkommen. Wie viele Immigranten, die in ihren früheren Leben Akademiker waren, fahren in Deutschland Taxi und arbeiten im Imbiss oder als Putzhilfe? Wie leicht erkennen wir Ausbildung und Berufserfahrung von Immigranten an, wie gerne vermieten wir ihnen Wohnungen, wie sehr interessiert uns ihre Herkunft?
Und wäre ›Lagerfeuer‹ ein autobiographischer Roman gewesen, welche Figur darin sollte ich sein? Tatsächlich kenne ich das Lager und die Ungewissheit einer solchen Transitsituation aus jenen Monaten, in denen meine Mutter mit ihren damals vier Töchtern im Flüchtlingslager Berlin-Marienfelde lebte. Es war ein Lager mitten im Westen. Es ist die Enge, der Dreck, die Ungewissheit und Abscheu wie auch daraus wachsende Isolation, Alimentierung, Zuteilung von Nahrung und Wäsche mit wachsendem Schamgefühl und einem Verdacht gegen sich selbst, in etwas wie Unmündigkeit hineinzugeraten – das ist die Basis, auf der man als Flüchtling in Deutschland lebt –, für die sich jeder Flüchtling schämt, die er ein Leben lang versucht, von seiner äußeren Erscheinung abzukratzen und zu leugnen. Wer möchte schon gern als ein bemitleidenswerter Mensch wahrgenommen werden, ein dreckiger Nutznießer, ein verfolgter und ängstlich angespannt um Anerkennung, Aufnahme wie auch Privatsphäre und Integrität kämpfender Mensch? Meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen im Flüchtlingslager haben mich für dieses Thema sensibilisiert. Und dennoch glaube ich, dass bis heute das Wegsehen und die Abscheu vor Flüchtlingen enorm hoch ist. Ein paar linke Berufsjugendliche, wie es dann im journalistischen Jargon heißt, solidarisieren sich in Kreuzberg mit den folkloristisch vor Kameras gezerrten Menschen. Wer aber war schon einmal im Inneren eines solchen Zeltes? Wer geht dorthin und bietet einem der Flüchtlinge einen Job an, ein Dach über dem Kopf? Wer fragt nach ihrer Sehnsucht, ihrer Angst, ihrer Liebe?
Dass die Menschen im Westen über die Reichweite und Intensität geheimdienstlicher Abhörtätigkeiten nicht nur empört, sondern allen Ernstes erstaunt sind, zeugt von einer sonderbaren Ausblendung historischer und politischer Erfahrung. Wir alle, die wir den Wandel der weltpolitischen Verhältnisse, die Kriege, den Kalten Krieg und seine Mauer kennenlernen mussten, sollten wissen, wie sich die Geschichte geheimdienstlicher Tätigkeiten in Westeuropa im Verlauf der letzten hundert Jahre entwickelt hat– jenseits vom glamourösen James Bond.
Mein Roman ›Lagerfeuer‹ wie jetzt auch in seiner Verfilmung ›Westen‹ erzählt, wie sich das Treiben und Wesen der Geheimdienste, die von ihnen beiläufig wie auch gezielt ausgelöste Verunsicherung, das Misstrauen und Verfolgtsein auf den Einzelnen, seine Integrität und Würde auswirkt. Darin ist der Roman nicht einfach nur historisch, sondern im weitesten Sinn zeitlos und aktuell.
Wo der Roman ›Lagerfeuer‹ in manchen Winkeln vielleicht strenger und dabei härter auf das Beklemmende und Ungewisse schaut, der Roman tatsächlich in einem befreienden wie zerstörenden Feuer endet, einer Szene mit äußerst tragischer wie komischer Wucht, entscheidet sich der Film ›Westen‹ am Ende für eine stille, optimistische und hoffnungsfrohe Perspektive. Verrät der Film damit den Tenor des Romans? Ich glaube nicht. Eher verhält er sich ähnlich stolz wie Nelly: Blick/ Roman – Gegenblick/ Film – was dem einen zum Verhängnis wird und als Scheitern erscheint, gewährt dem anderen Neuanfang und Hoffnung.
Wer Literatur und Film liebt, wer das Theater kennt – und den Prozess vom literarischen Text zur Inszenierung so gut kennt, wie ich es mir einbilde zu tun –, ist bei der Nachricht, jemand wolle ein Stück oder einen Film aus einem Roman, einer Geschichte machen, zerrissen zwischen Angst und Freude. Vor allem Neugier entfachten alle bisherigen Versuche in mir. Einer meiner Romane, ›Liebediener‹, wurde in den letzten fünfzehn Jahren schon zweimal für mehrere Jahre optioniert, weil Filmproduzenten, Regisseure, Drehbuchautoren einen Film daraus machen wollten. Aus unterschiedlichen Gründen gaben sie ihr Vorhaben nach mehrjährigen Entwicklungsversuchen auf. Je größer der Erfolg eines Romans, umso leidenschaftlicher nicht nur die Lust, daraus einen Film zu machen – auch die Angst, oder nennen wir es Respekt, von Regisseuren und Produzenten wächst gewaltig. Vielleicht gibt es Romane, die von ihrem Lesepublikum so leidenschaftlich und geradezu intim geliebt werden, dass jede Verfilmung nur scheitern kann. Verhielt es sich mit dem ›Parfum‹ so? Eifersüchtig verurteilen Kinozuschauer später jeden Darsteller, wenn sie sich beim Lesen diesen und jenen Helden doch ganz und gar anders vorgestellt hatten, sie vermissen ihre innere Bildwelt und intime Beziehung zum Romangeschehen, sobald dieses in expliziten und ihnen vollkommen fremden Bildern auf der Leinwand erscheint.
Leicht ist es also nicht, einen Roman zu verfilmen. Es gehört nicht nur Lust oder Infektion dazu, auch Chuzpe, ein sprühender Mut und im Zweifel Eigensinn – sich an ganz entscheidenden Punkten unbedingt von der literarischen Vorlage wie auch von Zuflüsterern und mächtigen Finanziers und klugen wie streitbaren Ratgebern dezidiert zu befreien, um filmisch die innere Vision zu verdichten.
Als vor über zehn Jahren Barbara Buhl vom WDR und mit ihr die Produzentin Katrin Schlösser auf den Verlag und mich zukamen, weil sie meinen Roman ›Lagerfeuer‹ verfilmen wollten, konnte niemand ahnen, dass dieser Film zehn Jahre Entwicklungszeit und unendlich viele Hürden würde nehmen müssen. Im ersten Jahr schrieb ich auf Wunsch der Produzenten die ersten Drehbuchfassungen selbst. Wie aber sollte ich mich von meiner Architektur trennen? Von den vier Stimmen, die den Roman erzählen – den vielen kleinen, tragischen und manchmal auch hochkomischen Vignetten, von denen dieser Roman lebt? Dem spannungsvollen Wechsel zwischen Handlung, innerer Beobachtung meiner Erzählstimmen und manchen Dialogen, die deutlich machen, wie wenig vom Spürbaren und Vorhandenen überhaupt nur in Dialogen landet – wie manchmal gegensätzlich zu dem, was beispielsweise Hans denkt, das ist, was er dann zu Nelly sagt. Es gibt ein literarisches Denken und etliche Gestaltungsmöglichkeiten, die Film so nicht abbilden kann – Bildevokationen, die Film nicht auslösen kann. Aber Film kann anders erzählen und wo er gelingt, ist er nicht weniger wahrhaftig.
Im Wissen, dass ich im Januar 2005 gemeinsam mit meinen noch kleinen Kindern für ein Jahr in die Villa Massimo gehen und dort an einem neuen Roman (›Die Mittagsfrau‹) arbeiten wollte, beschloss ich Ende 2004 die Drehbucharbeit abzugeben. Der Prozess des Drehbuchschreibens war so unfassbar zeitraubend und zermürbend. Und dabei erschien mir meine Arbeit immer nur fast an die Wünsche der Redakteure und Produzenten heranzureichen. Sie erhofften sich eine Umarbeitung des vielstimmigen Romans auf eine einzelne Hauptfigur (Nelly) und eine spannende Dramaturgie. Wo ein gewisser Tiefensog im Roman aus Worten entsteht und selbst Warten zu einer geradezu komischen Hochspannung führen kann, braucht der Film eine ganz eigene Vorlage und funktioniert nach scheinbar mathematischen Gesetzen. Keines dieser Gesetze habe ich je gelernt. Ich war nie in meinem Leben in einer Schreibschule, einem Schreibkurs oder an einer Drehbuchakademie. Alles, was ich kann, ist, Bilder aus meinem Inneren in Worte fassen – Stimmen entwickeln – Geschichten, Romane schreiben. Und so fuhr ich nach Rom, lebte mich dort ein und begann mit der ›Mittagsfrau‹, während es für ›Lagerfeuer‹ etliche Veränderungen geben sollte. Neue Drehbuchautoren kamen und gingen und schließlich, noch ehe sein Film ›Novemberkind‹ das öffentliche Licht erblickte, erhielt ich von einem Filmstudenten namens Christian Schwochow eine E-Mail, in der er sich als verehrender Leser meines Romans bekannte und sich nach den Entwicklungen des Filmvorhabens erkundigte.
Auch wenn ich im Folgenden einige Drehbuchfassungen las, Kritik übte, wie auch meiner Freude an neuen dramatischen Wendungen und Umwandlungen Ausdruck gab, die Drehbuchautorin Heide Schwochow und den Regisseur Christian mal im Flüchtlingslager Berlin-Marienfelde zur Recherche traf und sie auch einmal mit einem Familienfreund zusammenbrachte, der als Wissenschaftler sowohl die DDR als auch die Unterwanderung der Forschung durch die Stasi sehr einschneidend erlebt hatte und beschreiben konnte – so achtete ich doch immer wieder auf eine gewisse Distanz. Erst diese Distanz, so glaube ich, macht es dem Neuen und Eigenen eines Filmemachers möglich, Raum und Gestalt zu gewinnen. Ich wollte keine Abfilmung meiner inneren Bilder, keine banale Illustration meines Romans – worauf ich neugierig war, war ein Wiederentdecken im anderen Medium.
Etwa beschreibe ich Nelly in meinem Roman zwar als stolze und um Würde ringende, aber ebenso als unsichere Frau, die äußerlich an das Aschenputtel aus ›Drei Nüsse für Aschenbrödel‹ erinnert, dunkelhaarig, mädchenhaft und noch sehr jung, Ende zwanzig, mit zwei Schulkindern, abgeschlossenem Studium und bereits Arbeitserfahrung in der DDR. Jördis Triebel ist rein äußerlich eine vollkommen andere Besetzung als es meinem inneren Bild entsprochen hätte. Und doch muss ich Christian und seinem sicheren Gespür in der Wahl für Jördis Triebel große Bewunderung schenken. Wer weiß, ob eine der filigranen jüngeren Schauspielerinnen jemals diese Verletzbarkeit und Stärke, jene Verzweiflung und Zartheit, Not und Schönheit – jenes Kämpfen um Würde hätte spielen können. Jördis Triebel ist eine atemberaubende Schauspielerin – und ihre Film-Nelly eine vollkommen ebenbürtige Schwester meiner Roman-Nelly.
Begeistert bin ich auch von Tristan Göbel, der Nellys Sohn Aleksej spielt, eine große Entdeckung. Gäbe es Filmpreise für Kinder – die es zum Glück nicht gibt –, so müsste er ihn wohl in diesem Jahr davontragen. Und was für eine Entdeckung für das deutsche Kino wird Anja Antonowicz sein, diese schöne aus Polen stammende Schauspielerin – die in gewisser Weise etwas wie eine vollkommen eigene und junge Variante der Krystyna im Buch verkörpert. Vielleicht teilen sie nur noch den Namen – aber man vergisst das schnell, wenn man dieser feenhaften Antonowicz zusieht. Und wie Jacky Ido meinen zweifelhaften und anziehenden John Bird spielt, das ist großartig. Hans Pischke ist mit Alexander Scheer geradezu genial besetzt, selbst wenn ihm im Film manche neurotische Szene aus dem Roman vorenthalten bleibt, ahnt der Zuschauer sofort, dass der Riss dieses Mannes nicht nur durch seine Welt, sondern durch sein ganzes Dasein verläuft.
Es sind die Nahaufnahmen und bisweilen schwindelerregenden Kameraführungen, die eine eigene Poesie entfalten – ja, etwas wie einen flechtengrünen Grundton in diesem Film zum eigenständigen Motiv machen.
Und zuletzt möchte ich die Filmmusik hervorheben. Wie häufig nerven uns Filmmusiken, erklären uns das Sichtbare und bevormunden unsere Seelenklaviatur. Die Musik in ›Westen‹, komponiert von Lorenz Dangel ist ein sehr seltener Glücksfall, da sie mit einer geradezu luftigen Neugier die Enge der Bilder kontrastiert und darin auf seltsame Weise verschärft.
Dass ich selbst einen winzigen Auftritt in dem Film erhielt, als Angestellte des französischen Geheimdienstes, die Nelly während ihrer Aufnahmeprozedur befragt, entsprang wohl gegenseitiger Neugier – wie würde ich im Film und der Film in mir sein? Als Tochter einer Schauspielerin und eines Regisseurs und unter Theater- und Filmleuten aufgewachsen, gibt es wohl kaum einen Prozess beim Drehen eines Films, der mir nicht vertraut wäre. Auch habe ich als Kind und junge Frau hin und wieder Kleinstrollen in Filmen übernommen.
Es wunderte mich nicht, dass aus Gründen der Förderung und Finanzierung der Film in Nordrhein-Westfalen gedreht wurde. Mehr als von den vielen Kameras und langen Wartezeiten am Set war ich von der Natur fasziniert, die sich diesen asphaltierten Ort, eine ehemalige Kaserne, zurückgewann. Die Architektur der 50er Jahre im Osten und Westen Deutschlands ähneln sich so sehr, dass die Verlegung des Drehortes der wahrhaftigen Anmutung des Lagers überhaupt nicht schadete.
Dem Film geschieht etwas ähnlich Kurioses wie meinem Roman damals: Über beide wird felsenfest kolportiert, es sei eine »DDR-Geschichte« und dazu ein »autobiographischer« Roman. Diese Kolportagen zeugen von einer mehr als oberflächlichen Wahrnehmung – denn beides ist falsch. Der Roman spielt mitten im Westen. Er handelt von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in die Bundesrepublik kommen. Während Hans im Osten in der politischen Opposition agiert hat, im Gefängnis war, reklamiert Nelly ganz entschieden ein Recht auf das Private. Sie möchte sich nicht politisch vereinnahmen lassen, nicht im Osten und auch nicht im Westen, weder als Informantin noch als Sprachrohr, und auch das Etikett »politischer Flüchtling«, mit dem mancher Vorteil verbunden wäre, ist ihr zutiefst suspekt. ›Lagerfeuer‹ spielt in einem Flüchtlingslager, derer es bis heute viele in unserem Land gibt. Während in den 60er bis 80er Jahren die Flüchtlinge in Deutschland vor allem aus Osteuropa, dem sogenannten Ostblock und auch der DDR kamen, wurden dieselben Lager zwischenzeitlich für Spätaussiedler wie auch für die Kriegsflüchtlinge aus dem Balkan und werden sie heute für Flüchtlinge aus Afghanistan, Irak, Iran, Syrien und anderen armen Ländern der Welt genutzt. Mein Roman zeigt am Beispiel unterschiedlicher Lebenswege und der damaligen Zeit, Ende der 70er Jahre, mit welcher Großzügigkeit, manchmal aber auch grotesken Borniertheit und Bürokratie unser westliches Deutschland Wohlstand, Glück und Aufnahme verwalten. In dieser Bürokratie brechen sich Stolz und Würde, Herkunft und Identität von Flüchtlingen. Die Flüchtlinge stranden oft für Monate und Jahre in einem Wartesaal, den man vielleicht eher als Bahnhof bezeichnen muss, da kaum jemand während des Wartens an demselben Ort geborgen wäre – allein die individuellen wie offiziellen Bedingungen für die Asylanträge verändern sich innerhalb der Wartezeit. Wir wundern uns heute, warum so wenige gut ausgebildete Flüchtlinge und Immigranten nach Deutschland kommen. Ein Roman wie ›Lagerfeuer‹ und mit ihm auch der Film ›Westen‹ erzählen etwas davon. Mit unserem Bürokratiewahn wie auch mitunter Despektierlichkeit und Ignoranz gegenüber verfolgten, flüchtigen und armen Menschen heißen wir diese Menschen nicht willkommen. Wie viele Immigranten, die in ihren früheren Leben Akademiker waren, fahren in Deutschland Taxi und arbeiten im Imbiss oder als Putzhilfe? Wie leicht erkennen wir Ausbildung und Berufserfahrung von Immigranten an, wie gerne vermieten wir ihnen Wohnungen, wie sehr interessiert uns ihre Herkunft?
Und wäre ›Lagerfeuer‹ ein autobiographischer Roman gewesen, welche Figur darin sollte ich sein? Tatsächlich kenne ich das Lager und die Ungewissheit einer solchen Transitsituation aus jenen Monaten, in denen meine Mutter mit ihren damals vier Töchtern im Flüchtlingslager Berlin-Marienfelde lebte. Es war ein Lager mitten im Westen. Es ist die Enge, der Dreck, die Ungewissheit und Abscheu wie auch daraus wachsende Isolation, Alimentierung, Zuteilung von Nahrung und Wäsche mit wachsendem Schamgefühl und einem Verdacht gegen sich selbst, in etwas wie Unmündigkeit hineinzugeraten – das ist die Basis, auf der man als Flüchtling in Deutschland lebt –, für die sich jeder Flüchtling schämt, die er ein Leben lang versucht, von seiner äußeren Erscheinung abzukratzen und zu leugnen. Wer möchte schon gern als ein bemitleidenswerter Mensch wahrgenommen werden, ein dreckiger Nutznießer, ein verfolgter und ängstlich angespannt um Anerkennung, Aufnahme wie auch Privatsphäre und Integrität kämpfender Mensch? Meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen im Flüchtlingslager haben mich für dieses Thema sensibilisiert. Und dennoch glaube ich, dass bis heute das Wegsehen und die Abscheu vor Flüchtlingen enorm hoch ist. Ein paar linke Berufsjugendliche, wie es dann im journalistischen Jargon heißt, solidarisieren sich in Kreuzberg mit den folkloristisch vor Kameras gezerrten Menschen. Wer aber war schon einmal im Inneren eines solchen Zeltes? Wer geht dorthin und bietet einem der Flüchtlinge einen Job an, ein Dach über dem Kopf? Wer fragt nach ihrer Sehnsucht, ihrer Angst, ihrer Liebe?
Dass die Menschen im Westen über die Reichweite und Intensität geheimdienstlicher Abhörtätigkeiten nicht nur empört, sondern allen Ernstes erstaunt sind, zeugt von einer sonderbaren Ausblendung historischer und politischer Erfahrung. Wir alle, die wir den Wandel der weltpolitischen Verhältnisse, die Kriege, den Kalten Krieg und seine Mauer kennenlernen mussten, sollten wissen, wie sich die Geschichte geheimdienstlicher Tätigkeiten in Westeuropa im Verlauf der letzten hundert Jahre entwickelt hat– jenseits vom glamourösen James Bond.
Mein Roman ›Lagerfeuer‹ wie jetzt auch in seiner Verfilmung ›Westen‹ erzählt, wie sich das Treiben und Wesen der Geheimdienste, die von ihnen beiläufig wie auch gezielt ausgelöste Verunsicherung, das Misstrauen und Verfolgtsein auf den Einzelnen, seine Integrität und Würde auswirkt. Darin ist der Roman nicht einfach nur historisch, sondern im weitesten Sinn zeitlos und aktuell.
Wo der Roman ›Lagerfeuer‹ in manchen Winkeln vielleicht strenger und dabei härter auf das Beklemmende und Ungewisse schaut, der Roman tatsächlich in einem befreienden wie zerstörenden Feuer endet, einer Szene mit äußerst tragischer wie komischer Wucht, entscheidet sich der Film ›Westen‹ am Ende für eine stille, optimistische und hoffnungsfrohe Perspektive. Verrät der Film damit den Tenor des Romans? Ich glaube nicht. Eher verhält er sich ähnlich stolz wie Nelly: Blick/ Roman – Gegenblick/ Film – was dem einen zum Verhängnis wird und als Scheitern erscheint, gewährt dem anderen Neuanfang und Hoffnung.
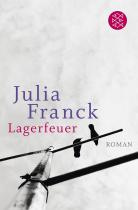
Lagerfeuer
Ende der siebziger Jahre hat Nelly Senff endlich die Tortur der Ausreise hinter sich und kann mit ihren Kindern Ostberlin verlassen. Nun ist sie drüben, aber drüben heißt zunächst das Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde. Julia Franck erzählt von vier Menschen an einem Ort der Ungewissheit und des Übergangs, dort, wo sich Lebensgeschichten entscheiden.
»Ein Glücksfall: ›Lagerfeuer‹ ist ein ganz bemerkenswerter Roman.«
Thomas Brussig






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /