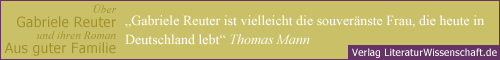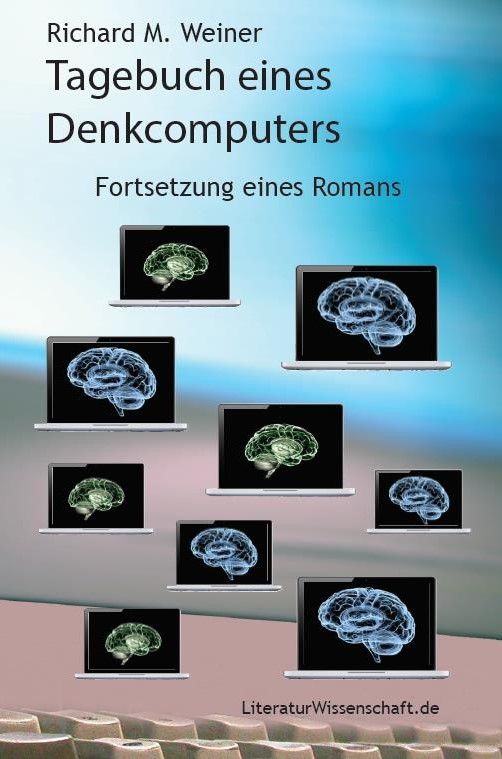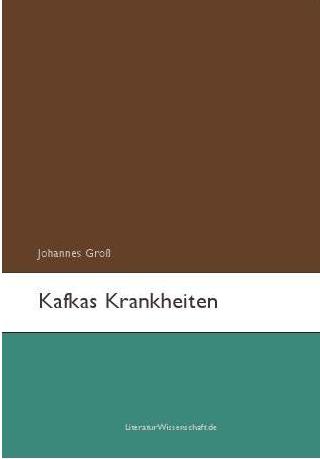Inhaltsverzeichnis der Ausgabe Nr. 10, Oktober 2015
Einheit, Heimat, Messe
Zur Oktober-Ausgabe 2015
Von Thomas Anz
25 Jahre deutsche Einheit
Vorbemerkungen zum Themenschwerpunkt
Von Stefan Jäger
Von einem kleinem Land
Gedanken zu 25 Jahren Wiedervereinigung
Von H.-Georg Lützenkirchen
Mauerfall-, Post-DDR-, Vereinigungs-, Nachwende- oder doch Wendeliteratur?
Eine kleine Expedition durch einen großen Begriffsdschungel
Von Sonja Kersten
Weiterleben in einer fremd gewordenen Welt
‚Implizite‘ und ‚explizite‘ Migrationen in der Literatur nach der ‚Wende‘
Von Frank Thomas Grub
Literarische Wenden und Kehrtwenden
Feldexperimente in der deutsch-deutschen Gegenwartsprosa
Von Carmen Ulrich
Catching the Wind of Change
Der Post-DDR-Roman als Medium des kulturellen Gedächtnisses 25 Jahre nach der Deutschen Einheit
Von Yun-Chu Cho
Die Fremde in Büchern erfahren
Ein Interview mit Axel Dunker, Leiter des Instituts für Kulturwissenschaftliche Deutschlandstudien der Universität Bremen, zum Phänomen der DDR-Reiseliteratur
Von Axel Dunker und Linda Maeding
Ähnliche Probleme und Herausforderungen
Die Wiedervereinigung Deutschlands aus polnischer Sicht
Von Elzbieta Tomasi-Kapral
Hoffnungen, Ängste, Missverständnisse
Wie sich deutschsprachige Schriftsteller zur Solidarność in Polen äußerten
Von Marion Brandt
Wende im Tal der Ahnungslosen
Peter Richters „89/90“ blendet zurück in die Zeit, in der Deutschland wieder eins wurde
Von Dietmar Jacobsen
Robotron oder Apple?
Wiedervereinigung ausgefallen: Harald Martenstein und Tom Peuckert erzählen in „Schwarzes Gold aus Warnemünde“ eine etwas andere Geschichte der DDR
Von Stefan Jäger
Piss-in in Westberlin
In seinem nachgelassenen Roman „Narrenreise“ erzählt Sigmar Schollak vom Kampf eines Einzelnen gegen die Berliner Mauer
Von Dietmar Jacobsen
Zwickern mit Lotti, Trudi und Leni
Ocke Bandixen hat mit „Große Fahne West“ einen Roman zur deutschen Wiedervereinigung aus Sicht eines jungen Nordfriesen geschrieben
Von Sonja Kersten
Zerstörte Hoffnungen
Burga Kalinowski befragt in ihrem Interviewband ehemalige DDR-Bewohner zu Wende und Wiedervereinigung
Von Stefan Jäger
Mehr als die Frage nach Nutella oder Nudossi
„Sind wir ein Volk?“: Thea Dorn, Jana Hensel und Thomas Brussig diskutieren 25 Jahre nach dem Mauerfall über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West
Von Sandra Vlasta
Doswidanja DDR
Der Fotograf Joachim Liebe hat den Abzug der sowjetischen Streitkräfte begleitet
Von Manfred Orlick
Aufstieg und Fall einer ‚liberalerenʻ DDR-Kultur
Zu Gunnar Deckers etwas überbordenden Studie zu 1965 als Schicksalsjahr für die Entwicklung von Literatur und Kunst in der Deutschen Demokratischen Republik
Von Stefan Elit
Der Seufzer der Charlotte Janka
Eine engagierte Sammlung von Erinnerungen und Lebenszeugnissen erinnert an den Antifaschisten, Buchmenschen, Exilverleger und Spanienkämpfer Walter Janka
Von Volker Strebel
Der zweite Band von „Literatur ohne Land“ beschäftigt sich mit „Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland“
Heimaträume und Gefühle
Hinweise zur Wiederkehr eines verpönten Begriffs, zu einem sich ausweitenden Forschungsfeld und zum zweiten Themenschwerpunkt dieser Ausgabe
Von Thomas Anz
Die DDR war weniger ein Land als eine Zeit
Zumutungen der Heimat in Monika Marons Werken
Von Olga Hinojosa
Heimat und Fremde in Christoph Heins Roman „Landnahme“
Vertriebene und Einheimische kämpfen in einer Kleinstadt der DDR gegenseitig um Macht
Von Mario Saalbach
„Phantomschmerz im Erinnern“ bei Herta Müller
Heimat als konstruierter und dekonstruierter Raum
Von Garbiñe Iztueta
„Dieses Land kann mich kreuzweise“
Emotion und Raum bei der Gestaltung von Heimat als „Seltsame Materie“ in Erzählungen Terézia Moras
Von Carme Bescansa
Literaturnobelpreis 2015 für Swetlana Alexijewitsch: aus dem Archiv von literaturkritik.de
Ein Mysterium
Wer erhält den Nobelpreis für Literatur? Etwa zehn Prozent aller Literaturnobelpreise gingen bisher an Frauen
Von Simone Frieling
Die Short- und Longlist des Deutschen Buchpreises 2015
Heimatlos und ertrunken in einem Meer aus Akten
Jenny Erpenbeck widmet sich mit der Flüchtlingsproblematik in ihrem Roman „Gehen, ging, gegangen“ einem brandaktuellen Thema
Von Stefan Jäger
Uneingelöste Versprechen
Ulrich Peltzers Roman „Das bessere Leben“ ist eine Horrorfahrt in die Abgründe unserer globalisierten Welt
Von Dietmar Jacobsen
Die Ehe als verantwortungsbewusstes Schicksal
Monique Schwitter hinterfragt in ihrem Roman „Eins im Andern“ die Praktikabilität moderner Paarbeziehungen zwischen Erinnerung, Mythos und Fluchtimpulsen
Von Raphaela Braun
Eine Rückkehr ins Nichts
Rolf Lapperts Roman „Über den Winter“
Von Martin Schönemann
Sex and the Königshof
Inger-Maria Mahlkes Roman „Wie Ihr wollt“ ist nur zum Teil gelungen – lesen kann man ihn trotzdem
Von Romy Traeber
Nicht nur Lippenbekenntnisse
Ilija Trojanow erzählt in seinem neuen Roman von „Macht und Widerstand“ in Bulgarien
Von Stefan Tuczek
Entwurf für eine Religion der Liebe
Ralph Dutli folgt in „Die Liebenden von Mantua“ den Spuren und Schatten eines kulturgeschichtlichen Mythos mit den Mitteln des Essayismus
Von Beat Mazenauer
Leben in einer untergegangenen Welt
In ihrem Roman „Baba Dunjas letzte Liebe“ erzählt Alina Bronsky die märchenhafte Geschichte eines Dorfes mitten im Sperrgebiet um Tschernobyl
Von Dietmar Jacobsen
Ein buntes Sammelsurium
Vladimir Vertlibs Roman „Lucia Binar und die russische Seele“ bietet ein humoristisches und kurzweiliges Lesevergnügen
Von Silke Schwaiger
Mutterseelenallein
Anke Stelling ergründet in ihrem dritten Roman „Bodentiefe Fenster“ Vergangenheit und Zukunft einer Idee
Von Britta Caspers
Vergebliche Liebesmüh
Karl-Heinz Otts satirischer Familienroman „Die Auferstehung“
Von Albert Eibl
Ein kongenialer Künstler-Roman
Über Ralph Dutlis „Soutines letzte Fahrt“
Von Anton Philipp Knittel
Die Armen von Berlin
Eva Ruth Wemmes Geschichten über Roma in der Bundeshauptstadt
Von Markus Steinmayr
Tod, wo ist dein Stachel?
Die Figuren in Christoph Poschenrieders neuem Roman „Mauersegler“ wagen einen heiter-humorvollen Umgang mit dem Lebensende
Von Bernhard Walcher
Staubtrocken
Ludwig Felsʼ Roman „Die Hottentottenwerft“ liest sich wie ein Feldzugbericht
Von Julian Gärtner
Funkenflug wie Sternenstaub
In Bea Diekers erstem Roman wird das „Vaterhaus“ zum Hauptdarsteller
Von Thorsten Schulte
Die Kälte, die Stille und der Schnee
Carolina Schuttis rätselhafte Novelle „Eulen fliegen lautlos“ über eine gefährdete Existenz
Von Eva Unterhuber
Offene Wunden
Volker Demuths ambitionierter Roman „Stille Leben“ kreist um Leben, Kunst und Tod
Von Anton Philipp Knittel
Von Freud leben
In Wilfried Steiners Roman „Die Anatomie der Träume“ geht es wie in den beiden Vorgängern um Kunst
Von Anton Philipp Knittel
Das Genie als hilfloser Greis
Peter Härtlings anrührender Roman „Verdi“
Von Peter Mohr
Nonkonformismus
Tatjana M. Popovic hat Rosa Mayreders Novelle „Sonderlinge“ unter dem Titel „Traugott Wendelin“ neu herausgegeben
Von Rolf Löchel
Literarische Einblicke in eine bewegte Epoche
Die Wiederentdeckung von Erich Kästners Erzählungen
Von Erhard Jöst
Klassiker in neuem Gewand
Zur von Gerd Eversberg herausgegebenen Leseausgabe des „Schimmelreiters“
Von Miriam Strieder
Meister der sprachlichen Verknappung
Zum 80. Geburtstag des Schriftstellers Hans Joachim Schädlich
Von Peter Mohr
Zum Tod von Hellmuth Karasek
Erinnerungen und Dank an einen Freund – geschrieben aus Anlass seines 70. Geburtstags
Von Marcel Reich-Ranicki
Zum Tod von Henning Mankell: aus dem Archiv von literaturkritik.de
Auf dem Wege sein
Zum Tod des tschechischen Philosophen und Pädagogen Radim Palouš
Von Volker Strebel
Hitzkopf in kalter Umgebung
Das Tagebuch des jungen Arthur Conan Doyle über eine arktische Reise
Von Wieland Schwanebeck
Ein bewegtes Leben und ein vielfältiges Œuvre
Zwei Neuerscheinungen befassen sich mit Leben und Werk Ruth Landshoff-Yorks, eine weitere versammelt ihre Feuilletons aus der Weimarer Republik
Von Rolf Löchel
Verdichtung und Wahrheit
Das „schwarze Heft“ von Edith Jacobson als Dokument der Psychoanalyse und des Widerstands
Von Bernd Schneid
Eine gut geheizte Hölle
Hermann Hesses Briefe aus den Krisenjahren 1916 bis 1923
Von Stefan Höppner
Memoiren eines Augenmenschen
Michael Ballhaus schreibt mit „Bilder im Kopf“ seine Autobiographie
Von Philipp Schmerheim
„Warte ab, was kleben bleibt“
Jonathan Franzen behandelt in „Unschuld“ zeitgenössische Archetypen und sehnt sich immer noch nach dem 19. Jahrhundert
Von Sascha Seiler
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Im dritten Band seines Romanzyklus „Das Büro“ arbeitet J.J. Voskuil das unglückliche Bewusstsein seines Helden schärfer heraus
Von Beat Mazenauer
Der Kryptograf
Mai Jias Roman „Das verhängnisvolle Talent des Herrn Rong“ führt in die Welt der Zahlencodes und zu einem tragischen Helden
Von Dietmar Jacobsen
Babys mit Psychose
Ryû Murakamis Buch „Coin Locker Babys“ entfacht ein trashig-brutales Endzeitspektakel im Japan der Bubble-Phase
Von Lisette Gebhardt
Wie im Fieber
Samanta Schweblins Roman „Das Gift“ ist eine furchterregende Momentaufnahme
Von Simone Sauer-Kretschmer
Die Urmutter des Cyberpunk
Der zweite Band von James Tiptree jr.’s Science-Fiction-Erzählungen wartet mit einigen Klassikern des Genres auf
Von Rolf Löchel
Leben und Sterben in Charkiw
Serhij Zhadan porträtiert in seinem Buch „Mesopotamien“ eine Stadt und ihre Menschen
Von Daniel Henseler
Mein Alzheimer-Ich
In ihrem Tagebuchroman „Einfach unvergesslich“ beschreibt Rowan Coleman fiktive Erinnerungen einer demenzkranken Frau
Von Malte Völk
Ein nur bedingt gelungenes Experiment
Der italienische Lyriker Luigi Trucillo gibt mit „Die Geometrie der Liebe“ sein Romandebüt
Von Martin Gaiser
Friedhelm Rathjen hat ein Lieblingsbuch Arno Schmidts übersetzt und herausgegeben
Mord und Bücherdiebstahl in einer der wertvollsten Büchersammlungen Europas
Donna Leon schickt in „Tod zwischen den Zeilen“ ihren Kult-Commissario Brunetti in die 23. Dienstrunde
Von Barbara Tumfart
Es geht umʼs Ganze
Mit „Killer Instinct“ beendet Howard Linskey seine Gangstersaga aus dem englischen Nordosten
Von Dietmar Jacobsen
Chinoiserien
Clementine Skorpil versucht sich in „Gefallene Blüten“ an einem Sittenbild des vorkommunistischen China
Von Walter Delabar
Reichlich
„Bad Fucking“ soll ein Krimi sein, wenngleich ein satirischer. Er läuft Kurt Palm allerdings aus dem Ruder
Von Walter Delabar
Alles ist vermint
Andrea Štaka zeigt in „CURE“ die psychischen Dimensionen des Jugoslawienkriegs
Von Emily Jeuckens
„My Dubrovnik-Fiction“ – Die Regisseurin Andrea Štaka im Interview
„CURE – Das Leben einer Anderen“ gehörte zu den anspruchsvollsten Beiträgen des 11. Festival des Deutschen Films
Von Emily Jeuckens
„Das Lumpenproletariat verbündet sich!“
Andreas Pieper setzt in „Nachspielzeit“ auf Klischees statt auf Fußball
Von Maren Poppe
Altern ist nichts für Feiglinge
‚Liebe im Alter’ im neuen Deutschen Film
Von Corinna Hess
Ein Literaturpreis feiert seinen 20. Geburtstag
Ein von Carsten Gansel herausgegebener Band versammelt die Dankesreden und Laudationes der Gewinner des Uwe-Johnson-Preises
Von Céline Letawe
Angekommen im Olymp der Klassiker
Heiner Müller wird die Ehre einer vorzüglichen Bibliographie zuteil
Von Bastian Reinert
Herzzeitsprünge
Ein Sammelband zu Ingeborg Bachmanns und Paul Celans Briefwechsel zwischen Poesie und Poetologie
Von Bastian Reinert
Dasselbe in Grün?
Ein von Martin Schierbaum und Sven Kramer herausgegebener Sammelband widmet sich dem Ecocriticism und der Rolle der Natur in der Literatur
Von Simone Schröder
Es war einmal …. Es wird einmal …
Ein Sammelband über „Das Neue Erzählen“ erkundet die schöne neue Welt der nicht nur filmischen Narration
Von Walter Delabar
Die akkulturierten Exilanten
Said El Mtouni sucht bei drei Exil-Autoren nach den Bedingungen ihrer erfolgreichen Akkulturation
Von Bozena Anna Badura
Erotische Grapheme und sinnliche Lesearchipele stehen im Fokus neuerer Schreibforschung
Zu Werner Fulds Monografie „Eine Geschichte des sinnlichen Schreibens“ und dem von Urs Büttner, Mario Gotterbarm und anderen herausgegebenen Sammelband „Diesseits des Virtuellen. Handschrift im 20. und 21. Jahrhundert“
Von Marie-Luise Wünsche
Helden in Texten und Bildern
Ein Horen-Band zum Nibelungenlied – zusammengestellt von Detlef Goller und Nora Gomringer
Von Sabine Gruber
Mittelalterrezeptionen und mehr
Eine Festschrift zu Joachim Behrs 65. Geburtstag berichtet von Heiligen, Rittern und Narren
Von Claudia Schumacher
Aus dem Elfenbeinturm in die Welt
Mit Karl Suso Frank spielend leicht alles über fast zwei Jahrtausende christliches Mönchtum hören
Von Jürgen Wolf
Deutschordensforschung: Zum Stand der Dinge
Marcus Wüst legt eine Arbeit zum Selbstverständnis des Deutschen Ordens vor
Von Ralf G. Päsler
Islamische Philosophie im Mittelalter
Ein Handbuch von Heidrun Eichner, Matthias Perkams und Christian Schäfer
Von Carmen Ulrich
Quelle der Inspiration
Viola Hildebrand-Schat zeigt, wie sich heutige Künstler beim Versuch der Entschlüsselung ungelöster Welträtsel von mittelalterlichen Weltchroniken und Stundenbüchern inspirieren lassen
Von Barbara Beisinghoff
Gesundheit geht durch den Magen
Erträge einer interdisziplinären Tagung zum Verhältnis von Diätetik und Kulinarik im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
Von Elena Parina
Literarische Verwandlungen
Peter Hvilshøj Andersen-Vinilandicus und Barbara Lafond-Kettlitz fragen nach der kulturhistorischen Bedeutung der Rezeptionsliteratur für die Frühe Neuzeit (1400‒1750)
Von Nina Hahne
Marcel Reich-Ranickis deutsche Literatur seit 1945 – herausgegeben von Thomas Anz
Wulf Segebrecht interpretiert in dem Band „Der Blumengarten“ sechzig deutsche Gedichte vom Barock bis zur Gegenwart
Alexander Jakovljević untersucht „Schillers Geschichtsdenken“
Empathische Medien
Oder warum es bei Vernetzung um das große Gefühl geht
Von Daniela Otto
Traum und Kunst – Traum als Kunst
Zu einer ästhetischen ‚Beziehungsgeschichte‘ in Literatur, Film und bildender Kunst
Von Bastian Reinert
Landlust versus Großstadtsehnsucht
Stefan Rehm spürt in der Weimarer Republik der Großstadteuphorie der Moderne und den Wurzeln der parallel aufkommenden Rückzugsfantasien aufs Land nach
Von Silke Hoklas
Als das Kino noch Rebell war
Ioana Crăciun enthüllt, wie das Weimarer Kino systematisch bürgerliche Werte und Normen infrage stellte
Von Silke Hoklas
Wie JunggesellInnen zu geschiedenen Leuten werden
Monika Wienforts „Geschichte der Ehe seit der Romantik“ bietet etliche Informationen und einige Schwächen
Von Rolf Löchel
Keine ästhetischen Niemandsländer
Der Buchgestalter und Typograph Friedrich Forssman widmet sich in „Wie ich Bücher gestalte“ der Ästhetik des Buches
Von Katja Hachenberg
Das Verbrechen namens Ornament
Adolf Loos‘ „Gesammelte Schriften“ zeigen die Konsequenz und Bissigkeit, mit der er gegen die Faulheit der Geschmacklosigkeit zu Felde zog
Von Walter Delabar
Am Übergang zur Moderne
Über Dieter Eisentrauts „Manets neue Kleider“
Von Moritz Senarclens de Grancy
Carla Dauven-van Knippenberg, Christian Moser und Rolf Parr (unter Mitarbeit von Anna Seidl) geben Band zu kulturellen Konstruktionen von Räumen heraus
The Idea of Europe – Ein Dialog über George Steiners neues Buch
Übersetzt von Alina Timofte
Von Costica Bradatan und Robert Zaretsky
Kulturen der Gewalt
Dierk Walter analysiert Wesen und Erscheinungsformen des „Imperialkrieges“
Von Jens Flemming
Kaum mehr als ein Steinbruch
Johannes Dillinger trägt Material zur „Uchronie“ zusammen
Von Patrick Wichmann
Wer ist für 9/11 verantwortlich?
Karl Hepfer geht Verschwörungstheorien mit philosophischen Mitteln auf den Grund
Von Sebastian Schmitt
Von Kunja und reiks
Eike Faber beschäftigt sich in seinem Buch „Von Ulfila bis Rekkared“ mit den Goten und deren Christentum
Von Martin Meier
Philosophie der Grenzsituation
Samuel Scheffler untersucht in „Der Tod und das Leben danach“, was ,uns‘ im Angesicht des universellen Todes noch wichtig ist
Von Max Beck
Wie Feuer und Wasser
Olaf L. Müller wirft ein neues Licht auf den Streit zwischen Newton und Goethe um die Farben
Von Galina Hristeva
Vom Lieben und Lesen
Angelika Krebs entwirft in „Zwischen Ich und Du“ eine Philosophie der dialogischen Liebe
Von Rolf Löchel
Sichtbar im Licht des Späteren
Ein von Sandra Markewitz herausgegebener Sammelband widmet sich der „Philosophie der Sprache im Vormärz“
Von Sebastian Schreull
Was wäre ein selbstbestimmtes Leben?
Michael Pauen und Harald Welzer verteidigen den Mut, sich seiner eigenen Autonomie zu bedienen
Von Gunnar Kaiser
Brückenbau durch Austausch
Im Sammelband „Der moderne Glaube an die Menschenwürde“ widmen sich Vertreter verschiedener Disziplinen dem Theoretiker Hans Joas und dessen nachidealistischem Konzept der „Sakralität der Person“
Von Sebastian Meißner
|