|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Tauchfahrt in die Innereien
des Krieges Der Fundamentalkatholik, Erzchauvinist, Preußenhasser und Exzentriker Léon Bloy (1846 – 1917) ist in Deutschland aus nachvollziehbaren Gründen nicht allzu präsent. Matthes & Seitz hat nun, mal wieder, einen schön gestalteten Band vorgelegt, mit dem Bloys hiesige Präsenz um ein wichtiges Werk erweitert wird. »Blutschweiß«, 1893 erschienen, thematisiert in 30 konzentrierten Erzählungen den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 als apokalyptischen Schrecken, als Vorboten der österlichen Ankunft »des Heiligen Geistes«. Untrennbar werden Phantasien, medientaugliche Gräuel und (vermutlich) reale Ereignisse vermischt, um den Beweis zu führen, dass Gott und Frankreich eins sind, während die Deutschen als gottlose Hunnen, als Geißel Gottes das gelobte Land heimsuchen. »Aber wenn Frankreich leidet, dann ist es Gott, der leidet, dann ist es der schreckliche Gott, der für die ganze Welt agonisiert, indem er BLUT SCHWITZT.« Das ist selbst für alte Kämpfer starker Tobak, der nicht auf historischem, sondern heilsgeschichtlichem Boden gewachsen ist. Léon Bloy findet in dieser Identitätslogik eine groß angelegte Metapher, die das durch und durch Böse zwischen Hieronymus Bosch und Quentin Tarantino so patriotisch wie narzisstisch in den christlichen Heilsplan einbindet. Leitmotivisch gilt für diesen bizarren Erzählcluster, der auf den apokalyptischen (Schlamm)Spuren des Joachim von Fiore durch den Morast der Kriegshölle wandelt, die alte christliche Konvertierungslogik: Je schrecklicher die Verhältnisse jetzt, desto großartiger wird das Reich des Herrn sein. »Es ist merkwürdig genug, dass man sich durch die furchtbarsten Gegensätze eine Vorstellung machen kann von dem, was die Ewigkeit ist«, deutete Kierkegaard dieses christliche Heilsmuster und theologische Kognitionsinstrument. Was der Philosophie und ihrer Unterabteilung »Ethik« längst nicht mehr gelang, die Rechtfertigung der patriotischen Abschlachtung, leistet bei Léon Bloy die Theologie.
Insofern schert sich Léon Bloy nicht um Kriegswahrheiten, sondern instrumentiert als bellizistischer Wüterich jenseits der Geschmacksgrenzen, was an Widerlichkeiten, Gülle aus den Köpfen und Körpern quillt. Die Schrecken des Krieges werden in einigen rauschhaften Geschichten Bloys so weit getrieben, dass er das Genre wechselt und mühelos Horror-Erzählungen präsentiert, die auch von H.P.Lovecraft stammen könnten. Dessen berühmte Erzählung »Pickmans Modell« über einen Maler, der aus äußerst finsteren Gründen erstaunlich realistische Monster malen kann, gesellt sich Bloys »Haus der Teufel« ebenbürtig zu, in dem ein wirklich schlechter Maler, ein »demoliteur« anständiger Malerei so schreckliche Bilder schafft, dass siebzig deutsche Soldaten im Angesicht des erhabenen Horrors sterben. Nebenbei ist das eine amüsante Idee eines Künstlers, der sein Nichtkönnen so entsublimiert, dass – in dieser paradoxen Wendung - der sublime Schrecken real werden kann wie in Goyas dunklen Bildern der Spätzeit. Der Renouveau catholique verinnerlicht, dass die Neuzeit an das Mark seiner Veranstaltung geht, was nur in der Rückbesinnung auf grenzenlosen Narzissmus, Realitäts- und Wissenschaftsverzicht aufgehalten werden kann. Im Blick auf Léon Bloy stellen Béla Grunberger und Pierre Dessuant die rhetorische Frage: »Wenn der Mensch dazu neigt, Gott zu sein; wenn er Gott in sich enthält, wenn er von Gott ausgeht – warum sollte er sich dann dem logischen Denken unterordnen, dieser gleichsam fleischlichen Hervorbringung seines Geistes, die ihn in die Endlichkeit zurückwerfen würde?« Um diese Hintergründe besser zu verstehen, hilft der hervorragende biografische Essay des Bloy-Spezialisten Alexander Pschera weiter, den zarter besaitete Gemüter vielleicht vorab lesen sollten, um nicht alle Hoffnung fahren zu lassen, wenn sie in die Kreise dieser Hölle eintreten. Erst in dieser luziden Darstellung zur Kontextualisierung des vorliegenden Werks im Denken des Dichters werden das literarische Monstrum »Blutschweiß« und Bloys Selbstversuch der »imitatio christi« rekonstruierbar.
Léon
Bloy ist – biografisch betrachtet - das psychosoziale Musterbeispiel eines »underdogs«,
der am Rand der Gesellschaft zu lange vergeblich Akzeptanz suchte, die er doch
in seinem narzisstischen Selbstverständnis verdiente. Seine ökonomische
Erfolglosigkeit, Familientragödien, die ständige Existenz am Rande des Minimums
bis zum Hunger bestimmen seine Hasspolitik. Hier hilft – wie so oft - nur noch
der Herrgott, der einen zugleich in diesem tiefsten Leiden »de profundis« adelt.
»Blutschweiß« ist eine verzweifelte Theodizee, weil nur noch eine Theodizee den
Wahnsinn retten kann. In die von Jung C. G beschriebene symbiotische Beziehung
zwischen Gott und dem narzisstischen Menschen schließt Léon Bloy Frankreich mit
ein: Die neue heilige Dreifaltigkeit heißt Gott, Narziss und Vaterland. Die
Darstellung des malträtierten Frankreichs ist zugleich eine Selbstbeschreibung,
die auf höherer Ebene den so tief in der Niederlage enttäuschten Patriotismus in
ein eschatologisches Geschichtsbild aufhebt. Alle diese Fäden laufen im
mytho-theo-poetischen Text zusammen, dem einzigen Ort, wo die paralogische
Harmonisierung des Wahnsinns mit der göttlichen Vorsehung gelingt. »Blutschweiß«
ist das Psychogramm eines Dichters, für den man reklamieren darf, dass seine
spätmoderne Geworfenheit ihn im wahrsten Wortsinne den immer flüchtigeren Gott
mit Macht entdecken ließ, was paradigmatisch für viele Gottsuchen und
Konversionen jener Zeit steht. Es repräsentiert aber zugleich einen nicht von
Léon Bloy erfundenen unglaublichen Pragmatismus religiöser Welterklärung, jedes
Schicksal, jede Kontingenz, jeden Irrsinn in einer Konstruktion zu salvieren, in
der alles ad maiorem dei gloriam geschieht – weil anders das Rettende
nicht zu finden ist. |
Léon Bloy |
|||
|
|
|||||

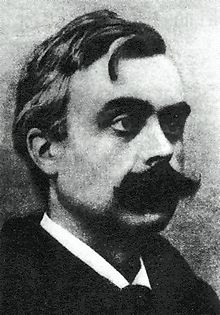 Léon
Bloy folgt literarisch expressiv den Spuren der schwarzen Poeten und Romantiker,
dem Marquis de Sade, Titus Andronicus und unzähligen anderen Brüdern und
Schwestern des Blutschweiß-Ordens. Matthes & Seitz lässt es auch ein wenig
buchkünstlerisch krachen, wenn etwa bereits rote Seitenzahlen signalisieren,
dass hier im Erregungsmodus von Blut, Schweiß und Tränen erzählt wird. Für die
ästhetische Aufrüstung des blutigen Autoren hat der Verlag die Künstlerin Heidi
Sill verpflichtet, die sich im Blick auf den Zyklus »Cuts« wohl auf bildhafte
Verletzungen versteht. Die vorliegenden Zeichnungen illustrieren allerdings
nicht den Schrecken, sondern sublimieren den »Blutschweiß« zu mehr oder minder
abstrakten Spuren, die mitunter etwas dekorativ geraten. Am überzeugendsten sind
die Arbeiten, die dem sadomasochistischen Katholizismus Bloys in blutroten
Fetischformen nachspüren. Léon Bloy selbst ergeht sich erzähltechnisch in
kinotauglichen Splatter- und Gore-Phantasien, die so drastisch wie widerlich in
der Erzählung »Der Schlamm« ausgereizt werden. Eine agonisierende Menge steckt
im Schlamm, was an mysophilen Ekelfantasien kaum zu übertreffen ist und bei
diversen christlichen Mystikern als »Gottesdienst« entsublimierter
Widerwärtigkeiten bekannt ist.
Léon
Bloy folgt literarisch expressiv den Spuren der schwarzen Poeten und Romantiker,
dem Marquis de Sade, Titus Andronicus und unzähligen anderen Brüdern und
Schwestern des Blutschweiß-Ordens. Matthes & Seitz lässt es auch ein wenig
buchkünstlerisch krachen, wenn etwa bereits rote Seitenzahlen signalisieren,
dass hier im Erregungsmodus von Blut, Schweiß und Tränen erzählt wird. Für die
ästhetische Aufrüstung des blutigen Autoren hat der Verlag die Künstlerin Heidi
Sill verpflichtet, die sich im Blick auf den Zyklus »Cuts« wohl auf bildhafte
Verletzungen versteht. Die vorliegenden Zeichnungen illustrieren allerdings
nicht den Schrecken, sondern sublimieren den »Blutschweiß« zu mehr oder minder
abstrakten Spuren, die mitunter etwas dekorativ geraten. Am überzeugendsten sind
die Arbeiten, die dem sadomasochistischen Katholizismus Bloys in blutroten
Fetischformen nachspüren. Léon Bloy selbst ergeht sich erzähltechnisch in
kinotauglichen Splatter- und Gore-Phantasien, die so drastisch wie widerlich in
der Erzählung »Der Schlamm« ausgereizt werden. Eine agonisierende Menge steckt
im Schlamm, was an mysophilen Ekelfantasien kaum zu übertreffen ist und bei
diversen christlichen Mystikern als »Gottesdienst« entsublimierter
Widerwärtigkeiten bekannt ist.