|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Von Jürgen
Nielsen-Sikora Freuds uneingestandene Nähe zu Nietzsche und zur Philosophie, der Objektivitätsanspruch der Psychoanalyse, fehlende empirische Belege und der Narzissmus ihres Begründers sind Kritikpunkte, die seit Jahrzehnten im Umlauf sind. So bezeichnete Karl Kraus die Psychoanalyse einst als jene Geisteskrankheit, deren Therapie sie zu sein vorgebe. Von Arthur Kronfeld über Karl Jaspers bis hin zu Karl Popper, Herbert Marcuse und Thomas S. Kuhn und vielen anderen ließe sich mühelos eine Geschichte der Freud-Kritik schreiben. Viele konstruktive Kritiken haben dazu geführt, dass Freuds Theorie sich wandelte und ausdifferenzierte. In den Geistes- und Sozialwissenschaften besteht heute weitestgehend Einigkeit über die Unzulänglichkeiten und Widersprüche der Freudschen Psychoanalyse. Nur Onfray will diese Debatte offensichtlich nicht wahrnehmen, weil es ihm nicht um inhaltliche Korrekturen, sondern nur um die Zerstörung eines Denkmals namens Freud geht. Warum lässt sich nur erahnen. Dazu stellt der französische Populärphilosoph eine enge Verbindung zwischen psychoanalytischer Theorie und dem Leben Freuds her: Die Psychoanalyse habe er nur erfunden, um mit der eigenen Krankheit nicht allein zu sein. Das alles sagt freilich nichts über die Qualität der Theorie aus. Deshalb muss Onfray weiter gehen als alle anderen Kritiker und das Feld ernsthafter Auseinandersetzung verlassen. Freuds Lehre wird dementsprechend ein »Hirngespinst«, bestenfalls eine Exegese seines eigenen Körpers, eher aber eine Phantasie »aus Dr. Freuds Gruselkabinett«. Die Psychoanalyse ist ihm gar ein »Weggefährte des Teufels«, von magischem Denken beherrscht und erinnere an die »Ideologien des 20. Jahrhunderts« sowie an »faschistische Programmatik«. Freud selber sei ein »Hexenmeister« und »Sophist«, ein »Möchtegern-Wissenschaftler« und »Möchtegern-Ethnologe«, ein »Blinder«, »Seelendoktor« und zigarrenabhängiger Psychoneurotiker. Der »Märchenerzähler« sei »obsessiv« und »erratisch«, »böse«, »neidisch«, »geldgierig«, »raffgierig«, »stur«, »depressiv« und »antisemitisch« (!) gewesen. Er habe mit seiner Krankheit und seinem »von Inzest zerfressenen Innenleben« nicht allein sein wollen und sich deshalb in die Tradition der Schamanen und Zauberer eingereiht.
Die Hypothesenbildungen
Freuds greift Onfray am liebsten selbst mit Thesen »aus nietzscheanischem
Blickwinkel« an. »Wahrscheinlich«, »scheinbar« und »könnte« sind hierbei die
Lieblingsvokabeln seiner Psychologisierung der Psychoanalyse. Ihr attestiert er
Unwissenschaftlichkeit, ohne selber etwas von wissenschaftlichem Arbeiten zu
verstehen. Quellen, Belege, Argumente bleiben Fehlanzeige. Stattdessen ist
Onfrays Pamphlet eine Ansammlung unreflektierter und tendenziöser Behauptungen.
Zwar sind in der deutschen Ausgabe einige gravierende Fehler des französischen
Originals bereinigt — peinlich vom Cover bis zum Inhalt bleibt das Buch
trotzdem. Man möchte Onfray seinen eigenen Satz entgegenhalten: »Nicht jeder,
der gern ein Nietzsche wäre, ist auch einer« und die Empfehlung zur Therapie
aussprechen.
|
Michel Onfray |
|||
|
|
|||||
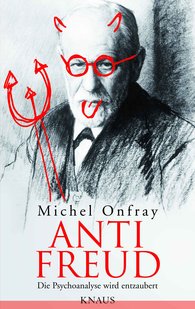 Freudlose
Polemik
Freudlose
Polemik