|
|
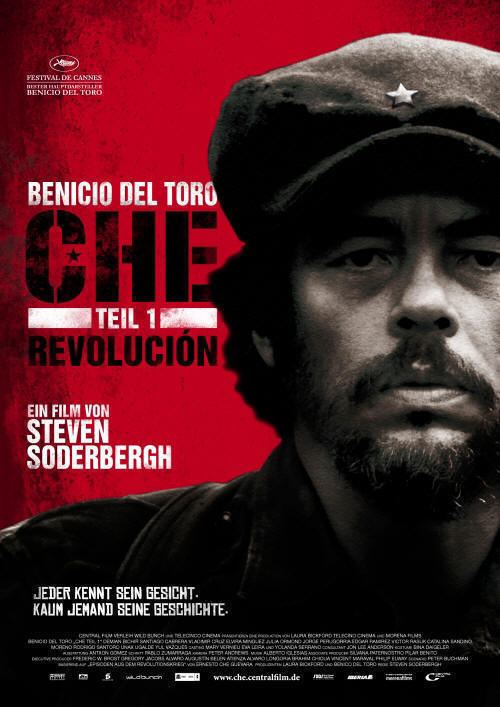 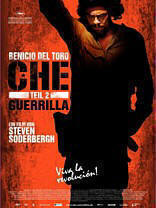 Distanz und Hitze Distanz und Hitze
Steven Soderbergs Versuch, dem Revolutionär »Che« mit den Mitteln des
Kinofilms Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Von Georg
Seeßlen
Ernesto »Che« Guevara? Ein Mythos der lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen,
die heiße Seele der kubanischen Revolution, die Ikone der neuen Linken in
Europa, der klassische Sohn aus gutem Haus, der in die Welt zieht, um Abenteuer
zu erleben und Gutes zu tun, der humanistische Outlaw mit den klaren Ideen, der
verständlichste und genaueste Theoretiker, sexy und ernsthaft zugleich, einer,
der sein Leben lang ein Arzt blieb und der die Revolution sah als eine Heilung
der Welt von Armut, Ausbeutung und Unterdrückung. Und dann: Dieses Bild mit dem
festen Blick dorthin, wo nur eine bessere Welt liegen konnte: Hasta la victoria
siempre! Schließlich: Ein Poster-Motiv, Pop-Idol, leeres Markenzeichen (für
Zigarillos etwa, die ein Kenner guter Tabacke wie er nie angefaßt hätte),
T-Shirt-Print in einem Meer von T-Shirt-Prints.
Nachdem es den Mann ermorden ließ, hat das System, das er bekämpfte, ihm auch
das Bild geraubt.
 Die
weltgeschichtliche Bedeutung von Ernesto Guevara hält sich vermutlich in
Grenzen. Ein näherer Blick auf Taten und Entscheidungen mag sogar das große Bild
vom menschlichsten und gerechtesten Revolutionär in Zweifel ziehen. Aber die
Aura dieses Bildes, die Legende und dann eben doch: die Einsichten eines
gebildeten Mannes, der so bedingungslos »das Volk« liebte (das es vermutlich nie
gab und nie geben wird) – das alles macht aus »Che« die einzige gültige und
gegenwärtige Wahrheit, die Widerspruch und Widersinn von Revolte und Protest bis
in die siebziger Jahre überwand. Eine »Wahrheit über Che Guevara«, wie es
mancher Dokumentar- und Kompilationsfilm verspricht, gibt es wahrscheinlich
nicht, den Versuch Hollywoods, die politische Legende in ein Abenteuer-Melodram
zu verwandeln (mit dem Ägypter Omar Sharif in der Rolle des Argentiniers),
dürfen wir getrost in die Kuriositäten-Schublade werfen, und um ein Denkmal zu
restaurieren, leben wir wohl auch nicht gerade in den richtigen Zeiten. Nein,
worum es geht, das ist, die verlorene Würde und Klarheit zurückzugewinnen,
Geschichte weder im mythischen Nebel noch in der semiotischen Beliebigkeit
versinken zu lassen. Die
weltgeschichtliche Bedeutung von Ernesto Guevara hält sich vermutlich in
Grenzen. Ein näherer Blick auf Taten und Entscheidungen mag sogar das große Bild
vom menschlichsten und gerechtesten Revolutionär in Zweifel ziehen. Aber die
Aura dieses Bildes, die Legende und dann eben doch: die Einsichten eines
gebildeten Mannes, der so bedingungslos »das Volk« liebte (das es vermutlich nie
gab und nie geben wird) – das alles macht aus »Che« die einzige gültige und
gegenwärtige Wahrheit, die Widerspruch und Widersinn von Revolte und Protest bis
in die siebziger Jahre überwand. Eine »Wahrheit über Che Guevara«, wie es
mancher Dokumentar- und Kompilationsfilm verspricht, gibt es wahrscheinlich
nicht, den Versuch Hollywoods, die politische Legende in ein Abenteuer-Melodram
zu verwandeln (mit dem Ägypter Omar Sharif in der Rolle des Argentiniers),
dürfen wir getrost in die Kuriositäten-Schublade werfen, und um ein Denkmal zu
restaurieren, leben wir wohl auch nicht gerade in den richtigen Zeiten. Nein,
worum es geht, das ist, die verlorene Würde und Klarheit zurückzugewinnen,
Geschichte weder im mythischen Nebel noch in der semiotischen Beliebigkeit
versinken zu lassen.
Steven Soderberghs zweiteiliger Film »Che« erklärt nicht viel, bringt keine
neuen »Enthüllungen«, stellt Ernesto Guevara in keinen neuen Zusammenhang,
experimentiert nicht mit Formen des »politischen Films«. Er macht nur eines, und
das ist das beste und schönste was man sich von einem solchen Film erwarten
kann: Er arbeitet daran, in jeder Einstellung, in jeder künstlerischen
Entscheidung, in jedem Verzicht auch, seinem Gegenstand Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen.
Der Gegenstand dieser Filme ist nicht in erster Linie die »Person« Ernesto
Guevaras (Psychologie gibt es so wenig wie erotischen Klatsch) als sein Beruf.
Er ist Revolutionär, und die Revolution ist, nach Soderberghs eigenen Worten,
eben nicht (nur) das große Abenteuer, sondern der Versuch, eine
hochkomplizierte, logistische, kommunikative und militärische Aufgabe zu
bewältigen und dabei in jeder einzelnen Aktion die Ziele und die Moral der
Revolution ihren Mitteln nicht zu opfern. Guevara, so viel ist klar, hat nie zu
den puren Machtmenschen unter den Revolutionären gehört, immer war er bestrebt,
vom Wesen der revolutionären Gesellschaft etwas bereits in der Revolution selber
zu verwirklichen. Möglicherweise wurde gerade dies ihm zum Verhängnis.
Die Grundlage für beide Filme, den ersten, der die kubanische Revolution nach
1956 zeigt, den zweiten, der die Jahre in Bolivien schildert, sind Guevaras
eigene Tagebücher sowie die Biographie von Jon Lee Anderson, der bei dem Projekt
auch als historischer Berater fungierte (auch ansonsten merkt man den Filmen
durchaus an, wie viel historische Recherche in sie geflossen ist; es gibt,
soweit ich sehe, nirgendwo eine Spekulation; was nicht dokumentiert ist, das
zeigt der Film auch nicht).
Dabei entsteht eine merkwürdige doppelte Perspektive, die innere Sicht des
Revolutionärs und die äußere Sicht der Geschichte. Distanz und Hitze. So etwas
bringt nur der Regisseur Soderbergh fertig, der immer wieder nach der Beziehung
von Machtstruktur und Bilderzeugung gefragt hat.
Teil eins dieses filmischen Dyptichons zeigt, wie eine Revolution gelingt, Teil
zwei zeigt, wie eine Revolution scheitert. Und beides, das Gelingen und das
Scheitern einer Revolution, hat ein Ausmaß, für das es in der Geschichte sonst
kein Beispiel gibt. Das Gelingen einer Revolution hat seine Wurzeln in der
Geschichte, weist in die Welt hinein, bleibt verflochten, widersprüchlich und
führt schließlich zu jenen »Mühen der Ebene«, von denen Brecht sprach, und die
nichts für einen wie Che Guevara waren. Das Scheitern einer Revolution vollzieht
sich dagegen in einem furchtbaren Hier und Jetzt, es ist ein Versinken in Blut,
Krankheit, Verrat, Einsamkeit und im Zusammentreffen von Fehlern und Umständen.
(Ein Fehler, nur zum Beispiel, ist es, wenn der schwer asthmakranke Guerillero
nicht genügend Medikamente auf seine Mission mitnimmt, ein anderer ist es, eine
gegnerische Propaganda zu unterschätzen, die die allerdumpfesten Vorurteile etwa
gegen »Fremde« aktiviert.)
»Che« ist alles andere als ein Propaganda-, wohl aber ein Lehrstück. Wie in »Traffic«
sehen wir in diesem Zweiteiler in der Soderberghschen Doppel-Perspektive
zugleich Strukturen von Macht und Abhängigkeit, die nach gleichsam mechanischen
Gesetzen ablaufen, und autarke menschliche Subjekte mit Gefühlen, Zweifeln und
Ideen. So wird das historische Bild sowohl von der Sentimentalität als auch vom
Zynismus befreit. Es öffnet sich in der Beziehung zwischen den Bedingungen einer
Revolution und dem Wesen eines Menschen, vieler Menschen.
Nebenbei, um auch dieser filmkritischen Pflicht genüge zu tun: Das Handwerk, vom
Schauspiel über die Musik bis zur Kamera (Soderbergh selber, der sich hier Peter
Andrews nennt), die Entscheidung, die beiden Teile auch in der ästhetischen
Methode voneinander abzusetzen, die Wahl der locations, das alles ist zugleich
perfekt und im entscheidenden Moment eigensinnig.
Das ist nicht großes Kino, das ist großer Film. Georg Seeßlen
|
 Tod und Auferstehung Tod und Auferstehung
»Der
Tod Che Guevaras gab seinem Leben einen Sinn. Ohne seine Hinrichtung von
der Hand des Leutnants Terán in dem dunklen, feuchten und verwahrlosten
Schulzimmer in La Higuera hätte er vielleicht noch große Heldentaten
vollbringen und ein ruhmreiches Leben führen können, doch sein Gesicht
wäre nicht Jahrzehnte später auf Millionen T-Shirts zu sehen gewesen. Er
hätte der Sache, für die er kämpfte, zweifellos einen wesentlich
größeren Dienst erweisen können, wenn die bolivianische Regierung ihn
verschont oder die CIA ihn gerettet hätte, doch die Sage von der
Revolution und dem Selbstopfer, das er symbolisieren sollte, hätte sich
niemals in dem Maße verbreitet, wie es dann geschah. Der Tod war für Che
nicht nur ein erwartetes und vielleicht sogar willkommenes Ereignis. Er
bezeichnete auch einen zwangsläufigen, vorhersehbaren Neuanfang; nicht
das Ende einer Laufbahn, eines Wegs oder eines Lebens. Jeder Aspekt
dieses Todes trug dazu bei, daß er das traurige, aber letzten Endes
gewöhnliche Schicksal, dem niemand entgeht, transzendierte; er ließ
einen Mythos entstehen, der bis zum Ende des Jahrhunderts andauern
würde.«
(Aus: Jorge G. Castaneda;
Che Guevara, Biographie, suhrkamp taschenbuch 3592)
Diddelmaus
für scheinlinke Halbintellektuelle
Wer der Wirklichkeit hinter dem Mythos Che Guevara näher kommen
will, der sollte Jorge Castanedas Biographie lesen. 42 Jahre sind seit der
Ermordung
Che Guevaras vergangen. Die Hoffnungen, die sich weltweit mit dem Aufbruch der
68er-Generation einst verbunden hatten, haben sich kaum erfüllt und
sind neuen existentiellen Ängsten gewichen. Der »Versuch der Befreiung«
mutierte zu einer Orgie der Enthemmung und das Primat des Kapitals herrscht heute ungebrochener denn je.
Den »Freiheitskampf der unterdrückten Völker« führen inzwischen
unangefochten die USA.
Kordas legendäres Che-Foto ist zu einer
zernutzten Ikone
geworden, die inzwischen alles und nichts bedeutet. Man findet es millionenfach auf
T-shirts, Basecaps, Plattencovern & CD-Hüllen. Es gibt Che-Zigaretten,
Che-Papiertaschentücher, Tassen, ja sogar eine
Swatch-Uhr um die 210 €. Der
Reise-Know-How-Verlag
bietet eine Che-Büste aus
gegossenem
Sandstein, Handarbeit (ja, ja) für geizgeile 39,50 € an. Schauen Sie
ruhig hin, das tut nicht nur den Augen weh.
Sehen Sie sich Soderbergs zweiteilige grandiose Che Guevara Passion
an. Es ist Zeit, von der Diddelmaus für scheinlinke
Halbintellektuelle Abschied zu nehmen.
Herbert Debes
|