Rede zum 9. November 2014
in der Paulskirche Frankfurt
Liebe Frankfurter, liebe Freunde und Bekannte, liebe Honoratioren
I.
Im Jahre 1931 verließ ich Frankfurt mit meinen Eltern und meinem Bruder auf immer, und wir ließen uns auf das Wagnis der Emigration ins Ungewisse ein. Für immer weg.
Und doch stehe ich heute wieder hier. Zwischen dem Abschied und heute liegt ein glückliches, ein wirklich glückliches Leben – und doch mit ach so vielen Tränen und Sorgen.
Das Leben eines einst Staatenlosen. Das Leben eines Clowns und Schauspielers. Eines Vaters, Ehemanns und Großvaters.
Wir erinnern heute an den Tag des Grauens, des Schreckens und den endgültigen Beginn von Barbarei und Unmenschlichkeit.
Nach übereinstimmenden Berichten von Zeitzeugen begann das Pogrom in Frankfurt am Morgen des 10. November um fünf Uhr. Georg Salzberger, Rabbiner in der Synagoge am Westend, erhielt einen Anruf: die SA verlange den Schlüssel für die Hauptsynagoge. Deren Hauswart, ein frommer Katholik, wurde halb totgeschlagen, weil er die Schlüssel nicht herausrücken wollte. Salzberger wurde von der Gestapo festgenommen, später im KZ Dachau inhaftiert. Gleichzeitig begannen kleine Trupps von SA-Schergen in Zivil mit Listen in den Händen mit der Zerstörung jüdischer Geschäfte. Die Gestapo startete mit Verhaftungen jüdischer Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren. Die Hauptsynagoge ging in Flammen auf. Wer ein Wort gegen die Brandstifter sagte, wurde mit Verhaftung bedroht. Ein Rollkommando mit der Parole »Deutschland erwache, Juda verrecke« zog durch die Stadt. Die Eschersheimer Landstraße entlang. Bei einem Stopp wurden ein Zigarettengeschäft und die Metzgerei May verwüstet. In der dortigen Synagoge der Thoraschrank aufgebrochen, die Rollen zerrissen, Kultgegenstände zerschlagen, Gebetbücher zertrampelt. Die städtischen Feuerwehren fuhren zwar aus, doch sie hatten strikten Befehl, lediglich das Übergreifen der Synagogenbrände auf die nichtjüdischen Nachbarhäuser zu verhindern.
Der sofortige Abbruch von Synagogen wurde verfügt. Für die Kosten des Abbruchs hatten die jüdischen Gemeinden aufzukommen. Die kleine Synagoge an der Ostendstraße, genannt »Die Klaus«, kaufte ein bekannter Möbelspediteur und nutzte sie fortan als Lagerhaus. Rabbiner Salzberger konnte 1939 Deutschland verlassen und nach England emigrieren.
Dem Grauen dieser Tage konnte ich mit meiner Familie im Voraus entkommen – doch es sollte mich trotzdem nicht mehr loslassen.
Acht Jahre früher. Es war Sommer 1930. Ich, der kleine Junge, der ich damals war, schaute an der Seite meines Vaters gen Himmel. Da schwebte er: der Zeppelin. Was für ein Bild. Was für ein Ereignis. Hoch droben diese Freiheit, der Zeppelin am Frankfurter Himmel. Fragil. Erhaben. Schwebend.
Ich wollte so sehr ein kleiner Junge bleiben und lernte doch später in Hunderten von Rollen auf der Bühne die Abgründe des Menschen kennen, die guten und die schlechten. Von Mephisto zu Truffaldino, und sogar später Hitler selbst in der Figur des Arturo Ui.
Vor Ihnen steht der Junge von einst, mit den Hoffnungen, der Zuversicht und dem Vertrauen von einst. Vor Ihnen steht der greise Junge, der weiß, dass Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen den Lauf der Dinge nicht ändern können, sondern nur den Blick darauf.
Und so steht der kleine Frankfurter Knabe von einst heute anlässlich dieser Gedenkfeier in Erinnerung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 hier und legt voller Ohnmacht Zeugnis ab.
Meine Geschichte ist eine andere. Ich bin ein Lebender, kein Überlebender. Das Schicksal hat mich, meine Eltern, meinen Bruder verschont.
Ich bin Zeuge. Zeitzeuge. Stehe hier als Letzter einer Generation einer Familie. Ich bin Nachlassverwalter und Anwalt von Ermordeten geworden. Aber davon später mehr.
II.
Ein schöner Herbsttag. Ich war fünf Jahre alt, stand im Garten unseres Hauses in der ehemaligen Mertonstraße, in meinem Paradies. Der Blick fiel ins Haus auf das Piano. Daneben stand das Cello meines Onkels Otto Frank. Es war dieser Garten, in dem wir Kinder immer spielten, mein Bruder Stefan, meine Cousinen Margot und Anne und ich.
Mein Vater war schon vorausgereist. Mutter rief mich zu sich. Wir verabschiedeten uns von Großmutter Alice – und ich verließ das, was viele Heimat nennen. Die Stadt, in der ich geboren wurde, Frankfurt.
Für die Familie war Frankfurt mehr als eine Heimat. Es war die Stadt, in der sie 400 Jahr lang lebte, wirkte und die sie prägte. Meine Geburtsstadt war Sitz einer ganzen Dynastie geworden. Doch mit einem Male war alles zu Ende. Wir emigrierten nach Basel – ins Glück. Ottos Familie nach Amsterdam – ins Verderben. Andere Teile der Familie verließen Frankfurt bereits viele Jahre vorher nach Paris und später London.
Wir waren durch und durch Frankfurter gewesen, geprägt von der aufblühenden Handelsstadt, später der bürgerlichen Bildung und Kultur. Das offene Frankfurt mit der direkten Sprache, dem Witz und der liberalen Kultur. Es war eine Umgebung, in der Jüdinnen und Juden mit der Aufklärung aufblühen konnten. So konnte etwa der Frank-Vorfahre Moritz Stern als erster jüdischer deutscher Professor für Mathematik an der Göttinger Universität lehren. Die Metropole am Main sollte in Europa das jüdische Zentrum werden, aus dem viele Bewegungen und wichtige rabbinische oder säkulare jüdische Denker hervorgehen sollten. Die Frankfurter Schule formulierte die Dialektik der Aufklärung und ebenso einen Teil der humanistischen Idee.
Und auf einmal war alles zu Ende. Wir waren aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, Frankfurterinnen und Frankfurter. Bis 1933. Dann zerbrachen 400 Jahre Familiengeschichte der Cahns, Sterns und Franks. Eine Geschichte, die an der Judengasse im Judenviertel von Frankfurt begonnen, in die Emanzipation geführt hatte durch die Jahrhunderte. Nun waren wir nicht mehr Frankfurter Bürger, sondern Juden. Deutsche Juden, bald staatenlos, ohne Reisepass. Alleingelassen. Menschen ohne Rechte.
III.
All dies blieb mir als kleiner Junge verschlossen und war doch schon tief in mir, ohne dass ich es wusste. Es folgten Nomadenjahre. In Basel, meiner neuen Heimat, ging ich zur Schule und überlebte den Krieg in der Schweiz. Es waren bange Jahre in Angst vor dem, was da kommen könnte, in Sorge um unsere Familie in Amsterdam. In Furcht vor den Bomben jenseits der Grenze, der Propaganda, den Frontisten in der Schweiz oder einem drohenden Einmarsch.
Auf einmal waren Basel und unser Haus an der Herbstgasse Zentrum der Familie geworden. Meine Eltern, Onkel Herbert, ich und mein Bruder Stefan und meine Großmütter Alice und Ida lebten dort, später Otto mit seiner zweiten Frau Elfriede. Vom Main an den Rhein, wiederum in eine weltoffene Handels- und Bürgerstadt mit humanistischer Tradition. Doch würden wir hier sicher und jemals zu Hause sein, so nahe an der Grenze zum Ungeheuren?
Wir blieben verschont. Wir hatten Glück. Und das Ausmaß der Tragödie wurde langsam aus Briefen gewiss.
Am 8. Mai 1945 schrieb mein Onkel Otto aus Amsterdam nach der Befreiung aus Auschwitz: »… Meine ganze Hoffnung sind die Kinder. Ich klammere mich an die Überzeugung, dass sie am Leben sind und wir bald wieder zusammen sein werden. Sie werden wohl kaum erwarten, dass ihr Pim noch lebt, dafür haben sie zu viel erlebt u. wissen sicher, wie alles im ›Vernichtungslager Auschwitz‹, in dem ich war, zugegangen ist. Es ist ja auch ein Wunder, dass ich durchgekommen bin. Vorläufig will ich darüber nicht schreiben. Leider hat Edith die Anstrengung nicht überlebt. Sie starb an Unterernährung im Krankenhaus am 6. Jan. 45. Ihr Körper konnte einer Grippe nicht mehr widerstehen. So hörte ich durch eine Frau, die ich nach der Befreiung in Kattowitz traf. Ich selbst war auch seit dem 19.XI. im Krankenhaus wegen ›Körperschwäche‹, konnte mich aber erholen.«
Am 8. Juni 1945 schrieb mein Onkel von den Ereignissen in Amsterdam, nachdem er in einer monatelangen Reise voll Ungewissheit von Auschwitz über Odessa und Marseille wieder zurückkam:
»Liebste Mutter, Ihr Lieben Alle, Heute kam Mutters Karte vom 20.V. an Herrn Kleiman an. Es war eine große Freude für mich, ihre Handschrift zu sehen. Endlich sind wir wieder in Verbindung! (…) Am 6 Juli 1942 erhielt Margot von der Gestapo eine Aufforderung sich zu melden zum Abtransport nach Deutschland. Ich wollte sie natürlich nicht gehen lassen und so zogen wir es vor, alle zu verschwinden. (…).«
Und dann schrieb er über die Odyssee der Familie nach Westerbork und Auschwitz und endete:
Und schließlich ein Anruf von Otto an seine Schwester Leni, meine Mutter. Ein kurzes Gespräch. Ruhe. Tränen in den Augen meiner Mutter. Sie stand auf und kam ins Wohnzimmer, in dem wir versammelt waren:
»Die Kinder kommen nicht mehr zurück.«
Das lange ungewisse Warten hatte ein Ende. Wir hatten den Krieg überlebt, waren rechtzeitig emigriert. Und mit einem Male waren wir wieder mitten im Krieg – voller Schmerz und Angst.
Schließlich schrieb ich damals meinem Onkel von irgendwo aus der Ferne:
»Mein lieber Ottel, auch ich mochte Dir noch schreiben, wie furchtbar leid mir Dein schreckliches Schicksal tut. Ja ich glaube, ich darf sagen: unser Schicksal. Wie gut kann ich mich noch an die schönen Tage mit Dir und Margot in Adelboden erinnern. Auch Edith und Anne habe ich natürlich noch gut im Gedächtnis und werde sie ewig dort behalten. Ich weiß, dass Du nun schwer zu kämpfen hast, um alles zu überwinden und frisch aufzubauen. Wir können Dich ja leider vorläufig nur so wenig unterstützen, ich wünschte Du wärest schon bei uns, oder wir bei Dir. Ich bin sicher, dass auch für Dich wieder bessere Zeiten kommen werden. Du wirst’s schon schaffen. Kopf hoch! Auf ein baldiges Wiedersehen.
Dein Buddy«
Am 19. August schrieb Otto:
»Ich muss mich besonders noch an Buddy wenden. Er weiß nicht, wie oft Anne von ihm gesprochen hat und wie stark ihre Sehnsucht war, zu Euch zu kommen und mit Buddy über alles mögliche zu sprechen. Die gesandten Bilder vom Eis sind noch hier; sie hatte ein brennendes Interesse für seine Fortschritte, zumal sie selbst so gern auf der Eisbahn war, und träumte davon, mit ihm zusammen laufen zu können. Kurz vor unserem Verschwinden hat sie noch Kunsteisschuhe erhalten, ihr ganzer Wunsch. Auch Buddys Stil erinnert mich in so vielem an die Art und Weise von Annes Schreiben, dass es ganz erstaunlich ist. Stephan hat wieder eine ganz andere Art und es scheint, dass die beiden bei Euch sich so gut vertragen, wie unsere beiden es hier taten. Ich habe mit Anne noch Goethe und Schillersche Gedichte gelesen, dann den Tell, die Jungfrau v. Orleans, Maria Stuart, Nathan der Weise, den Kaufmann von Venedig u. dergl. Sie las besonders gern Biographien, z.B. von Rembrandt und Rubens, von Maria Theresia und Marie Antoinette, Karl V. und holl. Großen, weiter Gone with the wind, und viele gute Romane. Edith und Margot waren ja beide starke Leser (…)«
Es sollten noch viele Zeilen voller Kummer und Schmerz folgen, auch von der Mutter an ihren Sohn Otto. Worte, die noch heute zu Tränen rühren.
Tausende von Briefen zeigen die Geschichte der Familie über die Jahrhunderte auf. Frankfurt war stets mitten drin und sollte zentral bleiben auch für mich. Es folgten meine fünfzehn Jahre Reisen um und durch die Welt als Clown bei der Eisrevue Holiday on Ice – wunderbare, aber auch schmerzhafte Jahre. Nach der Tragödie der Schoah kam die jahrelange Trennung von der Familie, 1952 dann gastierten wir erstmals in Deutschland, hier, in Frankfurt. 20 Jahre nachdem ich als kleiner Junge meine Heimat verlassen hatte, war ich wieder da, ganz alleine. Soeben hatte ich die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Der Auftritt war gelungen, da Publikum begeistert. Als ich hinter die Bühne kam, stand ein Mann in Uniform vor mir. Es war wie ein Stich ins Herz. »Was war der Polizist wohl im Krieg? Was hätte er mit mir, dem kleinen Frankfurter Judenjungen, wohl gemacht?« Die Bilder der glücklichen Tage und Jahre schossen mir immer wieder durch den Kopf: die Sonntage im Palmengarten. Wir Kinder im Garten des Hauses, später in den Ferien in der Schweiz oder bei Besuchen in Basel. Es waren die glücklichen Jahre. Doch mit einem Male waren sie vorbei, ich hinausgeworfen irgendwohin in die Welt.
Otto zog 1953 von Amsterdam nach Basel. Inzwischen war das Tagebuch von Anne erschienen, ein Erfolg zuerst in den USA als Buch, Theaterstück am Broadway und Kinofilm, und schließlich der weltweite Bucherfolg. Otto gründete den Anne Frank Fonds Basel, setzte ihn als Universalerben ein und verfügte, dass sämtliche Einnahmen für karitative oder edukative Zwecke verwendet werden. 1980 starb er in Basel. Inzwischen ist viel geschehen, und ich leite den Anne Frank Fonds Basel als Präsident im Bestreben, den letzten Willen meines Onkels umzusetzen: Erziehung zum Frieden, Bildung zur Aufklärung, Einsatz für Arme und Entrechtete gegen Diskriminierung jeder Art.
IV.
Otto Frank ging kurz nach Kriegsende nach Deutschland. Alle waren tot, und doch machte er sich auf den Pfad der Versöhnung. Er sprach nie von den Deutschen, sondern nur immer von den Nazis, wenn es um Verantwortung für das ging, was geschehen war. In Frankfurt besuchte er Annes Kindermädchen und Margots Freundin Gertrud Nauman, die vor kurzem hier gestorben ist. Er machte sich auf, die Geschichte seiner Töchter zu erforschen. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Wie so viele deutsche Juden hatte er im Ersten Weltkrieg gedient, als Offizier, mit Stolz, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und im sicheren Glauben, dass Deutschland ebenso zu ihm gehöre wie er zu Deutschland. Doch nach 1931 war alles anders, Deutschland und Frankfurt für lange Jahre nur noch eine Erinnerung, eine Etappe. 12 000 jüdische Soldaten sind im Ersten Weltkrieg für Deutschland gefallen.
Und da stehe ich nun heute in Erinnerung an die Reichspogromnacht. Von einer Nacht auf die andere war alles anders geworden. Alles war so fragil. Die Zeichen waren da, doch der Quantensprung kam mit einem Male. Und immer öfter frage ich mich in diesen Tagen, ob es wieder geschehen kann. Vielleicht wieder den Juden oder sonst einer Gemeinschaft. Kann es wieder geschehen, dass eine auf Gesetzen und Werten basierende Gemeinschaft auf einmal gegen einen Teil davon lostritt, ethnische Säuberungen, Mord oder gar Massenmord zulässt? Kann jemals sein, was niemals hätte sein dürfen?
Seit 2012 aber ist die Stadt nun für die Familien Frank, Elias, Stern und Cahn wieder Heimat und Ort der Zukunft geworden. In Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum und der Stadt Frankfurt entsteht hier das Familie Frank Zentrum. In zwei Jahren soll es eröffnet werden, Zehntausende von historischen Dokumenten, Fotografien und Objekten aus vier Jahrhunderten Familiengeschichte beherbergen. Dank dem Engagement der Stadt, des Jüdischen Museums und vieler Freunde geht letztlich in gewissem Sinne unser Exil zu Ende. In Frankfurt sollen zumindest die Schriften einer schreibenden Familie wieder Heimat finden. Schriften aus einer jüdischen Schreib- und Schriftkultur. Schriften, die vielleicht Einsichten für Gegenwart und Zukunft bedeuten könnten. Schriften, aus denen eine Menschlichkeit spricht, die über Jahrhunderte in einer gelebten jüdischen Familientradition und der Sozialisation einer liberalen aufgeklärten Stadt entstanden ist.
Und so entdeckte und entdecke ich als Erwachsener diese Stadt neu. Einst bei Dreharbeiten mit Günther Strack für die Serie »Mit Leib und Seele«, bei Lesungen, Programmen in der Jugendbildungsstätte Anne Frank, bei Ehrungen im Römer, und natürlich bei unseren Freunden und Verlegern im S. Fischer Verlag.
In den letzten Jahren erschließt sich mir Frankfurt wieder, die Stadt in meinem Herzen und meiner Kindertage. Die Zeitgeschichte hatte uns, wie so viele andere, entzweit. Umso mehr aber freue ich mich, dass ab Mitte April nächsten Jahres »Frankfurt liest ein Buch« das Buch »Grüße und Küsse an alle« mit der Familiengeschichte Frank-Elias programmiert hat. Mirjam Pressler und meine wunderbare und liebste Gattin Gerti haben es recherchiert und geschrieben – mir selbst die Geschichte meiner eigenen Familie in Frankfurt neu erschlossen. Oder dass die Frankfurter Bühnen ab Januar das neue Stück ANNE von Leon de Winter und Jessica Durlacher im Jugendtheater adaptieren. Und dass wir jüngst mit dem Hessischen Rundfunk ein Dokudrama über Otto Frank und seine Familie beenden konnten. Frankfurt ist wieder zu einem unserer Zentren geworden. Wie Basel, das für die Familie Elias zum sicheren Hafen und für uns und Otto nach dem Krieg zur Heimat wurde.
VI.
Doch während wir uns hier vereint haben, um der Pogromnacht zu gedenken, steht die Welt wieder Kopf. Die Barbarei ist wieder da, und eigentlich war sie ja nie weg. Wir sind konfrontiert mit der Frage, ob wir Waffen liefern sollen in Kriegsgebiete. Ob wir intervenieren und Soldaten schicken sollen. Täglich erfahren wir mehr über das Flüchtlingsdrama in Nahost, Afrika oder anderen Teilen dieser Welt. Über Unrecht, Hunger, Armut, Misshandlung von Kindern und Frauen. An den Grenzen Europas werden Flüchtlinge abgewiesen, die sich soeben noch der Tyrannei entkommen wähnten. Der 9. November steht in der Deutschen Geschichte für Anfang und Ende der Unterdrückung durch ein Regime. Er steht für den Terror gegen Juden 1938 und erinnert heute an das 25-jährige Jubiläum zum Fall der Mauer und die Befreiung einer Gesellschaft.
Hätten Edith, Margot und Anne die Schoah überlebt: Würden sie auch heute noch ihren humanistischen Glauben leben? Angesichts Srebrenicas, Ruandas, Darfours, Breiviks, der Hamas, des ISIS, der vergewaltigten Frauen in Indien, der täglichen Horrormeldungen in Radio, Presse und Fernsehen? Ich hoffe es. Anne schrieb: »Ich höre den anrollenden Donner immer lauter, fühle das Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, denke ich, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird.« Das Tagebuch von Anne zumindest wird ein Beispiel dafür bleiben, an das Gute im Menschen zu glauben und zu hoffen, dass weltweit die Menschlichkeit und Liebe den politischen und religiösen Fanatismus besiegen wird. Ich weiß, ich hatte Glück und ein glückliches Leben, für das ich so dankbar und um dessentwillen ich in der Verpflichtung bin, an diesem Ort, in diesem Land an jene vielen Millionen zu erinnern, die dieses Glück nicht hatten.
Europa hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Zivilgesellschaft neu formuliert.Europa, und speziell Deutschland, haben mit den USA Menschenrechte und Institutionen konstituiert und auch vorgelebt. Dahinter dürfen wir nicht mehr zurückgehen.
Ich danke Ihnen.
Diese Rede erschien zuerst in: Neue Rundschau, Gegenwartsliteratur!, Heft 2015/1, Frankfurt am Main 2015, S. 247-255.
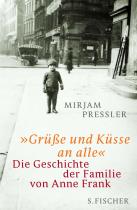
Die Geschichte der Familie von Anne Frank
Sommerfrische hoch über dem Silser See in den Schweizer Bergen: Alljährlich traf sich hier die Familie Frank, die sonst über ganz Europa verstreut war. Noch Anne Franks Ururgroßvater hatte als kleiner Junge in der engen Frankfurter Judengasse leben müssen, doch schon eine Generation später wurde ein Vorfahr Anne Franks zum ersten jüdischen Professor in Deutschland berufen. Ihre Großmutter Alice führte als Bankiersgattin ein weltoffenes Haus in Frankfurt, bis die Familie nach London, Basel und Amsterdam übersiedelte, das dann zum Schicksalsort der Familie werden sollte. Der letzte lebende Verwandte Anne Franks, der sie persönlich kannte, ihr Cousin Buddy Elias, wurde schließlich berühmt als Eiskunstläufer und Schauspieler.
Wie durch ein Wunder haben zahllose Briefe, Dokumente und Fotos der Familie Frank auf dem Dachboden des Hauses in der Baseler Herbstgasse überlebt und wurden dort vor einiger Zeit entdeckt – ein Sensationsfund. Die wunderbare Erzählerin Mirjam Pressler hat daraus die so einzigartige wie exemplarische Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Frank zusammengefügt, die sich liest wie ein großer schicksalhafter Familienroman.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /