Er spürte die Menge draußen. Sie unterschied sich kaum von amerikanischen Mengen, war vielleicht weniger weiß, mehr Volk. Der Mangel an Feierlichkeit verstörte ihn. Er erahnte ihren Spott, wie bei einem Pärchen, das sich in eine Feier eingeschmuggelt hat und nun das passende Gesicht macht, während der Gastgeber es willkommen heißt, sich aber innerlich totlacht und nur den Moment abwartet, bis der peinliche Augenblick vorüber ist und es sich auf die Häppchen stürzen kann.
Der Präsident wusste nicht mehr, wie Amerika wirklich war. Wie diese Landschaft sich artikulierte, wie die Welt sich ordnete. All das, womit er aufgewachsen war und was er regiert hatte, war nun anders, verhielt sich anders. Bei seiner letzten Tour durch den Mittleren Westen hatte er einen Hut geschwenkt und gerufen: »Hooray America!« Und die Leute hatten sich vor Lachen gekrümmt, wie damals, zu seiner Zeit, als man sich über die Neuankömmlinge lustig gemacht hatte, die vor der U-Bahn den Daumen ausstreckten. Amerika war ein befremdlicher Ort.
Wie war es wohl, auf Mexikanisch zu denken, verdammt. Über diesem Rätsel spulte sich der Vormittag ab.
Sie hatten ihn getäuscht, ihn, die Institutionen, die Geschichte. Sie schienen sich doch so gut zu integrieren. Hatten ihre Kriege gekämpft und sich damit abgefunden, dass sie später weder in Leinwandepen noch in Reden auftauchten; stumm, dankbar sogar, dass sie in den Küchen arbeiten, Blumen verkaufen, Böden schrubben durften. Sie hatten auch nicht protestiert, als man ihr Essen in Junkfood verwandelte, um der Eile willen. Sie waren der Traum eines jeden Imperiums, verflixt noch mal. Sie hatten nicht mehr sein sollen als das, was um die Ecken biegt, sich um Belangloses kümmert und sich dann versteckt. Aber bald nahm das Belanglose überhand, all die Einzelheiten überwucherten den Kern, und der Stoff, aus dem dieses Volk gewebt war, wurde zur zentralen Angelegenheit Amerikas.
Wann hatte das angefangen?, dachte er. Unmöglich zu wissen. Lange Zeit waren sie ebenso allgegenwärtig wie unbedeutend gewesen. Selbst der Satz, den wir so lustig fanden, dass wir ihn wiederholten, als ahmten wir ein Kind nach, klang nun anders: Mein Haus ist dein Haus. Ha.
Dann kam es zu einer Reihe von Ereignissen, die eine Reaktion bei ihnen ausgelöst haben musste: Da hatte jemand gerade die Billionen seines Vaters, eines berühmten Software-Erfinders, geerbt, schon gab er sie seinem mexikanischen Kindermädchen; bei den Waffenfabriken nahmen die mexikanischen Berater zu, die immer furchterregend gut informiert waren; Richter des Obersten Gerichtshofs hatten überall mexikanische Sekretäre im Gefolge... Was sich nicht zu ändern schien, O Amerika, war das demokratische System. Die Einwanderer, diese Spics, hatten bisher keinerlei Interesse daran gezeigt, nur zwei, drei wärmten ihren Sitz im Repräsentantenhaus. Bis das mit San Francisco passierte. Seitdem gingen die Mexikaner sehr wohl an die Urnen.
Anfangs war es nicht mehr als eine Art kollektiver Performance, natürlich unglaublich cool: Ein lokaler Aufsichtsbeamter plädierte bei den Wahlen jenes Jahres für den Plan M: Angesichts der Forderung im Bundesstaat, an den Grundschulen den Kreationismus zu lehren, schlug die Stadt San Francisco ihren Bürgern vor, mexikanisches Protektorat zu werden. Oh, wie sehr hatte man sich diesen Sommer amüsiert! Ponchos fanden reißenden Absatz, und nie wurde mehr Tequila in den Bars getrunken. Aber am Wahltag standen mexikanische Horden Schlange, Leute, die im Wahlregister auftauchten, diesen Akt aber bisher nie ernst genommen hatten. Im Nachhinein haben Wissenschaftler versucht, dieses Phänomen zu erklären, ohne viel Erfolg, nur beschreiben konnten sie es: Eines Tages, klick, legte etwas bei den Mexikanern den Schalter um, selbst bei denen, die nicht wussten, dass sie Mexikaner waren, oder bei denen, die keine Mexikaner hatten sein wollen [aus der zweiten, dritten, vierten amerikanischen Generation] und es nun ganz bewusst waren. Die Reise durch die Generationen hatte einen Sinn gehabt, das sahen sie jetzt, und sie wussten genau, was die nächsten Schritte waren. Man sprach offen vom Ende einer Ära und vom Beginn einer neuen. Die neue Sonne, sagten einige.
Bevor die Gringos reagieren konnten, hatten San Antonio, Los Angeles und sogar New York ähnliche Beschlüsse gefasst. »Nichts wird sich ändern«, beruhigten die Führer der Tex-Mex-Koalition, »Amerika bleibt Amerika, nur mit mehr Gedächtnis.« Die mexikanische Regierung jenseits des Flusses versank in der Fassungslosigkeit, bis die Koalition Berater schickte und ihr ausrichten ließ, sie solle nur tun, was sie am besten verstehe: warten.
Die Institutionen reagierten träge, oder vielleicht war die Langsamkeit der einzig sinnvolle Trieb; die spärlichen Proteste wurden hier und da unterdrückt, um der sozialen Ruhe willen. Die Gringos waren es müde. Am Ende hatten die Mexikaner, als sie die Kontrolle des Kongresses übernahmen, sie damit überzeugt, dass sie das Problem des Terrorismus mit einer zugleich einfachen und sehr mexikanischen Lösung aus der Welt geschafft hatten.
Erschöpft vom Zählen, stützte sich der Präsident mit gespreizten Händen auf den Schreibtisch, sah über die Avenue, die früher Pennsylvania geheißen hatte, ließ aber ab, als er merkte, dass er Kennedys Geste bei der Farce mit den Raketen wiederholte. Lächerlich. Ich bin lächerlich, sagte er sich, eine schlechte Kopie einer toten Idee.
Jetzt ging es schießlich zu Ende. Sie hatten die Wahlen gewonnen, nach außen hin zwar ohne Überschwang, ohne Sinn für Rache, doch ließen sie hin und wieder durchblicken, wie sehr sie bereits Herr im Haus waren. Vor nur wenigen Tagen hatte ihm der Sieger ein Etui mit zwei Obsidianmessern und einer Notiz geschickt: »Immer hat es geheißen, wir wären ganz Herz, nicht wahr? Wie richtig! Wären Sie so nett, mir Ihres zu schicken?« Unter der Notiz stand eine weitere, die besagte: »Nur ein Scherz!« Ha, ha.
Sie hatten nicht nur nicht das Ruder abgegeben, sagte sich der Präsident, in Wirklichkeit existierten sie nicht mehr. Was war schon ein Amerikaner ohne Macht, ohne Lebensraum? Was, ohne Gewissheiten?...
Wie muss es sein, auf Mexikanisch zu denken?, fragte er sich wieder mit einem Gefühl der Verlorenheit.
Ein Assistent benachrichtigte ihn, der gewählte Präsident sei eingetroffen. Er wolle vor der Machtübernahme sein Büro kennenlernen. »Lassen Sie ihn vor«, sagte der Präsident, aber der kam bereits herein, ohne dass man ihn aufgefordert hätte. Er schob seinen elektrischen Rollstuhl durch die Tür und hielt erst nach zwei Metern mitten im Oval Office inne. Schweigend ließ der Mexikaner den Blick durch das Zimmer schweifen. Es war nur das abgehackte Motorengeräusch zu hören, wenn der Mexikaner den Stuhl mit dem Kinn drehte, um ein Detail besser ins Auge fassen zu können. Der Präsident musterte erneut diesen verwachsenen, kurzen Mann. Er besah sich sein minutiös tätowiertes Gesicht, dachte, dass darin Traurigkeit, Bitterkeit und letztlich Müdigkeit geschrieben stehen mussten; aber er konnte nicht erraten, was sich hinter der animierten Leinwand tat, die das Gesicht des Mexikaners war. Er wünschte sich in dem Moment, er möge ihm die Würde lassen, nicht zu wiederholen, was er während des Wahlkampfs gesagt hatte: »Vielleicht sollten wir diesem Land langsam einen echten Namen geben.«
Nach einer Weile, die zu messen niemand für nötig gehalten hatte, ließ der Mexikaner seinen Blick schließlich auf dem Präsidenten ruhen, voller Neugier, als entdeckte er erst jetzt, dass er dort stand. Mit einer leichten Kopfbewegung wies er in Richtung der Vorhänge und sagte: »Bien entendu, on aura besoin de satin pour ces rideaux.«
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
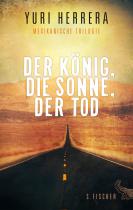
›Der König, die Sonne, der Tod‹ versammelt drei Romane des Mexikaners Yuri Herrera, die ihn zu einem der eigenwilligsten lateinamerikanischen Erzähler der letzten Jahre machen. Die mexikanische Wirklichkeit, die wir aus den Nachrichten kennen – die Welt der Drogenkartelle, der sinnlosen Gewalt, der illegalen Einwanderer in den USA –, ist der Bodensatz, auf dem Herrera seine Geschichten ansiedelt. Auf berückende Weise gelingt es ihm, von Figuren zu erzählen, die sich in dieser Wirklichkeit bewegen und zugleich über ihr zu schweben scheinen – wie El Lobo, der die Tochter des Drogenbosses liebt; wie Makina, die auszieht, die Grenze zu queren; wie Alfaki, der nicht anders kann, als den Dreck wegzumachen. Es sind Erzählungen aus dem Inneren eines Landes, die sich weiten zur großen Erzählung über das Innerste unserer Welt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /