dies jetzt ist ein Moment, in dem sich der Blick zurück aufdrängt: am Anfang, vor 47 Jahren, als die erste von mir in beruflicher Verantwortung übersetzte Zeile entstand, und am Ende, vor dem Schlusspunkt der Übersetzung des ›Horcynus Orca‹, bis zu dieser Stunde, steht ein »Erstes Mal«.
1968 hatte ich mit einer umfangreichen Sammlung ausgewählter und bis dahin veröffentlichter Gedichte Paul Celans meine Übersetzertätigkeit begonnen, damals ins Italienische. Und damit wurde Paul Celan, schon damals einer der sprach- und metaphernmächtigsten Lyriker von europäischem Rang, den italienischen Lesern zum ersten Mal in einem größeren Zusammenhang seines Werks zugänglich gemacht. An meiner Seite stand damals meine Kollegin und Mitstreiterin Marcella Bagnasco. Diese Sammlung wurde Anfang 1976 in der Lyrik-Reihe ›Lo Specchio‹ des Mondadori-Verlags veröffentlicht, später dann mehrmals neu aufgelegt und gilt heute noch (und heute wieder) als Standardwerk der Celan-Übersetzung ins Italienische. Dass zwischen Beginn und Veröffentlichung dieser Übersetzung von 102 Gedichten so viele Jahre lagen, nämlich 8, hatte etwas mit der äußerst schwierigen Textur der Gedichte, den Wortschöpfungen Celans vor allem der Gedichte aus der Mitte und vom Ende der 60er Jahre und mit einer adäquaten Herstellung der Klanglichkeit in der anderen Sprache zu tun: das alles musste genau nachgestaltet werden. Das nahm viel Zeit in Anspruch.
Und ein zweites Mal begegnet mir dieses »Erste Mal« am Ende meiner Übersetzertätigkeit mit dem großen Roman ›Horcynus Orca‹ von Stefano D'Arrigo, dieses Mal aus dem Italienischen ins Deutsche. Und auch hier wiederholt sich – was mir bis zur Ausarbeitung dieser Gedanken nicht gegenwärtig war - die Arbeitsspanne von 8 Jahren. Ich bin weit davon entfernt, hierin etwas Tieferes oder gar Symbolisches zu sehen: ich könnte das in keiner Weise deuten. Und auch hier liegt das »Erste Mal« in dem Umstand, dass die deutsche Umformung dieses sprachgewaltigen Romanungetüms die erste überhaupt in eine fremde Sprache ist, 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung Anfang 1975 in Italien, so dass die deutschen Leser die ersten ausländischen Leser überhaupt sind, die mit diesem Roman – einem der fünf oder sechs ganz großen, nie vergehenden Romane der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts – Bekanntschaft machen und hoffentlich, hoffentlich auch Freundschaft schließen.
Ich habe mir den Spaß gemacht, einmal kurz rechnerisch zu überschlagen, wie lange ich für den ›Horcynus Orca‹ hätte brauchen dürfen, wenn man die Seitenzahl der 8 Jahre dauernden Arbeit an der Seitenzahl der Celan-Gedichte als Ausgangswert nimmt: danach hätte ich mir noch weitere 75 Jahre gönnen können; dann hätte dieser Roman gut 125 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf Deutsch vorgelegen, und das wollte ich dann doch eher vermeiden, weil ich das ganz sicher nicht mehr erlebt hätte oder genauer gesagt: erleben würde. Dann wäre ja nicht nur ich nicht mehr, sondern die Stiftungsmitglieder und die Juroren, die über die gewichtige Zuerkennung von Preisen entscheiden, wären auch nicht mehr, und ich stünde womöglich an keinem Abend der Zukunft vor einem geneigten Publikum wie heute Abend, und vielleicht wäre das Deutsche auch nicht mehr, wenn wir uns vorstellen, welche Reduzierungen die Sprache heute schon, innerhalb weniger Jahre, durch Twittern und Simsen erfahren hat und alles von nicht wenigen bereits als »schwierig zu lesen« bewertet wird, was über Subjekt, Prädikat und Objekt hinausgeht.
Es ist also ein langer Weg von der ersten Zeile der italienischen Celan-Übersetzung bis zum Schlusspunkt des ›Horcynus Orca‹. Dazwischen liegen teilweise merkwürdige Stationen, die mit Regie-Assistenzen in Düsseldorf und Athen und mit italienischem Theater zu tun hatten, mit Goethe-Institut in Florenz, mit Dokumentarfilm-Produktionen über Themen der antiken Welt und schließlich wieder mit Übersetzungen. Da reihen sich Namen wie Rondiris und Visconti und Werke unter anderem von Luigi Malerba, Pier Paolo Pasolini und Roberto Calasso, von Andrea Camilleri (und bei ihm meine ich in erster Linie seine historischen Romane), von Beppe Fenoglio, Federigo Tozzi, Primo Levi und Andrea Giovene aneinander: insgesamt eine gehörige Anzahl von Titeln – ich habe in der Liste der von mir gestalteten Übersetzungen 92 in 28 Jahren gezählt; darin sind 8 Hörspiele und zahlreiche Zeitschriftenbeiträge nicht mitgezählt.
Doch im Rückblick kommt es mir vor, als wäre alles, alles auf den ›Horcynus Orca‹ von Stefano D'Arrigo hinausgelaufen, der mich seit 40 Jahren begleitet und von 2006 bis 2014 intensiv beschäftigt hat, und als wäre alles Vorhergehende die große Einübung auf unterschiedlichsten Sprach-, Gedanken- und Erzählebenen dazu gewesen, was die olympischen Götter ebenso einschließt wie die aristokratische und die bürgerliche Welt Italiens und auch die Welt der römischen Gosse.
Sie werden also meine tiefe Bewegung verstehen, meine Damen und Herren, dass ich mit diesem wunderbaren Preis ausgezeichnet worden bin, dessen Namensgeber eine bestimmende Bedeutung in meinem beruflichen und privaten Leben hat und dessen eigene vielgestaltige Übersetzungstätigkeit den Geist meiner Übersetzung des ›Horcynus Orca‹ von Stefano D'Arrigo mitgetragen hat.
Ich danke daher der Jury des Deutschen Literaturfonds für ihre Entscheidung. Und ich danke Ihnen allen – und unter Ihnen allen einigen ganz besonders – für Ihre Teilnahme und Anteilnahme an diesem schönen, festlichen Ereignis.
am 15. Oktober 2015
M.K.
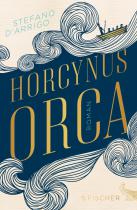
Die Landschaften um die Straße von Messina bilden die Brücke zwischen den Mythen der Antike und der Gegenwart. Hier, zwischen Skylla und Charybdis, hörte Odysseus den Gesang der Sirenen. An genau diesen Ort, sein Zuhause, strebt der Held von Stefano D'Arrigos Meisterwerk ›Horcynus Orca‹, dem letzten großen unentdeckten Roman der Moderne, der nur mit Joyce, Kafka, Musil, Proust zu vergleichen ist. D'Arrigo bannt diese ganze Welt in nur vier Tage: Ein 1943 nach dem Zusammenbruch der Marine heimkehrender Matrose erfährt, was der Krieg aus seinen Menschen gemacht hat. Eine geheimnisvolle Frau hilft dem Fischer ohne Boot über die Meerenge, aber er muss erfahren, dass jede Heimkehr vergeblich ist, wenn der Tod das Ruder führt.
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen ist es Moshe Kahn gelungen, den lange als unübersetzbar geltenden Roman zum ersten Mal in eine andere Sprache zu übertragen. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für das sizilianische Italienisch mit seinen bildstarken und metaphernreichen Dialekten und erdigen Phonemen eine deutsche Entsprechung zu finden, die den großen Wurf des Romans, seine sprachliche Finesse und seine weiten Anspielungsräume lebendig werden lässt. Eine Glanztat.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /