Im Jahr 1995 erschien im S. Fischer Verlag ein Buch des französischen Historikers Alain Corbin mit dem klangvollen Titel »Die Sprache der Glocken«. Das Werk betrachtet das französische Landleben des 18. Jahrhunderts aus einem völlig neuen Blickwinkel, oder besser: »Hörwinkel«. Im Mittelpunkt steht nämlich die Frage, wie das regelmäßige Schlagen der Glocken, wohltönend und weithin hörbar, das alltägliche Leben der Landbewohner prägte. Der Klang der Glocken sagte ihnen, wann sie aufstehen, die Mahlzeiten einnehmen oder zur Kirche gehen mussten, verkündete politische Ereignisse, Trauerfälle und Katastrophen.
Alain Corbins Werk war der Beginn einer neuen Perspektive innerhalb der Geschichtswissenschaft: des »acoustic turns« oder »sensual turns«. Mehr und mehr widmen sich Historiker und Kunsthistoriker der Geschichte der Sinneswahrnehmung. Wie roch, wie schmeckte, wie fühlte sich Geschichte an? Wie nahmen historische Akteure Wärme, Schmerz, Wohlsein, Gestank wahr? Wie hat sich die sinnliche Umwelt der Menschen im Prozess der Industrialisierung geändert? Und hat sich damit auch der menschliche Sinnesapparat gewandelt?
Längst hat sich die Geschichte der Sinne zu einer anerkannten Unterdisziplin entwickelt … doch ist die Geschichtsschreibung davon nicht sinnlicher geworden. Im Namen der Wissenschaft wird schon den Studenten das Riechen, die Gänsehaut und das Empfinden ausgetrieben. Am Ende kommen Texte heraus, die so trocken sind, dass selbst Fachhistoriker sie nur lesen, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Die durchschnittliche Leserschaft eines geisteswissenschaftlichen Aufsatzes beträgt 1,5 Personen. Gleichzeitig beklagt sich die Zunft, dass die Öffentlichkeit sich nicht für ihr Tun interessiert und viele Menschen Geschichte nur noch in seichten Fernsehformaten konsumieren.
Beim Schreiben meines Buches »Kometenjahre« über die Zeit nach dem 11. November 1918 habe ich versucht, die Konditionierung aus Studium und fast zwanzig Berufsjahren hinter mir zu lassen. Es war schwerer als gedacht; ich musste mich überlisten: In die Datei jedes Kapitels habe ich mir, um meine Vorstellungskraft anzuregen, ein Gemälde oder eine Fotografie kopiert. Beim Schreiben lief meistens Musik: Beim ersten Kapitel über die letzten Tage des Ersten Weltkriegs war es Arnold Schönbergs »Jakobsleiter«, beim zweiten, das von den Friedensfeiern auf der ganzen Welt handelt, ein Schlager des schottischen Sängers Harry Lauder usw. Meine Protagonisten habe ich strikt danach ausgewählt, ob es ihnen in ihren autobiographischen Texten gelungen ist, anschaulich über ihre Eindrücke, Befindlichkeiten und Gefühle zu berichten, ob ihre Berichte mich emotional berührt haben. So viel wie möglich bin ich zu den Schauplätzen der Handlung gegangen, auf den Spuren von Gandhi sogar bis nach Delhi.
Wenn sich die Erfahrungen der Vergangenheit einem Leser mitteilen sollen, dann muss der Autor den Gefühlen und Sinneswahrnehmungen seiner Akteure Raum geben. Er muss häufig genau die Passagen zitieren, die andere Historiker weglassen. In Autobiographien sind das oft winzige Details, wie der Granatsplitter, den die französische Journalistin Louise Weiss in den Trümmern ihres zerstörten Geburtshauses in Arras findet – an genau der Stelle, an der einst ihre Wiege gestanden haben muss. Auch darf der Historiker keine Angst vor seinen eigenen Sinnesregungen beim Darstellen von Geschichte haben. Er darf nicht auf die Bremse treten, wenn die Vorstellungskraft sich in Gang setzt. Wenn das gelingt, dann überträgt es sich auf den Leser und die Geschichte wird lebendig.
Ist ein solcher Text überhaupt noch richtige Geschichtsschreibung? Durchaus! Dass ein Historiker achtsam ist und fühlt, heißt ja nicht, dass er seinen kritischen Verstand abschaltet. Denken und Fühlen schließen einander nicht aus – im Gegenteil, die Neurowissenschaften beweisen uns, dass beides stets Hand in Hand geht. Außerdem sind auch die Bücher der »richtigen« Historiker voller Gefühle, die allerdings unverarbeitet und unreflektiert bleiben – und dennoch haben sie Einfluss auf das Denken und Schreiben. Für mich war es wichtig anzuerkennen, dass der Mensch – wie schon Immanuel Kant betonte – ein geistig-sinnliches Wesen ist. Nur dann kann – im Idealfall – das entstehen, was der Historiker Jan-Friedrich Missfelder »Ganzkörpergeschichte« genannt hat.
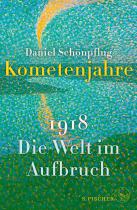
Die Geschichte eines einzigartigen historischen Moments, als alles möglich schien – »ein meisterhaftes Werk« (Philipp Blom)
November 1918. Der Große Krieg hat die alte Welt in Schutt und Asche gelegt, und doch scheint das Schicksal der Menschheit so offen wie selten zuvor. Hell leuchten neue Möglichkeiten und Träume auf, das Ringen um die Zukunft beginnt.
Die Kosakin Marina Yurlova kämpft in Sibirien gegen die Revolution, Käthe Kollwitz macht ihren Schmerz zu Kunst, Rudolf Höß marschiert mit dem Freikorps, Virginia Woolf revolutioniert den Roman, Walter Gropius will mit der Architektur die Gesellschaft verändern und die Publizistin Louise Weiss wirbt in Paris leidenschaftlich für ein vereintes Europa.
Virtuos schildert Daniel Schönpflug diesen einmaligen Moment und die Jahre, die folgten, aus der Perspektive von Menschen, die sie erfahren und geprägt haben. Das glänzend geschriebene Panorama einer einzigartigen Zeit zwischen Enthusiasmus und Enttäuschung, zwischen Zukunftstrunkenheit und Zerstörung.
»Daniel Schönpflug schreibt so, dass man ihm direkt in das erstaunliche Jahr 1918 folgen will. Mit großer Behutsamkeit, einem wunderbaren Auge für Details und großem stilistischen Können eröffnet er diese Zeit neu und erlaubt es seinen Lesern, sich selbst und das 20. Jahrhundert auf diesen Seiten wiederzuentdecken. Ein meisterhaftes Werk.«
Philipp Blom, Historiker und Autor des Bestsellers »Der taumelnde Kontinent: Europa 1900–1914«
»In die verschiedensten Lebensläufe hat diese turbulente Zeit ihren Prägestempel eingedrückt. Schönpflug führt dem Leser die einzelnen Schicksale so eindringlich vor Augen, als wäre es gerade erst geschehen.«
Sibylle Lewitscharoff






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /