Als ich ihren Namen zum ersten Mal hörte, war ich eine junge Studentin im ersten Semester meines Germanistikstudiums. Für das Seminar Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert stellte uns meine damalige Dozentin mit Begeisterung Die Judenbuche vor. Wir teilten ihre Begeisterung nicht. Für uns waren die Schachtelsätze anspruchsvoll, die Handlung undurchschaubar und die in der Reclam-Ausgabe gedruckte Schrift viel zu klein. Außerdem fand das Seminar stets zur ersten Stunde am Montagmorgen statt. Meistens, wenn unsere Dozentin uns Fragen zur Lektüre stellte, wurde sie mit verkatertem Schweigen empfangen.
Erst Jahrzehnte später wurde mir bewusst, dass Annette von Droste-Hülshoff die einzige ›Autorin‹ war, die ich im gesamten Germanistikstudium gelesen habe. Seltsam, dass mir das damals nicht aufgefallen war. Seltsam, dass die Situation deutschsprachiger Autorinnen im Studium überhaupt nicht thematisiert worden ist. Über den Sexismus in der Germanistik wurde auch geschwiegen.
»Fesseln will man uns am eignen Herde«, dichtete Droste-Hülshoff über die Stellung der weißen Frau im 19. Jahrhundert. Und der zu ihren Lebzeiten unverblümte Judenhass wurde von ihr in der besagten Novelle eindringlich porträtiert. Ob sie sich außerdem zu der Misshandlung, Verschleppung, Enteignung und Ermordung afrikanischer Menschen geäußert hat? Zeitgenössische Philosophen wie Kant und Hegel vertraten vernichtende Thesen über Schwarze Menschen. Was dachte sie dazu? Ob es irgendwelche Forschung dazu gibt? Noch einmal: Schweigen.
Woher kommt dieses gesammelte Schweigen?
*
Ich möchte Sie einladen, an einem Gedankenexperiment teilzunehmen:
Wir stellen uns vor, es gäbe keine Pässe. Keine Einreisebestimmungen, keine Visumspflicht; weder Aufenthaltsgenehmigungen noch Abschiebungen.
Was bleibt?
Eine Gruppe von Menschen, die zufällig in demselben Haus, in derselben Straße oder im selben Kiez wohnen. Eine Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben, Geschichten, Fähigkeiten und Bedürfnissen. Eine Community von Menschen, die aufeinander angewiesen sind. Eine Gesellschaft wie unsere: Ihre und meine. Wie wollen wir gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten? Denn eine Zukunft, in der alle sogenannten Fremden nicht mehr unter uns sind, wird es, trotz Seehofers größten Anstrengungen, nicht geben. Die Wahrheit ist: Deutschland war nie, ist nicht und wird nie homogen sein.
Die Schwarze US-Amerikanerin Audre Lorde sagte: »Es sind nicht unsere Unterschiede, die uns trennen. Es ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, zu akzeptieren und zu feiern.« Meiner Meinung nach führt diese Unfähigkeit zu einer Art Schweigen, das sich auf zwei verschiedene Weisen ausdrückt.
Zum einen fehlt uns ein gemeinsames Vokabular. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, nicht mehr zu wissen, was Sie sagen ‚dürfen‘? Oder das Gefühl, in einem Gespräch nicht mehr mitzukommen, weil Sie nicht wissen, was ›POC‹ oder ›cis‹ bedeuten? Oder vielleicht kennen Sie das Gefühl, Ihre Realität gar nicht in Worte fassen zu können, weil die nötige Sprache keine breite Verwendung gefunden hat? Sicherlich wäre die Kommunikation über Differenz leichter, wenn wir ein gemeinsames Vokabular hätten.
Zum anderen fehlt eine solidarische Haltung – besonders von denen in den machtvolleren Positionen. Rund 200 Jahre nachdem Droste-Hülshoff davon geschrieben hat, beschäftigt sich der moderne Feminismus noch immer mit Fragen von Gleichberechtigung. Von anderen Formen der Diskriminierung ganz zu schweigen. In Deutschland scheint es noch immer nicht selbstverständlich zu sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die hinsichtlich Gender, Sexualität, Rassifizierung, Klasse, Beeinträchtigung, Sprache, Nationalität, Religion und Weltanschauung vielfältig ist und vielfältig sein soll. Solange diejenigen, die von diesem Missstand profitieren, sich nicht lautstark am Prozess des Wandels beteiligen, kann eine gesellschaftliche Veränderung weiterhin nur schleppend stattfinden.
Insofern möchte ich mich beim Organisations-Team von Herzen für meine Einladung bedanken. Sicherlich empfand ich zunächst eine gewisse Ironie, dass ich ‒ nach jahrzehntelangem Grammatikunterricht, Vokabeltraining und Ringen um die richtige Aussprache ‒ eine Eröffnungsrede für »this is a woman’s world« halten sollte. Auf dem Droste-Festival? War doch meine Beziehung zur Namensgeberin vom ›Schweigen‹ geprägt. Aber dann dachte ich: Ich nutze die Gelegenheit und erzähle davon, wie ich jenen Momenten des gesammelten Schweigens als Autorin begegne.
Ich werde meine Strategie am Beispiel meiner zweiten Novelle Synchronicity aufzeigen. In der Geschichte geht es um Cee, eine Schwarze Grafikdesignerin, die in Berlin lebt. Eines Tages merkt sie, dass sie dabei ist, ihre Farben zu verlieren, erst geht ihr das Gelb verloren, dann Hellblau, dann Rot, bis sie an Tag zehn die allerletzte Farbe verliert:
»[…] Bis zu dem Donnerstagmorgen hatte ich Gold noch nie so häufig gesehen.
Manchmal, wenn eine weiße Person sprach, schimmerte eine Zahnfüllung aus dem vielfach schattierten Grau, an das sich meine Augen inzwischen gewöhnt hatten. Doch abgesehen davon, wenn ich nicht gerade zufällig an einem Juweliergeschäft vorüberlief, oder einen Stolperstein zu Gesicht bekam, eingebettet zwischen Betonplatten und einer schuldgeplagten Erinnerungskultur, konnte es durchaus vorkommen, dass es mir tagelang überhaupt nicht auffiel. An diesem Donnerstagmorgen bemerkte ich, dass der Rahmen um Sams Bild nicht mehr so golden glänzte, wie er es sollte. Ich polierte ihn kräftig mit einem Lappen, da ich ihn ohnehin eine Weile nicht mehr entstaubt hatte, aber die Farbe veränderte sich nicht. Das Bild hing in meinem Flur. Ich muss zwanzig Mal am Tag daran vorbeigelaufen sein, aber erst, als meine letzte Farbe mich verließ, wurde mir bewusst, wie sehr ich sie vermisste. Typisch.
Ich brachte den (grauen) Lappen in meine (graue) Küche zurück, nahm dann meinen (grauen) Tee und nippte daran, während ich in mein (graues) Zimmer zurücklief […] «
Als ich anfing, Synchronicity zu schreiben, standen nur zwei Sachen fest:
Erstens wollte ich eine Geschichte über eine Person schreiben, die Weihnachten alleine verbringen würde. Ich kenne viele Personen, die nicht mit »ihrer Familie« feiern wollen oder können, und jedes Jahr vereinzelt zuschauen müssen, wie ganz Deutschland das Fest der Familie feiert. Ich wollte eine Geste der Anerkennung schreiben.
Zweitens sollte die Hauptfigur eine Schwarze Frau sein. Ich vermisste Darstellungen Schwarzer Protagonistinnen, die in deutschsprachigen Ländern selbstbestimmt leben, lieben, arbeiten und Mist bauen. Die Schwarze US-Amerikanische Autorin Toni Morrison sagte einmal: »Wenn es ein Buch gibt, das du lesen willst, aber es noch nicht geschrieben wurde, dann musst du es schreiben.«
Dass ich das Thema Entfremdung von der Familie gewählt habe, wurde nicht einmal kommentiert, aber meine Entscheidung, über eine Schwarze Frau zu schreiben, wurde mehrmals in Frage gestellt. Dabei könnte die Beschreibung einer Schwarzen weiblichen Realität als Beitrag zur Entwicklung eines gemeinsamen Vokabulars gedeutet werden.
Mir ist aufgefallen, dass im deutschsprachigen Kontext große Unsicherheit hinsichtlich der Personenbezeichnung ›Schwarz‹ herrscht. Viele haben gelernt, es sei unhöflich eine Person ›Schwarz‹ zu nennen, denn die Farbe ist symbolisch überwiegend negativ konnotiert.
Wenn ich mich selber als Schwarze Frau bezeichne, geht es mir jedoch nicht darum, meine vermeintliche Hautfarbe zu benennen. Weder ›Schwarz‹ noch ›weiß‹ beschreiben unverrückbare Eigenschaften einer Person, sondern soziale Positionierungen.
›Weiß‹ wird oft aus dem Grund klein und kursiv geschrieben. ›Schwarz‹, mit einem großen ›S‹, ist die Selbstbezeichnung für Menschen, deren Leben von Diskriminierung und Ausgrenzung, aber auch von vielfältigem Widerstand geprägt ist. Die Bezeichnung ›Schwarz‹ weist auch auf mein kulturelles Erbe hin; dass ich Teil der afrikanischen Diaspora bin.
Eine weitere politische Selbstbezeichnung ist ›People of Color‹ oder POC. Diese wird auch in Deutschland auf Englisch benutzt, um Menschen zu bezeichnen, die ebenfalls rassismuserfahren sind, aber nicht unbedingt Teil der afrikanischen Diaspora.
Schwarzsein ist eine Brille, durch die ich die Welt erlebe, betrachte und analysiere. Es gehört genauso zu meinem Erleben dazu wie mein Frausein. Genauso viel Sinn ergibt es für mich, gefragt zu werden, warum ich in meiner künstlerischen Arbeit Elternsein, Weiblichkeit oder London thematisiere. Gleichberechtigung erfolgt sicherlich nicht durch das Abnehmen der Brille des Schwarzseins. Ich werde dann nicht plötzlich weiß. Gleichberechtigung strebe ich an, indem ich die Vokabeln finde, um zu beschreiben, was ich durch meine Brille sehe.
In Synchronicity erzählt Cee fast eine Woche lang, dass sie Angst hat, die Farbe Braun zu verlieren. Am Tag sieben passiert es:
»[…] Als mein Braun schließlich verschwand, verlor ich meine Fähigkeit, auf den ersten Blick zwischen Schwarzen Menschen, weißen Menschen und People of Color zu unterscheiden – was mir potentiell eine ganze Menge neuer Probleme hätte bescheren können.
Von diesem Tag an hörte ich auch auf, in den Spiegel zu schauen. Ich hatte zu große Angst davor, das ›neue‹ Ich zu sehen. Um mich abzulenken, summte ich beim Anziehen vor mich hin und hielt meine Augen geschlossen, wenn ich meine Handschuhe und Socken wechselte. […]«
Die Formulierung »auf den ersten Blick« ist absichtlich so gewählt. Während des Schreibens setzte ich mich mit der Frage auseinander, ob, und wenn ja, woran, ich erkennen könnte, ob eine Person weiß oder Schwarz ist, wenn ›ich‹ die Fähigkeit verlieren würde, Farben zu sehen?
Ich kam auf Privilegierung im Allgemeinen. Was macht es mit einer Person, in einer gesellschaftlich dominanteren Position zu sein? Zum Beispiel: Männer in einem Patriarchat? Oder heterosexuelle Personen in Ländern, in denen Homosexuelle verfolgt werden? Oder Hörende zu sein in einer Gesellschaft, in der die Gebärdensprache nicht in Grundschulen unterrichtet wird?
Ich bin eine cis Frau. Das bedeutet, dass mir bei meiner Geburt ein Geschlecht zugewiesen wurde, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich mich noch immer identifiziere und mit dem die Gesellschaft mich auch wahrnimmt. Mir ist erst seit wenigen Jahren bewusst, dass es Menschen gibt, die sich weder als weiblich noch männlich definieren können oder möchten. Wenn ich mich in Räumen mit anderen cisgender Menschen bewege, fühle ich mich sicher. Selbstbewusst. Selbstverständlich und ohne darüber nachzudenken suche ich die Toilette auf, auf der das Frauchen steht.
Um diese Sicherheit abzubilden kam ich unweigerlich auf Körpersprache.
»[…] Ich ging um die Ecke und, als wäre es Zauberei, da war er wieder. Dieser Polizist. Ich erkannte ihn dieses Mal sofort, weil er einen ganz bestimmten Gang hatte. So als wäre er dankbar, überhaupt laufen zu können. Genaugenommen, wenn ich ein Wort wählen müsste, um seine Körpersprache zu beschreiben, dann wäre es: Dankbarkeit. Das faszinierte mich wirklich sehr. Ich starrte ihn eine ganze Weile an, während ich auf ihn zulief – er war vertieft in ein Gespräch mit seinem weißen Kollegen. Ich konnte erkennen, dass der Kollege weiß war, weil sein Gang insgesamt kräftiger und autoritärer war. Er platzierte seine Füße fest auf den Boden und jeder Schritt brachte die seit Generationen empfundene Selbstverständlichkeit von Recht und Besitz zum Ausdruck. […]«
In deutschsprachiger Belletristik ist die explizite Benennung von Weißsein ungewöhnlich. Synchronicity wurde von mir in einer Online-Leserunde vorgestellt. Hier folgen einige Kommentare der Leserinnen (alle Hervorhebungen sind von mir):
»Erst wenn die Farben fehlen, merkt man wie wichtig sie sind. Sie vermitteln Stimmungen, geben Signale. Jetzt fehlt auch noch das Rot. Im Straßenverkehr fällt das natürlich sehr auf. Warum betont Cee immer die ›weißen‹ Menschen?«
»Grün scheint ihr nicht so wichtig zu sein, Hauptsache das Braun bleibt erhalten. Sie macht sich jetzt Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Schon wieder die Betonung auf ›weiß‹. Verurteilt sie weiße Menschen?«
»Das mit den ›weißen‹ Menschen ist mir auch aufgefallen, bzw. ich bin darüber gestolpert, da die Hautfarbe für mich persönlich keine große Rolle spielt. Bestimmt spielt es für die Geschichte noch eine besondere Rolle.«
»Hmm, bei Tag 5 kommt lila irgendwie gar nicht vor. Dafür das Lila ihre Lieblingsfarbe ist, hat die Farbe in diesem Abschnitt keinen hohen Stellenwert. Und schon wieder die Hautfarbe...langsam find ich es bisschen nervig. Sorry.«
Es ist interessant, dass die einfache Benennung des Weißseins solche unangenehmen Gefühle bei den Leserinnen ausgelöst hat. Auch bei Lesungen von Synchronicity habe ich jahrelang die steigende Spannung an den entsprechenden Stellen gemerkt. Und sogar bei der Vorbereitung dieser Rede, als ich schrieb, dass Annette von Droste-Hülshoff »über die Stellung der weißen Frau im 19. Jahrhundert« dichtete, hielte ich kurz inne. Viele sind nicht gewöhnt, von ›weißen Deutschen‹ zu reden, und verwenden lieber die Begriffe ›biodeutsch‹, ›deutsch-Deutsch‹, ›herkunftsdeutsch‹ oder ›deutsch ohne Migrationshintergrund‹. Dabei ist die Logik hinter diesen Begriffen, dass es so etwas wie ›richtige‹ Deutsche gäbe, und es ist einer Person anzusehen, ob sie ›wirklich‹ deutsch ist. Diese Annahme ist irreführend.
Meine weiße Freundin und ich haben zum Beispiel beide britische Pässe und sprechen fließend Deutsch. Sie hat noch nie erlebt, dass sie direkt als erste Frage auf ihre Herkunft angesprochen wurde. Bei mir ist die erste Antwort selten ausreichend. Und wenn ich als ›Frau mit Migrationsgeschichte‹ bezeichnet werde, denken die Menschen gewiss nicht an Großbritannien, das Land, in dem ich aufgewachsen bin.
Weißsein zu benennen fühlt sich unangenehm an, vermutlich weil es in doppelter Hinsicht mit einer Norm bricht. Zum einen ist es einfach als Handlung unüblich. Zum anderen gelten weiße Menschen dadurch nicht mehr als unmarkierte Norm. Allerdings, wie eingangs erwähnt, wird es kaum möglich sein, gemeinsam Diskriminierung zu bekämpfen ohne ein gemeinsames Vokabular.
In Synchronicity gibt es eine Figur, Frau Bahir, die die Blutkrankheit Sichelzellanämie hat. Eine andere weiße Freundin von mir schrieb dazu:
»Ich studiere ja Medizin und im Studium ist die Sichelzellanämie schon oft als Beispiel für genetische Erkrankungen genannt worden; natürlich stets ver_ortet in ›Afrika‹ […] Erst beim Lesen von Synchronicity ist mir aufgefallen, dass bisher - also innerhalb von 7 Semestern Studium - noch kein_e Dozent_in auf die Idee gekommen ist, über das zu sprechen was für einen betroffenen Menschen ja relevant ist und zwar die Symptome dieser Erkrankung. Gleichzeitig fiel mir auf, dass mir das Aussparen dieses eigentlich relevanten Wissens vorher auch noch nie aufgefallen war. Ich wusste nicht, dass Sichelzellanämie schmerzhafte Anfälle macht. Was für ein Beispiel für den alltäglichen, subtilen Rassismus!«
Ich fand dieses Feedback bezeichnend, weil es so schön zeigt, welche Erfahrungsräume Literatur aufmachen kann.
Wären die entsprechenden Entscheidungsträger_innen nur bereit zu erkennen, dass die deutschsprachige Literaturlandschaft um einiges diverser werden könnte! Was wenn die Welt nicht mehr überwiegend aus der weißen cis männlichen Perspektive erzählt würde? Wo sind die deutschsprachigen Figuren wie Sethe aus Toni Morrisons Beloved oder Ifemelu aus Chimamanda Ngozi Adichies Americanah oder Clara in Zadie Smiths White Teeth? Es fehlen nicht nur Schwarze Autor_innen, sondern unter anderem auch Übersetzer_innen of Color, Literaturagent_innen mit Fluchterfahrung, queere Lektor_innen, muslimische Kritiker_innen, Verleger_innen im Rollstuhl und nicht-binäre Kulturmanager_innen. In einer 2016 vom Deutschen Kulturrat veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass »von einer Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich noch nicht gesprochen werden kann«. Eine nüchterne Aussage, die nur knapp anfängt, die Oberfläche des Problems anzukratzen.
Mein Gedankenexperiment am Anfang der Rede mag absurd geklungen haben. Aber seit wann gibt es den modernen Pass? Seit etwa 100 Jahren? Was war davor? Und was sagt ein Pass ›wirklich‹ über eine Person aus? Wie viel Sinn ergibt es für unser tagtägliches Zusammensein, Menschen überhaupt in Nationalitäten einzuteilen? Für die Menschen unter uns, die ohne irgendeine Selbstverschuldung sich hier illegalisiert aufhalten, ist es lebensbedrohlich. Egal welche vereinfachten Argumente und scheinbare Rechtfertigungen es für die Kettenduldung, die Residenzpflicht oder die Abschiebehaft gibt – unser Asylsystem ist brutal und unmenschlich.
Diejenigen von uns, die keine Fluchterfahrung haben, sind nicht talentierter, fleißiger oder attraktiver als Schutzsuchende ‒ wir haben einfach Glück gehabt. Und wir haben jenem höheren Wesen, das wir verehren, dafür zu danken. Gerade als Britin weiß ich, es ist nicht selbstverständlich, dass es so bleibt. Gesetze können und werden sich ändern. Und plötzlich sind es nicht nur die vermeintlich Anderen, die kriminalisiert werden, sondern auch wir.
Das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz ist ein gutes Beispiel. Laut Gesetz ist der Polizei bundesweit gestattet, bei der Suche nach Ausreisepflichtigen Wohnungen zu betreten und zu durchsuchen.
Spätestens jetzt sollte es klar sein: Wir müssen mit dem Schweigen brechen.
Ich gebe Annette von Droste-Hülshoff das letzte Wort:
»Wer nach seiner Überzeugung handelt, und sei sie noch so mangelhaft, kann nie ganz zugrunde gehen, wogegen nichts seelentötender wirkt, als gegen das innere Rechtsgefühl das äußere Recht in Anspruch zu nehmen.«
Vielen Dank.
Das Droste Festival 2019 wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und das Droste-Forum e.V.
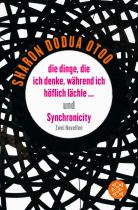
Ingeborg-Bachmann-Preis 2016: Sharon Dodua Otoo »hat den wohl angesehensten deutschsprachigen Literaturpreis gewonnen« Philip Oltermann, The Guardian
»fabelhaft«, »beeindruckend«, »lang nachwirkende Stolpersteine«, »Satire, Witz und Ironie« – Sharon Dodua Otoo löst mit ihrem Schreiben und Denken große Begeisterung aus.
In ihren ersten beiden Novellen ›die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle‹ und ›Synchronicity‹ erzählt Sharon Dodua Otoo mit phantastischer Leichtigkeit, herzlichem Humor und schonungslosem Scharfsinn von Farben und Grautönen, von Unsicherheiten und Empowerment.
Sie hat einen deutschen Mann geheiratet, den schönsten Mann, und seinen Namen stolz getragen, bis sich herausstellt, dass seine andere Frau ausgewiesen wird. In ›die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle‹ erzählt Sharon Dodua Otoo von einem bitteren Verlust, einer schonungslosen Bilanz und einer mutigen, trotzigen und willensstarken Frau, die sich neu erfindet.
Erst ist das Gelb weg, dann das Grün, das Blau und schließlich das Braun. Cee sieht keine Farben mehr, auch nicht ihre eigene Haut. Dann kehren die Farben zurück. Aber so einfach ist es nicht ... ›Synchronicity‹ ist eine irrwitzige und verblüffende Geschichte, eine Adventsgeschichte.
»die Welt ist jederzeit zu erschüttern«, Sandra Kegel, Jurorin Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /