Dankesrede Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg, 8.6.2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
als ich kürzlich in Bamberg eine Poetikvorlesung hielt, kam ich mit Studenten ins Gespräch über Literatur. Ich weiß nicht mehr, über welches Buch wir sprachen. Kennen Sie Montauk? Kennen Sie Berlin Alexanderplatz? Ja, sagte einer der Studenten, kenne ich. Um etwas später und etwas leiser hinzuzufügen: Gelesen habe ich das Buch allerdings nicht.
So habe ich mich die ersten Jahre meiner Schriftstellerexistenz durchgeschlagen. Statt – wie ich es heute tue – zuzugeben, dass ich ein Buch, einen Autor nie gelesen habe, hatte ich eine Vielzahl beschönigender Antworten bereit. Pessoa? Ich habe viel über ihn gelesen. Stendhal? Habe ich mir kürzlich gekauft. Moravia? Habe ich mir schon lange vorgenommen. Karl Kraus? Ich glaube, ich habe Auszüge gelesen. Bulgakow? Wurde mir schon oft empfohlen. Cervantes? Lese ich, wenn ich pensioniert bin. Dostojewskij? Nicken und etwas Unverständliches murmeln. Und Friedrich Hölderlin? Ja, klar. Die späten Gedichte sind sehr beeindruckend. Schwierig.
Ich musste den Friedrich-Hölderlin-Preis gewinnen, um mir klarzuwerden, dass ich fast nichts von diesem großen Autor gelesen habe. Sein Name ist so omnipräsent in Literaturkreisen, dass man gerne annimmt, alle hätten seine Werke gelesen – man selbst eingeschlossen. Beschämt über meine Leselücke fing ich an herumzufragen bei Germanisten, Lehrern, Verlagsleuten. Und fast immer kam dieselbe Antwort: Fast alle hielten große Stücke auf Hölderlin, aber hatten wie ich kaum mehr als ein paar Gedichte von ihm gelesen. Einige hatten immerhin den Hölderlinturm in Tübingen besucht, an dem ich aus Diskretion immer nur vorbeigegangen war.
Vielleicht wäre das der Moment, eine kulturpessimistische Klage anzustimmen über die Vernachlässigung der Klassiker, über unser schwindendes Langzeitgedächtnis und die Beschleunigung im Literaturbetrieb. Aber da ich selbst zu den Tätern gehöre, werde ich mich hüten, dergleichen zu tun und stattdessen Entschuldigungen suchen.
Fünftausend Bücher, ich glaube Arno Schmidt hat diese magische Zahl genannt, liest ein fleißiger Leser – oder eher eine fleißige Leserin – in seinem oder ihrem Leben, eine zugleich beeindruckend große und doch winzige Zahl, wenn man das beinahe unerschöpfliche Reservoir an Literatur bedenkt. Um uns vor dem Untergang im Meer der Bücher zu bewahren, haben sich wohlmeinende Menschen immer wieder bemüht, für uns alle eine Auswahl zu treffen, die paar Bücher auszuwählen, die jede und jeder gelesen haben sollte. Ein verführerischer Gedanke. Der letzte Kanon, der in der Presse für einiges Aufsehen sorgte, war jener den Marcel Reich-Ranicki ab 2002 im Insel Verlag veröffentlichte. Zwar betonte er damals, ein Kanon sei kein Gesetzbuch, aber er meinte auch »ohne Kanon gibt es nur Willkür, Beliebigkeit und Chaos und, natürlich, Ratlosigkeit« und »der Verzicht auf einen Kanon würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten«.
Marcel Reich-Ranickis Auswahl umfasst 8112 Seiten hochwertigstes Romanmaterial von Goethe bis Thomas Bernhard, dazu kommen 5.700 Seiten Erzählungen, 4.500 Seiten Dramen, 2.096 Seiten Gedichte und 4.448 Seiten Essays. Arno Schmidts fleißiger Leser würde für die 25.000 Seiten vielleicht zwei Jahre brauchen. Aber was ist mit dem russischen Kanon, dem amerikanischen, französischen, spanischen, skandinavischen? Das Pflichtprogramm der Weltliteratur würde mehrere Leseleben füllen. Dabei ist es gar nicht die Menge an kanonisierter Literatur, die mich schreckt.
Marcel Reich-Ranicki hat die Barbarei und das Chaos erlebt, den Missbrauch der Literatur zu politischen Zwecken. Ich kann sein Bedürfnis verstehen, das Wertvolle vom Wertlosen, das Hilfreiche vom Gefährlichen zu unterscheiden, wie er das im Literarischen Quartett brillant gemacht hat. An die Idee des Kanons aber glaube ich nicht. Es ist, als würde ein Arzt eine Liste der zehn Medikamente erstellen, die jeder einmal in seinem Leben genommen haben muss. Die Verfasser von Kanons – verzeihen Sie den hässlichen Plural, aber er ist korrekt – missachten sowohl die Vielfalt der Bücher als auch jene der Menschen. Vor allem aber missverstehen sie den Akt des Lesens als eine Art kulturelle Akkumulation. Sie scheinen zu glauben, jeder von uns hätte ein Lesekonto, auf dem alle Lektüren als Eingänge verbucht werden und auf dem sich so nach und nach der geistige Reichtum ansammelt. Der Verfasser des Kanons wäre dann der Anlageberater, der die Bücher nach ihrem Wert einordnet und uns sagt, welche Klassiker Blue Chips sind, die in keinem Portfolio fehlen dürfen, und welche Startups vielversprechend und eine Leseinvestition lohnen.
Der bekannte Landschaftsarchitekt Günther Vogt, den ich vor einigen Jahren porträtierte, meinte, Lesen sei das letzte Abenteuer. Zu einem Abenteuer aber gehört die Ungewissheit, die Gefahr. Nichts ist langweiliger als Bestsellerregale. Der leidenschaftliche Leser wagt sich ins Dickicht der Regale, zieht unscheinbare Bücher heraus von Autorinnen, deren Namen er noch nie gehört hat, liest eine Seite, dann zwei, liest sich fest. Am spannendsten aber sind Antiquariate, in denen uns ein Entdeckerfieber befallen kann, wenn wir in den verstaubten Regalen Bücher finden, die längst vom Markt verschwunden sind und nur für uns dort zu stehen scheinen: Erbarmen mit den Frauen von Henry de Montherlant, der berührende und unterhaltsame Briefwechsel von Felix Moeschlin und Elsa Moeschlin-Hammar, ein Gedichtband von Henry Reed, von dem es weltweit nur wenige hundert Exemplare geben dürfte. Lauter Bücher, die es nie in einen Kanon schaffen würden und die es sich doch zu lesen lohnt.
Als ich zum S. Fischer Verlag wechselte, bekam ich die kritische Ausgabe von Franz Kafka geschenkt, einen Meter wunderschön gemachter und kritisch edierter Bände in Schubern. Aber in meiner Bibliothek bilden sie in ihrer Einförmigkeit einen Fremdkörper. Wie ein Wolkenkratzer stehen sie in einer Favela aus zerlesenen Taschenbüchern und Reclamheftchen. Die Kafkatexte, die ich gelesen habe, sind ein Bündel struppiger Bände, die ich mir nach und nach zusammenkaufte, eingerahmt von Ricarda Junges Die komische Frau und Kapka Kassabovas Tangoautobiographie Twelve Minutes of Love.
Ein Buch ist viele Bücher. Jede Leserin, jeder Leser macht es zu ihrem oder seinem eigenen. So wie ein Mensch für den einen ein Freund, für den anderen ein Feind, ein Bruder, Vater oder Sohn, ein Schüler oder ein Lehrer sein kann, so ist dasselbe Buch für jeden ein anderes. Keine dieser vielen Beziehungen ist gültiger, ist richtiger als die andere.
Ich habe mich oft über die Vehemenz von Kritikern, von Lesern überhaupt gewundert. Während man im Restaurant ganz einfach das Gericht wählt, das einem zusagt und die anderen kommentarlos übergeht, scheinen Leser Bücher, die ihnen nicht gefallen, oft richtiggehend zerstören zu wollen. Vielleicht hat das mit der Wesenhaftigkeit von literarischen Texten zu tun. Anders als ein Gericht, das uns schmeckt oder nicht schmeckt, lösen sie etwas in uns aus. Sie durchbrechen die Grenze unseres persönlichen Raums, kommen ganz nah an uns heran. Die Nähe, die beim Lesen entsteht, kann sehr schön sein, wie jene zu einem geliebten Menschen, aber sie hat auch etwas Bedrohliches. Wenn wir sie nicht zulassen können, nicht zulassen wollen, müssen wir die Grenze zurückerobern und das Buch aus unserem Raum vertreiben. Dann wünschen wir uns, es wäre nie geschrieben worden.
Unter dem Titel Where I’m Reading From, Woher ich lese hat Tim Parks kürzlich in der New York Review of Books vorgeschlagen, alle Kritiker sollten ihre Lesebiographien veröffentlichen, damit die Leser ihre Stellungnahmen besser einordnen könnten. Es sei, meint er, illusorisch zu glauben, ein Kritiker könne ein Buch unvoreingenommen lesen. Unvoreingenommen zu sein, schreibt Parks, würde bedeuten, von nirgendwoher zu kommen, niemand zu sein.
Ohne Kanon gebe es nur Chaos, hat Marcel Reich-Ranicki gesagt. Das ist nur wahr, wenn man sich keine andere Ordnung als eine Rangliste vorstellen kann. Dabei gibt es nichts Unfruchtbareres – und nichts Vergänglicheres – als Bestenlisten. Wer viel liest, fängt an, in der Masse der Bücher viel spannendere Strukturen und Muster zu entdecken. Die Welt der Texte ist zwar unüberschaubar, aber sie ist alles andere als ungeordnet. Wie in einem Gehirn, in dem jede Zelle mit tausend anderen verbunden ist, bestehen auch zwischen Büchern die vielfältigsten Verbindungen. Jenseits der Nationalliteraturen gibt es Familien von Autoren, die dieselben Ziele verfolgen, die sich aufeinander beziehen, sich zitieren, sich parodieren, sich die Referenz erweisen, voneinander lernen oder einfach nur abschreiben. Es gibt Schüler und Lehrer, Einzelgänger und Mitläufer, verfeindete Gruppen. Motive ziehen sich durch die Literaturgeschichte wie durch gute Bücher.
Ich habe den Verdacht, dass Kanons nicht gekauft werden, um gelesen zu werden, sondern im Gegenteil, um die Bücher nicht lesen zu müssen. Man kauft sie, um sie ins Regal zu stellen. Schön und ordentlich sehen sie aus, die sorgfältig gemachten Bände, eine kleine Elitearmee der Literatur, bereit für den Kampf gegen Willkür und Beliebigkeit. Wenn man sie dann und wann betrachtet, kann man sich einbilden, dass es so wenig bräuchte, um alles gelesen zu haben, was sich zu lesen lohnt. Ein behaglicher Gedanken. Aber leider ein irriger.
Und ich und Hölderlin? Mein netter Verlag hat die gesammelten Werke Hölderlins in einem Band im Angebot und hat ihn mir geschenkt (mein Verlag schenkt mir viele Bücher). Jetzt steht er da, schön sieht er aus zwischen Jakob van Hoddis Weltende und Felicitas Hoppes Der beste Platz der Welt. Irgendwann wird der richtige Moment kommen, ihn aus dem Regal zu nehmen. Dann wird eine Beziehung zwischen mir und den Texten entstehen. Und vielleicht wird es der Beginn einer langen Freundschaft sein. Nicht weil Friedrich Hölderlin ein großer Dichter war, der in keinem Kanon fehlen darf, sondern weil seine Gedichten mich berühren werden.
Autoren haben nicht nur Beziehungen zu Büchern und anderen Autoren. Neben dem Namen, der auf dem Buchrücken steht, gibt es viele Menschen, die dazu beitragen, dass die Texte geschrieben, die Bücher entstehen können. Mein Dank gilt zuallererst meinen Eltern, meinem Vater, der mir die Augen für die Schönheit der Literatur geöffnet hat, und meiner Mutter, die für mich und meine Geschwister Geschichten erfand und mich später immer ermahnte, kurze Sätze zu machen. Ich möchte Elisabeth Raabe und Oliver Vogel danken, die mir über die Jahre als strenge und geduldige Lektoren zur Seite standen, dem S. Fischer Verlag, in dem ich mich als Teil einer Familie von Bücherfreundinnen und -freunden fühle. Ich möchte Michael Hofmann für seine wundervolle Laudatio danken und – stellvertretend für alle Übersetzerinnen und Übersetzer meiner Bücher – für seine großartige Übertragungsarbeit. Und natürlich und vor allem möchte ich meiner Familie danken, meiner Freundin Stefania, die oft meine erste und durchaus nicht unkritischste Leserin ist, und meinen beiden Söhnen Matteo und Fabio, die meine vielen Abwesenheiten (fast) klaglos ertragen und die mir immer wieder helfen, im realen Leben verankert zu bleiben. Zu guter Letzt möchte ich den Mitgliedern der Jury für ihre Entscheidung danken und der Stadt Bad Homburg für ihre Großzügigkeit und den herzlichen Empfang.
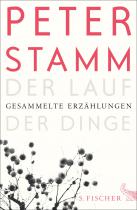
Sämtliche Erzählungen von Peter Stamm in einem Band, darunter einige bisher unbekannte
Peter Stamm erzählt gelassen und mit großer Präzision, mit wenigen Worten entfaltet er Welten: Momentaufnahmen eines Glücks oder der Sehnsucht nach Veränderung entstehen. Seine Figuren erleben Enttäuschungen und Wunder. In klaren Sätzen und bewegenden Bildern entstehen Augenblicke größter Intensität. Die Leser dieser Erzählungen verstehen mehr: von der Liebe, dem Menschen, vom Leben. Peter Stamm ist ein Meister der Kurzgeschichte.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /