Monika Maron: Nein, sowas Ekelhaftes mache ich nicht: Gassi gehen, pfui Teufel. Ich sage auch nicht Prenzlberg oder Kita, sondern Prenzlauer Berg und Kindergarten. Ich war spazieren, mein Hund hat mich begleitet. Oder mein Hund war spazieren und ich habe ihn begleitet, wie Sie wollen. Außerdem musste er pinkeln oder zwei Haufen machen, die ich ordentlich in schwarzen Tüten beseitigt habe, was allerdings eine unangenehme Übung ist, zumal zu Tagesbeginn. Aber wenigstens ist das eine einsehbare Forderung, im Gegensatz zum Rauchverbot, was mich zu der Frage veranlasst, ob Sie als gesundheitsgefährdeter Raucher heute auch schon spazieren waren, obwohl ein Spaziergang ohne Hund ziemlich langweilig sein muss.
Die Vorstellung, ich begänne meinen Tag damit, Hundehaufen in schwarze Tüten zu sammeln, ist mir sehr fern und fremd. Und so sicher ich nie einen Hund (oder ein anderes Haustier) halten werde, so wenig gehe ich spazieren. Und wenn, dann zusammen mit meiner Frau und natürlich auch rauchend. So wie jetzt am Schreibtisch mit Blick auf die kleine Dorfstraße, die am Haus vorbeiführt. Dort sind heute Morgen auch schon die üblichen Verdächtigen vorbeigegangen – zwei ältere Männer mit ihren Hunden. Die kommen – man kann die Uhr nach ihnen stellen – jeden Tag. Und allein dies – diese erzwungene Regelmäßigkeit von Tagesabläufen, die der Hund verlangt – würde mich wahnsinnig machen. Ihren Tag und Ihre Seele scheint das offenbar zu stabilisieren.
Da jede zeitliche Regel in meinem Leben ausschließlich von mir selbst aufgestellt wird, ist das bisschen vom Hund erzwungene Regeldiktat gut zu ertragen, zumal der Hund sehr rücksichtsvoll ist. Ob mich das stabilisiert? Das Leben mit einem Hund ist glücklicher als ein Leben ohne Hund. Hätte ich schon früher gewusst, wie schön das Leben mit einem Hund ist, hätte ich sicher nicht so oft geheiratet.
Seit Beginn dieses Jahrhunderts, also seit dem Aufsatz ›Die Berliner und die Hunde‹ (2000), steht ihr Werk sehr signifikant (auch) im Zeichen des Hundes. Verbunden sind damit sehr häufig ein Wort und ein Zustand: Glück. Das bringen Sie auch jetzt sofort ins Spiel. Aber bevor ich mich darauf einlasse, nur soviel: Ich würde sehr viel lieber noch manche Liebesgeschichte mit einer Frau erleben – und endete sie auch noch so unglücklich –, als etwa durch einen Hund diese Existenz-Emphasen gleichsam zu befrieden. Denn um eine Befriedung solcher Aufgewühltheiten scheint es sich bei Ihnen zu handeln, wenn Sie vom glücklicheren Leben mit einem Hund reden.
Jetzt geht aber alles ein bisschen durcheinander. Ich habe vom Heiraten gesprochen, Sie sprechen von der einen oder anderen Liebesgeschichte. Und dann die ewige Unterstellung der Leute, die nicht wissen, wovon sie reden, weil sie nie mit einem Hund gelebt haben: der Hund als Ersatz. Der Hund ist kein Ersatz. Das Bündnis zwischen Mensch und Tier – und der Hund ist das einzige Tier, das sich auf ein Bündnis mit dem Menschen eingelassen hat – ist ja nicht etwas, das erst mit den altersbedingten Defiziten beginnt, sondern meistens in der Kindheit. Fast alle Kinder wünschen sich einen Hund, weil sie die Verwandtschaft zu anderen Tieren tiefer und natürlicher empfinden als die Erwachsenen, die gern vergessen, dass auch der Mensch ein Tier ist. Die Freundschaft mit einem Hund belebt in uns etwas, das sonst stumm bliebe, der Hund stellt uns vor Fragen, die uns ohne ihn gar nicht in den Sinn kämen. Er ist kein Mensch, aber wir können uns mit ihm verständigen. Er empfindet Freude, Leid, Glück, sogar Verantwortung wie wir. Einen Hund zu beobachten verhilft außer zu äußerster Freude auch zur Selbsterkenntnis. Ich erkenne meinen tierhaften Anteil und natürlich die menschliche Differenz. In einer Zeit, in der wir ein unabsehbares Bündnis mit den Maschinen eingegangen sind, ist das Bündnis mit einem Tier wie eine Vergewisserung unserer eigenen Natürlichkeit. Es ist kein Zufall, dass der Hund in der Literatur so präsent ist: Jack London, Turgenjew, Tschechow, Maeterlinck, Thomas Mann, Sie wissen selbst, die Reihe ist endlos. Jeder Schriftsteller, der einen Hund hatte, war fasziniert von der Beziehung zwischen Mensch und Hund.
Ich habe das Wort »Befriedung« benutzt, um etwas sehr Natürliches zu benennen: Dass man mit zunehmendem Alter keine sonderliche Lust auf das Konvulsivische und Chaotische und Unbedingte und Absolute der Liebe mehr hat. Einen Roman wie ›Animal triste‹ hätten Sie, da bin ich mir ziemlich sicher, mit zwanzig oder dreißig noch nicht schreiben können – und Sie würden ihn jetzt wohl nicht mehr schreiben wollen. Er ist also genau zur richtigen Zeit entstanden und veröffentlicht worden, Mitte der neunziger Jahre. Wobei mich verblüfft, dass Ihre spätere Heldin Johanna in den ›Endmoränen‹ und in ›Ach Glück‹ in etwa so alt ist, wie Sie es beim Schreiben und Erscheinen von ›Animal triste‹ waren. Johanna aber kommt schon sehr oft auf ihr Alter und die damit verbundenen Melancholien zu sprechen. Und es ist eben diese Johanna, mit der am Schluss der ›Endmoränen‹ dann auch der Hund mächtig ins Erzählwerk drängt. Nun haben Sie eine stattliche Reihe von Autoren ins Feld geführt, die den Hund poetisch wie poetologisch adeln. Kafka immerhin hat gar nicht viel von diesem Tier gehalten – präziser: für ihn ist der Hund der Inbegriff des Kriecherischen und Niedrigen. Und an ›Herr und Hund‹ von Thomas Mann, einer eher verplauderten Erzählung, ist ja vor allem die Entstehungszeit hochinteressant: Von Frühjahr bis Herbst 1918 hat er daran geschrieben, also nach Abschluss der ›Betrachtungen eines Unpolitischen‹ und während der sich abzeichnenden deutschen Kapitulation im Ersten Weltkrieg. Kurzum: Thomas Manns Hundegeschichte ist die programmatische Entkoppelung eines Autors vom Lauf der Welt.
Das Alter und die Liebe: Was mich betrifft, haben Sie recht. Ob das grundsätzlich stimmt, weiß ich nicht. Es gibt ja Männer, die mit Frauen, die ihre Enkelinnen sein könnten, Kinder zeugen und ganz berauscht sind von ihrem späten Glück. Es soll auch Liebestragödien und -komödien in Altersheimen geben. Und Filme über Alterslieben und Alterssex sind offenbar auch beliebt. Für mich ist das schon ein ästhetisches Problem, ganz abgesehen davon, dass Frauen in einem Alter, in dem Männer noch als halbwegs jung gelten, von den Blicken der selben Männer als geschlechtliche Wesen neutralisiert werden. Ob ich ›Animal triste‹ nicht früher hätte schreiben können, wird nachträglich nicht mehr zu klären sein. Ich habe spät angefangen zu schreiben, und das alles dominierende Thema war das absurde und empörende Leben in der DDR. Aber über verzweifelte, unglückliche Liebe wusste ich auch mit dreißig genug, um darüber zu schreiben, wahrscheinlich anders, vielleicht aber auch nicht. Den ersten Altersschock hatte ich mit dreißig, als ich begriff, dass die Jugend vorbei war. Und der Tod war sozusagen mein Taufpate, 1941 in Berlin geboren.
Johanna in ›Endmoränen‹ und ›Ach Glück‹ ist relativ jung, weil ich dachte, dass sich für eine noch ältere Frau keiner interessiert und in einigen Rezensenten geradezu Ekelgefühle hervorrufen könnte wie schon die Namenlose unbestimmten Alters in ›Animal triste‹. Johanna ist eben eine Frau und kein Mann. Und der Hund taucht so spät auf, weil ich vorher keinen hatte. Übrigens war ich, als ich den Hund angeschafft habe, verheiratet.
Zu Altern und Liebe nur noch soviel: Mir ist Gleichrangigkeit in Liebesverhältnissen wichtig – und das schließt ein zumindest vergleichbares Alter ein. Nun sprechen Sie, ›Animal triste‹ betreffend, indirekt eine Rezension des Buches an, in der sich der Kritiker, es handelt sich um Gustav Seibt (F.A.Z. vom 24. Februar 1996), unter anderem über »Kühnheiten bei der Schilderung alternden Frauenfleisches« echauffierte. Das war in der Tat übel – und fernab jeder literarkritischen Lizenz schlicht die aggressive Abwehr eines Romangeschehens, das diesen Rezensenten offenbar zutiefst verunsicherte. Nun gibt es ja in ›Animal triste‹ auch die ziemlich irrwitzige Seitengeschichte einer Hundeentführung im Rahmen von Liebeshändeln. Jetzt, beim Wiederlesen des Buchs, sind mir diese Passagen gerade ob ihrer stupenden Komik viel stärker aufgefallen als früher. Der Hund, er heißt Parsifal, sorgt hier für äußere Handlungsdynamik – salopp gesagt: für Action – in einem sonst sehr kontemplativen Buch. Sechs Jahre später, auf den Schlussseiten der ›Endmoränen‹, kommt dann ein ausgesetzter Hund ins Spiel, den Johanna an einem Autobahnparkplatz aufliest und mit nach Berlin nimmt – und übrigens auch mitnimmt in ihre Ehe mit Achim, dem Kleist-Forscher. »Ein wunderlicher Anfang«, so endet der Roman. Dieser Anfang am Ende hatte erhebliche Konsequenzen. Denn seither ist der Hund in Ihren Büchern nicht nur Element und Figur der Handlung, sondern auch eine zentrale Metapher des Werks.
In einem früheren Buch, ich glaube ›Überläuferin‹, träumt Rosalind, dass sie mit einem Schäferhund tanzt, der sich dann irgendwie als der Tod erweist. Hunde waren mir immer vertraut. Ich denke, dass sich meine geschwisterliche Beziehung zu dem Hund meiner Kindheit einfach fortgesetzt hat. Ich hatte nie Angst vor Hunden (außer sie kommen im Rudel), sondern war überzeugt, dass man mit jedem Hund reden kann. Ich spreche heute noch jeden Hund an, der einsam vor einem Supermarkt wartet, die meisten freuen sich. Manche starren aber auch nur unbewegt auf die Tür, durch die sein Besitzer entschwunden ist, aber keiner war bisher unfreundlich. So ist es im Leben, in der Literatur ist es natürlich noch anders. Nachdem ich beschlossen hatte, die Geschichte aus ›Endmoränen‹ fortzusetzen, was ursprünglich gar nicht geplant war, musste ich entscheiden, ob Johanna den Hund ins Tierheim bringt oder behält. Hätte sie ihn ins Tierheim gebracht, wäre die Geschichte eigentlich zu Ende gewesen. Alles wäre geblieben, wie es war. Entscheidend ist, dass Johanna dem Zufall in ihrem Leben ein Recht einräumt. Sie behält den Hund, nimmt die Einladung von Natalia Timofejewna an und reist nach Mexiko, sie schmeißt ihr Leben über den Haufen. Ob sie findet, was sie sucht, weiß man nicht, aber es ist wieder möglich. Angesichts der unverstellten Gefühlsäußerungen des Hundes, seiner Fähigkeit, Glück zu empfinden und Glück zu bereiten, empfindet sie die eigenen Mängel oder Verluste. Warum kann ein Hund das und sie nicht? Solcherart Fragen drängen sie letztlich zum Aufbruch.
Wobei zwischen den ›Endmoränen‹ und der (durchaus eigenständigen) Fortsetzung ›Ach Glück‹, dem eigentlichen Hunde-, aber eben auch Aufbruchsroman, noch eine aus den Frankfurter Poetikvorlesungen hervorgegangene Selbstreflexion liegt: ›Wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche‹ (2005). Ausgangspunkt ist dabei die Frage, wie Johannas Geschichte weitergehen könnte – eben als eine Geschichte von Frau und Hund. Mehr noch: Sie begründen Ihre Entscheidung, ›Endmoränen‹ überhaupt fortzusetzen, damit, dass die Begegnung von Johanna und dem noch namenlosen Hund an der Autobahn »unvermutete Folgen« haben musste, die Ihre neue Erzählenergie erst in Gang setzten. Sie sprechen von Johannas Chance, ihr »unbeschäftigtes Herz« wieder zu reaktivieren, Sie sprechen davon, dass Johanna in Gestalt des Hundes »der Zufall« begegnet sei, und Sie geben diesem Zufall dann den Namen »Liebe«. Sehr entscheidend für diese Empfindung ist dabei »das Sprachlose« der Kommunikation. Natürlich handeln die Poetikvorlesungen in der Folge von den dramaturgischen und erzählperspektivischen Problemen, die sich auftürmen und die es zu lösen gilt. Aber grundlegend ist: Es ist der Hund, der sie überhaupt hat entstehen lassen. In ›Ach Glück‹ hat er dann auch einen Namen: Bredow. Der reale Hund, den Sie damals hatten, hieß Bruno, wobei Bruno wiederum der wohl am häufigsten auftauchende Männername in Ihrem gesamten bisherigen Werk ist.
Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass ich einfach über meine Liebe zu Bruno und seine Liebe zu mir schreiben wollte. Ich habe ihn aus einem Tierheim geholt, als er vermutlich drei Jahre alt war. Seitdem kenne ich das Wort Fundhund. Bruno war ein Fundhund. Eine Stunde, nachdem ich ihn nach Hause gebracht hatte, bin ich mit ihm einkaufen gegangen und habe ihn draußen angebunden. Als ich wiederkam, sprang er hoch, schleckte mich ab, als gehörten wir schon immer zusammen. So blieb es bis zum Schluss. Bruno hieß der Lieblingsbruder meiner Mutter, der starb, lange bevor ich geboren wurde. Bruno ist ein schöner Name. Ich benutze gern die Namen aus meiner Familie: Marta, Ruth, Josefa und eben Bruno. Ich befürchte, dass ich viel lüge, wenn ich über die Beweggründe meines Schreibens spreche. An die Wahrheit kann ich mich entweder nicht erinnern oder sie kommt mir zu banal vor, um sie der Öffentlichkeit mitzuteilen. Oder es handelt sich um Geheimnisse.
In ›Zwischenspiel‹, dem jüngsten Buch aus dem vergangenen Herbst, hat der Hund einen, sagen wir, hundeüblichen, also kosehaften Namen: Nicki. Eine Art Fundhund ist auch er. Er gehört der Ich-Erzählerin Ruth gar nicht, er ist plötzlich da in diesem Ostberliner Park in der Nähe des Friedhofs, auf dem Ruth eigentlich sein sollte, um an der Trauerfeier für Olga, ihrer einstigen Schwiegermutter und bleibenden Lebensfreundin, teilzunehmen. Mit und nach Nicki treten an diesem real-surrealen Nachmittag voller Allotria und Allegorie unter anderen auch Erich und Margot Honecker auf – und natürlich auch ein wie stets alkoholisierter und seinerseits längst verstobener Jugendfreund namens, notabene, Bruno. Im Gegensatz zu Bredow aus ›Ach Glück‹ ist Nicki ein durch und durch philosophischer Hund. Es taucht da, ungefähr zu Beginn des letzten Drittels, eine junge Mutter auf, die beides zugleich ist: Eine Hasserin von Hunden und von Rauchern. »Im Park herrscht Leinenzwang«, fährt sie Ruth an, die natürlich gar keine Leine haben kann, weil Nicki ja auch nicht ihr Hund ist. Falls Sie heute noch spazieren gehen mit Ihrem Hund oder Ihr Hund mit Ihnen: Müssen und werden Sie ihn eigentlich an die Leine nehmen? Und wie heißt er eigentlich? Und warum?
Der Name Nicki für den Hund in ›Zwischenspiel‹ ist eine Verbeugung vor der wunderbaren Erzählung ›Niki‹ von Tibor Dery. Mein Nicki muss die Geschichte, wenn sie ins Überirdische abzuheben droht, immer wieder auf die Erde holen. Und er hat nichts zu tun mit der Schuld, die alle Menschen in der Geschichte umtreibt. Er ist unfähig zur Schuld. Mein eigener Hund heißt Momo. Ich habe ihn vom Verein »Hoffnung für vier Pfoten«, der inzwischen »Hoffnung für Streuner« heißt, weil er einen Prozess um den Namen mit einem anderen Vier-Pfoten-Verein verloren hat. Momo ist Grieche und hieß ursprünglich Gizmo, was mir missfiel, so dass ich die erste Silbe gestrichen und die zweite verdoppelt habe. In der Stadt muss er an der Leine gehen, weil er einen hohen Jagdhundanteil hat und es in meinem Viertel ungefähr so viele Kaninchen wie Autos gibt. Außerdem reagiert er auf kleine Rüden, die ihn anglotzen, äußerst ungehalten, wenn ich ihn nicht festhalte. Wenn ich mit Momo spazierengehe, weiß ich jedenfalls, warum die Verständigung zwischen Menschen und Tieren, Mensch und Hund Empfindungen auslösen kann, für die das Wort Glück nicht übertrieben ist.
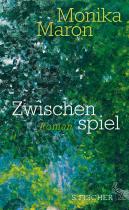
Monika Marons mit großer Klugheit und viel Witz erzählter Roman kreist um existentielle Fragen. Als Ruth am Tag von Olgas Begräbnis erwacht, verschwimmen die Buchstaben vor ihren Augen, und eine Wolke zieht rückwärts. Etwas an ihrer Wahrnehmung hat sich verändert. Ruth verfährt sich auf dem Weg zum Friedhof und gelangt in einen Park, in dem ihr Tote und Lebende erscheinen – ein Selbstgespräch in Szenen und Bildern, in dem Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen.
Mit großer Leichtigkeit fragt dieser so tiefgründige wie humorvolle und phantastische Roman nach den Konsequenzen von Entscheidungen. Gibt es ein Leben ohne Schuld? Wäre ein anderer Weg möglich gewesen?






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /