I. Stalin
Im Dezember 1949 beschließt die tschechoslowakische Regierung, ein Stalindenkmal zu bauen, auf einem Hügel entlang der Moldau. Ein Wettbewerb wird ausgeschrieben, an dem alle Bildhauer des Landes teilnehmen müssen. Ein Zuckerbäcker gewinnt mit einem Entwurf von Stalin an der Spitze einer Gruppe von Arbeitern und Partisanen. Das Denkmal soll groß werden, das größte auf Erden, die kleine Zehe Stalins größer als der größte Schuh. Das Denkmal soll ewig thronen, weswegen es aus Granit gehauen wird. Es erweist sich als schwierig, einen Steinbruch zu finden, in dem man die gewaltigen Granitblöcke schneiden kann. Das Denkmal erweist sich als zu schwer für den Sandsteinhügel, weswegen dieser mit Hohlblöcken aus Beton gefüllt werden muss. 1955 wird das Denkmal eröffnet, am 1. Mai. Kurz davor hat sich der Bildhauer umgebracht, seine Frau hatte schon ein Jahr zuvor das Gas aufgedreht. Der Mann, der für die Figur von Stalin Modell stand, hat sich zu Tode gesoffen, weil ihn alle immer nur »Stalin« nannten. Und ein Arbeiter, der ausgerutscht war, wurde vom kleinen Finger Stalins erschlagen.
1961 wird beschlossen, das Denkmal abzureißen. Aber es erweist sich als schwierig, etwas Ewiges zu entfernen. Eine ungenaue Sprengung würde halb Prag in die Luft jagen. Zudem ist es dem Pyrotechniker verboten, Sprengsätze am Kopf von Stalin zu befestigen. Obwohl die Sprengungen fehlerlos gelingen, bricht der Pyrotechniker zusammen und wird in die Psychiatrie eingeliefert. Die Beseitigung der Trümmer dauert ein Jahr. Die Sprengung wird nirgendwo vermeldet. Das Denkmal hat nie existiert.
Mehr als vierzig Jahre später macht sich der polnische Journalist Mariusz Szczygiel auf die Suche. Im Zentralarchiv wird ihm mitgeteilt, die Dokumente über das Stalindenkmal unterlägen der Geheimhaltungspflicht. Es gelingt ihm, die Geheimhaltung aufzuheben. In den Akten steht kein einziges Wort über den Selbstmord des Bildhauers. Es existiert angeblich auch kein Dossier über ihn. Der Bildhauer des Denkmals hat nie existiert.
Mariusz Szczygiel schreibt: In Situationen, in denen man sagen müsste: »Ich hatte Angst, davon zu reden«, »ich hatte nicht den Mut, danach zu fragen«, »davon hatte ich keine Ahnung« sagt man
»Darüber SPRACH MAN NICHT.«
»Das WUSSTE MAN NICHT.«
»Danach HAT MAN NICHT GEFRAGT.«
Als hätten die Leute keinen Einfluss gehabt und für nichts die persönliche Verantwortung übernehmen wollen.
Es existiert also doch, das Stalindenkmal, es wirft einen Schatten auf das Denken der Bewohner von Prag. Und nicht nur dort.
Romane sind die natürlichen Antipoden von Denkmälern. Das geeignete Instrument für jene, die keine pyrotechnische Ausbildung genossen haben. Romane sind Sprengsätze mit zeitverzögerter Explosion. Mal geht die Ladung hoch, mal nicht, mal kommt es zu einem kräftigen Feuerwerk, mal zu einem kleinen Knaller. Denkmäler sind Ausrufezeichen der Macht (wie viele Denkmäler in dieser Republik erinnern an Deserteure?), Romane sind Fragezeichen des individuellen Widerstands. Sie widersprechen den staatlichen Archiven (ja, er hat gelebt, der Bildhauer, er hieß Otakar Svec, er hat am 3. März 1955 Selbstmord begangen), sie besprühen die Denkmäler mit Graffiti (zugegeben: etwas subtiler und reflektierter als übliches Graffiti).
II. Orpheus
Die Empörung in Ländern wie Bulgarien war unter den Profiteuren der kommunistischen Herrschaft groß, als nach der »Veränderung« 1989 einige Denkmäler im Land, allesamt gigantomanisch, beschmiert wurden. Hören wir etwa den Wutausbruch eines ehemaligen Apparatschiks, Offizier der Staatssicherheit, Politiker, Oligarch der mittleren Kategorie:
»Das Denkmal entehren. Was gibt’s noch, auf das wir alle stolz sein können, wenn nicht auf den antifaschistischen Widerstand? Spuckt mich doch an, wenn ihr euch traut. Was sind das für Zeiten? Ist denn nichts mehr heilig? Schnurrbärte unter die Nase geschmiert, Hakenkreuze in die Brust geritzt, primitive Losungen draufgesprüht, was für Schweine, wie’s mich juckt, denen ‘ne Lektion draufzugeben, die sie nie vergessen. Schufte sind das, faschistische Arschficker. Wo ist der Respekt hin? Wo die Werte? Glaubt noch irgendwer an den Satz: Wer im Kampf für die Freiheit fällt, der stirbt nicht? Alles immer nur entehren. Was anderes können sie nicht. Mein Leben spucken sie an.«
Begraben unter dem Fundament der Denkmäler liegt das verstummte Andenken. Nur in sentimentalen Filmen ist Erinnerung eine Privatangelegenheit. Im wirklichen Leben tobt ein existentieller Kampf um die Erinnerung. Die Verlierer werden ausgelöscht, verschwinden, für längere Zeit oder für immer, aus der Geschichte. Es ist ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite der Apparat, undurchsichtig, gewappnet mit dem Abwehrschild namens »Nationale Sicherheit«, geschmiedet durch die Kontinuität der Machtausübung. Auf der anderen Seite die einzelnen Stimmen, leise, brüchig, kaum zu hören in der Kakophonie der Beliebigkeit. Nur in der Literatur kann Waffengleichheit hergestellt werden. Das ist kein ungefährliches Unterfangen. Einige der größten Dichter Bulgariens wurden von Staats wegen ermordet, wie schon ihr Vorgänger Orpheus, der getötet wurde, weil er zu oft, zu eindrücklich gesungen hat. Die Mänaden zerfleischten ihn, rissen seinen Leichnam in Stücke, warfen seinen Kopf in den Fluss, der heute Maritza heißt. Die Mänaden haben gegrölt und gejault, während sein Kopf auf dem Wasser trieb, dem Meer entgegen, während seine Lippen ein weiteres Lied anstimmten. Singend verabschiedete er sich von seiner Heimat, und dieser Gesang ist verhallt. Es gibt in Bulgarien kein Denkmal für Orpheus, stattdessen ein »Grab« im tiefen Südosten des Landes, das den Besuchern auf einer archäologischen Tafel neben einem überquellenden Abort jeden Zweifel an diesem Leichenschauplatz auszutreiben versucht, bevor diese einen asphaltierten Weg hinab gehen zu einem Druidenheiligtum, entlang eines wackligen Geländers, unter einem Plastikbaldachin, der Orpheus’ ewigen Stummschlaf vor Regen schützt.
Der Abstieg in die Katakomben des Archivs der Staatssicherheit ist eine Reise in einen gegenwärtigen Hades, der von einem uniformierten Kerberos mit hundert Köpfen und hundert Schirmmützen bewacht wird.
III. Kerberos
Als gegen Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts das Archiv der bulgarischen Staatssicherheit zum ersten Mal teilweise-zeitweise zugänglich war, beantragte mein Onkel, jahrelanger politischer Häftling, Einsicht in seine Akte. Er erhielt folgenden Bescheid:
»Gemäß der von uns vorgenommenen Untersuchung in den Archiven der Staatssicherheit hat sich herausgestellt, daß die Staatssicherheit keine Informationen über Sie zusammengetragen hat.«
Vier Jahre lang klopfte er an die schwere Tür des Archivs, vier Jahre lang wurden ihm Lügen zugeworfen, oft wurde er mit leeren Händen weggeschickt, hundert Mal behauptete einer der hundert Köpfe, mehr als die kleine dünne Mappe in seinen Händen sei im Archiv nicht vorhanden. Nach vier Jahren des unentwegten Kampfes gegen den demokratischen Kerberos hatte er zwanzig dicke Aktenordner zusammengetragen.
In diesen Aktenordnern, die als stets sichtbare Mahnung in meinem Arbeitszimmer stehen, ist all das enthalten, was das Leben unerträglich macht: Verfälschungen, Vertuschungen, Verwirrungen und viele vermeintlich kleine, aber umso tragischere Geschichten des Verrats. Etwa jene eines Mannes namens Koljo, der seine untreue Frau erschlägt, daraufhin zu fliehen versucht und an der Grenze gefasst wird. Für Totschlag erhält er zwölf Jahre Haft, für Republikflucht 13 Jahre. Dir werden wir‘s schon zeigen, schrien die Wärter im Gefängnis, du verdammter Vaterlandsverräter. Koljo kapitulierte, denunzierte seine Mithäftlinge.
In diesen Aktenordnern stehen auch Protokolle von Gesprächen unter der Bettdecke, denn unsere beengte Wohnung in Sofia war verwanzt, und so kam ich in den seltenen Genuss nachzulesen, was die Erwachsenen geredet haben als ich ein Baby war. »Du hast es leicht«, sagt eines Tages meine Tante zu meinem Onkel. »Du hast dich an die Schläge gewöhnt. Was soll ich machen, ich kriege vor lauter Angst, dass sie die Hand gegen mich erheben werden, nachts keine Auge zu.« Einige Monate später, mein Onkel war plötzlich verschwunden, sagt meine Großmutter: »Er kann nicht geflohen sein. Er hat doch nicht einmal ein zweites Paar Socken mit. Wo er doch seine Socken zweimal täglich wechselt.«
Es sind solche ungeheuerlichen Miniaturen aus dem Erfahrungsschatz menschlicher Verkrümmung, die das Schreiben anregen, ja geradezu herausfordern. Mir war von Anfang an klar, dass solch ein Material literarisch bearbeitet werden musste, nicht aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehung und des Privilegs, dass mir diese Dokumente in den Schoß gefallen waren. Auf der Folie der jüngsten Entwicklungen hierzulande war ein Roman über das Verhältnis zwischen Geheimdienst und Bevölkerung, zwischen Scherge und Widerständler nicht nur eine Frage von notwendiger Vergangenheitsbewältigung, sondern auch ein Thema von frappanter Aktualität. Indem ich das Verhältnis zwischen Staat und Individuum, das weite Feld zwischen Macht und Ohn-Macht auslotete, würde ich Aufschluss über heutige Konfliktlinien erlangen. Indem ich literarisch über das widerständige Handeln von einst reflektierte, würde ich zu einem aktuellen widerständigen Wort vorstoßen, zu einer ästhetischen Antwort auf eine bohrende politische Frage.
Gewiss, der Roman ›Macht & Widerstand‹ wurde nicht hauptsächlich von einem politischen Impetus vorangetrieben, sondern von der Begegnung mit Zeitzeugen, deren zutiefst berührende persönliche Geschichten erzählt werden mussten, damit ihre Erfahrungen nicht spurlos versickern und ihre Stimmen nicht endgültig verstummen. Erinnerung entsteht, indem sie befragt wird. Sie entsteht, indem Kerberos überwunden und zu Orpheus vorgedrungen wird. Wer sich nicht immer wieder in die Vergangenheit hineinbegibt, der wird vergessen. Gedächtnis wird nicht verdrängt, sondern es verkommt, wie ein atrophierter Muskel, der viel zu lange nicht benutzt worden ist.
IV. Unschuldig
Betrachtet man die beachtliche Zahl von Romanen über Repression in Diktaturen, fällt einem auf, wie oft die Opfer »unschuldig« sind. Bei den vielen Erzählungen von »unschuldig« Verhafteten scheint das Verbrechen des Staates darin zu bestehen, die Menschen ins Politische gezwungen zu haben. Typisch die Ausgangslage in Christoph Heins ›Der Tangospieler‹: »Er war nicht ins Gefängnis gekommen, weil er kriminell, aufsässig oder mutig gewesen war; einer Dummheit wegen hatte man ihn verurteilt und in eine Zelle gesperrt, auch wenn das Urteil etwas anderes sagte und der Richter von etwas anderem überzeugt war. Nichts als ein Irrtum. Ein Versehen beider Seiten.« Eine Dummheit also, ein Versehen. Das erinnert an den inzwischen sprichwörtlichen ersten Satz von Franz Kafkas ›Der Prozess‹: »Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.«
»Etwas Böses« – von welcher Warte aus betrachtet? Ist die staatliche Definition von »böse« die ausschlaggebende, oder meint Kafka die Innensicht seiner Hauptfigur? Das bleibt natürlich offen. Entscheidend ist, dass ein »Unschuldiger« beim Gerichtsverfahren, in Haft und nach der Entlassung sich anders verhalten wird, als ein Widerständiger, der/die genau weiß, wieso er/sie verhaftet worden ist, da er/sie sich im Kampf gegen das Unrechtssystem befindet. Es ist bemerkenswert, wie wenige »schuldige« Opfer, ergo Oppositionelle, wir in der Literatur antreffen, wie wenige Widerstandskämpfer beispielsweise in der deutschsprachigen Literatur über die Nazizeit oder die DDR im Mittelpunkt stehen.
Ein weiterer literarischer Mangel besteht darin, alles dem System in die Schuhe zu schieben, die Freiheitsräume des Einzelnen so sehr zu beschränken, dass im besten Fall Mitläufer und Feiglinge die Romane bevölkern, nicht aber mitverantwortliche Täter. Mit dem Wort »Bösewicht« assoziieren wir heutzutage Monster aus Krimis und Fernsehserien, überzeichnete Figuren wie Hannibal Lecter, dem ein dämonisches Verhalten zugesprochen wird, das den Zuschauer gerade deswegen fasziniert, weil es sich um eine singuläre Übertretung aller moralischen Grenzen handelt, zu der keiner von uns in der Lage wäre. Wir können uns in der Gewissheit wiegen, dass in uns und in unseren Nächsten kein Hannibal Lecter lauert.
Einen anderen Menschen zu töten, zu häuten, sein Fleisch zu kochen und zu verspeisen, ist kaum nachvollziehbar. Daher wirkt so eine Erzählung affirmativ, weil wir sie als abschreckendes Beispiel mit gutem Recht weit von uns weisen können (es wäre ja geradezu lächerlich zu behaupten: die Romane von Thomas Harris warnen uns vor den schlimmen Folgen des Kannibalismus). Deswegen sind derartige Verbrechen entgegen dem üblichen Sprachgebrauch keineswegs »unfassbar«. Im Gegenteil, wir haben einen Ehrenplatz in unserer Imagination für Figuren wie Hannibal Lecter eingerichtet.
Man könnte das Wirken eines solchen Ungeheuers mit den Untaten in Beziehung setzen, die auf den Stolpersteinen in manchen unserer Städte verewigt sind, jenen kleinen memento proditio: hier denunzierte Herr M. seinen leutseligen Nachbarn, hier denunzierte Frau W. ihren homosexuellen Untermieter, hier denunzierte Herr S. seinen jüdischen Kollegen. Unter dem Leder unserer Schuhsohlen befindet sich eine gegerbte Erinnerung an den real existierenden Horror der vermeintlich kleinen Grässlichkeiten, jene, die irgendwie begründet, vielleicht sogar entschuldigt werden können. Interessant wird das Böse als moralische Kategorie und literarische Fragestellung erst dort, wo es mit einem handlichen Schminkkoffer der Selbstlegitimierung daherkommt. »Das Unglück besteht darin«, schreibt Dostojewski, »eine Abscheulichkeit zu begehen, ohne ein Schuft zu sein, oder sich für einen solchen zu halten.« Unfassbar ist der Verrat an unseren Mitmenschen, unfassbar sind die Verbrechen aus einem gemeinsamen Raum der Solidarität und Intimität heraus, Verbrechen gegenüber jenen, die einem ein fröhliches »Guten Morgen« zugerufen haben, die einem beim Umzug oder beim Streichen der Wände geholfen, die gelegentlich auf die eigenen Kinder aufgepasst haben. Der Verrat an Freunden und Kampfgefährten, an Verwandten und Vertrauten, an Kollegen und Mitarbeitern.
»Es gibt die Ungeheuer, aber sie sind zu wenige, als dass sie wirklich gefährlich werden könnten. Gefährlich sind die normalen Menschen«, schrieb der italienische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Primo Levi. Und wir nicken verständnisvoll, und fragen uns, wie es möglich war, dass unsere Vorfahren innerhalb weniger Jahre von normalen Menschen zu gewalttätigen Jüngern eines menschenverachtenden Regimes mutiert sind, und wieder zurück, zu netten, unauffälligen, ganz normalen in die Jahre gekommenen Bürgern. Und dann wundern wir uns, wenn wir lesen, wie gerade in Somalia, in Nordkorea, in Guantanamo, in Irak, »normale« Menschen von anderen »normalen« Menschen brutal und systematisch getötet, gefoltert, missbraucht werden. Hier, und nicht bei Hannibal Lecter, ist der Ort der Unfassbarkeit. Wenn wir kein Maß bei der literarischen Darstellung des individuellen Bösen kennen, nehmen wir das Böse nicht ernst.
Es grassiert eine fatale Haltung der ethischen Übervorsicht gegenüber jenen, die ihre Menschlichkeit verloren haben. Stellvertretend für viele Äußerungen möge die Aussage von Jürgen Habermas stehen: »… als Nachgeborene, die nicht wissen können, wie sie sich unter Bedingungen der politischen Diktatur verhalten hätten, tun wir gut daran, uns in der moralischen Bewertung von Handlungen und Unterlassungen während der Nazi-Zeit zurückzuhalten.« Nein – nein – nein! Das ist eine politisch gefährliche Haltung. Ob ich im tiefsten Inneren befürchte, selber Mitläufer oder gar Mittäter geworden zu sein, spielt keine Rolle für meine Fähigkeit und Berechtigung, Opportunismus grundsätzlich zu verdammen. Selbst wenn ich nicht garantieren könnte (und wer kann das schon), dass ich einen verbrecherischen Befehl verweigern würde, kann ich mit gutem Recht feststellen, dass es eine moralische Pflicht gibt, in solchen Situationen zu widerstehen. Ansonsten erscheinen die Urteilenden als die Schuldigen, wie schon Hannah Arendt erkannt hat: »Die einzigen wirklich Schuldigen, so glaubte man häufig und sagte es sogar, waren die Leute, die sich ein Urteil erlaubten; denn keiner könnte urteilen, der nicht in der gleichen Lage gewesen sei, in welcher ein jeder sich vermutlich genauso verhalten hätte wie alle Anderen.«
Du sollst nicht moralisieren, heißt es heute oft, so als sei der urteilende Mensch zu tadeln, nicht derjenige, der Unrecht tut. Wieso eigentlich? Wir sollten beherzt urteilen, unabhängig davon, wie wir persönlich gehandelt hätten. Die nachvollziehbare Unsicherheit über den eigenen Mut, über die eigene moralische Festigkeit, sollte keinen Einfluss auf unsere grundsätzliche ethische Position haben. So wie wir uns alle in unserer Ablehnung von Kannibalismus einig sind, auch wenn wir keine kategorische Versicherung abgeben könnten, ob wir nicht, ausgesetzt auf einem Floß, in Ermangelung von Alternativen, am Verhungern, in das Fleisch eines jüngst verstorbenen Mitmenschen hineinbeißen würden.
Die hypothetische Rücksichtnahme gegenüber Duckmäusern und Konformisten bedingt nicht nur einen moralischen Relativismus, sie bewirkt auch, dass Mut und Standfestigkeit als hohe Ideale verschwinden. Und mit ihnen auch ein bedingungsloses Bekenntnis zur Freiheit, das nur existieren kann, wenn Menschen bereit sind, diese auch unter enormen Opfern zu verteidigen. Hinnehmen, Dulden, Nichts-Tun wird hoffähig, erscheint akzeptabel. Moralische Nachsicht ist fatal.
V. Anti-Stalin
Thomas Mann hielt am 22. April 1937 in New York eine bemerkenswerte und leider zu wenig bekannte Rede. Der öffentlichkeitsscheue Grandseigneur der deutschen Literatur sprach von der »Selbstüberwindung«, die es ihn koste, »aus der Stille meiner Arbeitsstätte herauszutreten vor die Menschen, um persönlich und mit eigener Stimme für die bedrohten Werte zu zeugen«, bevor er fortfuhr: »Es wäre durchaus falsch und bedeutete, eine schöngeistig schwächliche Haltung, Macht und Geist, Kultur und Politik in einen notwendigen Gegensatz zu bringen und von der Höhe des Spirituellen und Künstlerischen hochmütig auf die politische und soziale Sphäre hinabzublicken. (…) Es war ein Irrtum deutscher Bürgerlichkeit, zu glauben, man müsse ein unpolitischer Kulturmensch sein. Wohin die Kultur gerät, wenn es ihr am politischen Instinkt mangelt, das können wir heute sehen.« Seine Rede trug den unmissverständlichen Titel: ›Bekenntnis zum Kampf für die Freiheit‹.
Jene, die sich unpolitisch wähnen und verhalten, jene, die das Recht des Rückzugs in den Elfenbeinturm propagieren, tun dies, weil es ihnen möglich, um nicht zu sagen, erlaubt ist. Sollten sich die politischen Bedingungen ändern und eine rein ästhetische Poetik nicht mehr bequem und genehm sein, wären sie gezwungen, Haltung einzunehmen, Position zu bekennen oder ihre Dichtkunst in den Dienst außerliterarischer Interessen zu stellen. So ist es im März 1964 dem Dichter Iossif Brodskij ergangen, der in der Sowjetunion in einem aufsehenerregenden Prozess als »Parasit der Gesellschaft« verurteilt wurde, angeblich weil er außer dem Schreiben keiner festen Beschäftigung nachging, tatsächlich aber wegen seiner jeglichen Propaganda abholden Lyrik. So wurde seine metaphysische Poesie über Nacht politisiert. Erst eine gewisse Freiheit erlaubt es den Dichtern und Künstlern, selbst zu entscheiden, welche Art der Dichtung und Kunst sie betreiben wollen. Wenn sie also in Zeiten des Angriffs auf diese Freiheit so tun, als könnten sie den Kopf in den Sand der selbstreferenziellen und weltabgewandten Wortkunst stecken, ist ihnen diese in Wirklichkeit keineswegs so heilig wie sie behaupten, denn sie ermöglichen ihre Profanisierung durch den Verlust von Freiheitsraum. Der Weg zum apolitischen Privileg führt durch politisches Terrain.
»Wie kann es sein, dass wir im Kampf gegen die Diktatur nur so wenige waren?« Diese Frage haben ehemalige politische Häftlinge in Bulgarien in Gesprächen mit mir immer wieder gestellt. Hatten alle anderen keinen Sinn für Freiheit? Opportunisten rechtfertigen sich bekanntlich mit der Tugend des kleinsten gemeinsamen Kompromisses, mit dem Ideal der einsichtigen Abwägung. Man braucht weder große Phantasie noch eine besondere Transferleistung um zu erkennen, dass viele von jenen, die heute die Gefahr für die Freiheit aufgrund der Massenüberwachung und allgegenwärtigen Durchleuchtung kleinreden, vor einem halben Jahrhundert leicht die passenden Argumente gefunden hätten, den damaligen Ausbau totalitärer Strukturen zu rechtfertigen: Die Gefährdung durch den kriegerischen Westen, die Instabilität des jungen Regimes, der drohende Terror durch versprengte faschistische Widerstandsgruppen, und natürlich damals wie heute und solange es den Staat gibt, die alles überragenden Interessen der »Nationalen Sicherheit«.
Aber immerhin bedurfte es eines beachtlichen Mutes, sich damals auf die Seite von Protest, Widerstand oder Rebellion zu schlagen. Heute hingegen müssten Aktivisten in der Europäischen Union im schlimmsten Fall negative Folgen für ihre Karriere oder aufgebauschte Prozesse wegen fadenscheiniger Delikte befürchten. Wieso also lassen sich die meisten Menschen dies gefallen? Oder, mit anderen Worten: Wieso stört es die wenigsten, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird? Auch das ist eine literarische Frage.
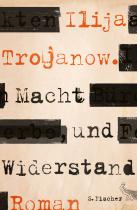
Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert.
Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Geschichten, die Trojanow seit den Neunzigerjahren in Gesprächen mit Zeitzeugen gesammelt hat, verdichtet er zu einer spannenden Schicksalserzählung von menschlicher Würde und Niedertracht. ›Macht und Widerstand‹ ist bewegende Erinnerungsarbeit, ein Roman, wie man ihn in seiner Entschiedenheit und poetischen Kraft lange nicht gelesen hat.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /