Frau Richardsen, Sie sind Spezialistin für die Geschichte der bürgerlichen Frauenbewegung, speziell in München. Wie kam es zu diesem Forschungsschwerpunkt?
Es fing damit an, dass mir Wolfgang Preuss vom Bayerischen Rundfunk 2010 den Auftrag erteilte, eine Film-Dokumentation über die vergessene Münchner Schriftstellerin Carry Brachvogel (1864-1942) zu erstellen, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu den bekanntesten Autorinnen Deutschlands zählte und in der modernen Frauenbewegung engagiert war. Während der Arbeit am Filmprojekt überantworteten mir Nachkommen ihren Nachlass, den ich an die Monacensia im Hildebrandhaus vermittelte. Ich arbeitete mich intensiv in das Werk von Carry Brachvogel ein, entdeckte aber auch im Zuge weiterer Recherchen, u.a. für Filmprojekte, zahlreiche Nachlässe, Briefe und Dokumente von Frauen, die in der Münchner Frauenbewegung engagiert waren. Schnell wurde deutlich, dass es sich hier um eine große und wirkungsvolle Bewegung handelte, die, ausgelöscht durch die Nationalsozialisten, heute in ihrer Tragweite vollständig vergessen ist.
Nun erzählen Sie in Ihrem Buch »Leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen« die Anfänge dieser Geschichte. Warum ist die Münchner Frauenbewegung so wichtig?
Von der Münchner Frauenbewegung, die mit den Frauenorganisationen im gesamten deutschen Reich vernetzt war, gingen damals wichtige Impulse aus. Einzigartig war das Engagement so vieler Künstlerinnen, Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen an vorderster Front: Anita Augspurg als erste deutsche promovierte Juristin, Sophia Goudstikker als erste Königlich Bayerische Hoffotografin. Elsa Bernstein, Carry Brachvogel und Gabriele Reuter, Bestsellerautorinnen, die ihre emanzipatorischen Werke im renommierten S. Fischer Verlag veröffentlichen konnten. Es gab eine enge Verknüpfung mit den künstlerischen Bewegungen der Moderne, mit dem Naturalismus und dem Jugendstil. Geschlechterrollen und Familienbilder wurden auf den Kopf gestellt. Und es ist den Kämpferinnen gelungen, die Anteilnahme von Männern, Gelehrten, Künstlern und Industriellen für ihre Arbeit zu gewinnen, darunter so prominente Persönlichkeiten wie Hermann Obrist, August Endell, Rainer Maria Rilke oder Max Haushofer.
Schließlich konnte 1899 in München der erste Bayerische Frauentag stattfinden, der als überregionale Veranstaltung mit prominenter Besetzung in ganz Deutschland wahrgenommen wurde. München, das den Frauen an diesem Tag den Saal des Alten Rathauses zur Verfügung stellte, wurde damit zum Leuchtturm der modernen bürgerlichen Frauenbewegung.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist »Revolution mit der Feder«. Was ist darunter zu verstehen?
Es ging um den gezielten Einsatz von Literatur und Theater, um politische Ziele durchzusetzen. Es entstanden Stoffe, die sich mit dem Leben bürgerlicher Mädchen und Frauen, der Wilhelminischen Töchtererziehung und dem Verhältnis der Geschlechter auseinandersetzten. Sie schilderten Ausbruchsversuche und entwarfen neue Bilder von Frau und Mann, modern, progressiv und radikal. Tatsächlich ist es den Aufsehen erregenden Büchern von Elsa Bernstein, Carry Brachvogel, Maria Janitschek, Gabriele Reuter oder Adine Gemberg mit zu verdanken, dass sich in den 1890er Jahren der Begriff der modernen Frau überhaupt durchsetzen konnte.
Die Idee einer Revolution mit der Feder geht auf Anita Augspurg zurück, die Initiatorin der Münchner Frauenbewegung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Theaterschauspielerin und ihrer immensen literarische Kenntnis setzte sie zur Durchsetzung politischer Ziele von Anfang an auf die Wirkung von Büchern und Dramen.
Viele Autorinnen, die Sie in Ihrem Buch vorstellen, veröffentlichten ihre Bücher im S. Fischer Verlag. Welche Rolle spielte der Verlag für die Frauenbewegung?
Tatsächlich habe ich im Laufe meiner Forschungen festgestellt, dass der S. Fischer Verlag in den 1890er Jahren eines der wichtigsten Sprachrohre der modernen Emanzipations- und Frauenbewegung war und einen beträchtlichen Anteil an den Diskussionen über die »Frauenfrage« und der Bewältigung ihrer Probleme hatte. Der Verlag, der 1886 von Samuel Fischer gegründet wurde, verstand sich von Anfang an als Plattform der Moderne, in seiner Zeitschrift »Die neue Rundschau« wurden Debattenbeiträge zu Fragen der Zeit abgedruckt, darunter auch über die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft.
Der Verlag stellte pro Jahr ein bis zwei neue Autorinnen vor. Mit der Veröffentlichung dieser literarischen und sozialkritischen Schriften trug er dazu bei, dass ein öffentlicher Prozess in Gang gesetzt wurde, der die gesellschaftliche Situation der Frauen verändern und in vielen Bereichen verbessern sollte.
Ihr Buch endet mit dem ersten Bayerischen Frauentag in München 1899. Welche Bedeutung hat dieses Ereignis?
Der Bayerische Frauentag von 1899 war die erste frauenpolitische Zusammenkunft Bayerns. Hier wurden Forderungen erhoben, die noch heute aktuell sind. Mit der Bezeichnung »Allgemeiner Bayerischer Frauentag« beanspruchten die Veranstalterinnen für ihren Arbeitskongress einen geradezu parlamentarischen Charakter. Tatsächlich stellten sie sich selbstbewusst in eine Reihe mit Parlamenten wie dem Landtag oder dem Reichstag. Angesichts der Tatsache, dass Frauen bis dahin von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen waren, ja, dass Frauen in Bayern noch bis zum Jahr 1907 der Beitritt zu politischen Vereinen verboten war, war dies ein sehr mutiger Akt, der noch heute imponiert.
Der Kongress endete mit einem fulminanten Festabend, wo wiederum Literatur, Theater und Dichtung als politisches Instrument eine wichtige Rolle spielten. In Marie Haushofers Festspiel hieß es:
»Es lebe die Freiheit, es lebt, wer gewann,
Im Kampfe den Sieg, im Siege den Mann!
Und ist er besiegt, so ist er uns Knecht,
Wir schaffen uns selber unser Recht.«
Gibt es eine Kämpferin in Ihrem Buch, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Bei der Beschäftigung mit der Münchner Frauenbewegung konnte ich einen ungeheuren Reichtum an originellen und höchst verschiedenen Persönlichkeiten kennenlernen. Trotz dieser Individualität habe ich die Bewegung immer als Gesamtheit begriffen, so dass es mir unangemessen schiene, eine einzelne Persönlichkeit hervorzuheben.
Wenn man sich mit dem Leben und Wirken dieser Frauen beschäftigt, kommt man nicht umhin, sich vor Augen zu führen, dass spätestens 1933 mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten die Erinnerung an eine liberale, progressive, moderne Frauenkultur ausgelöscht wurde, Bücher, Nachlässe und Netzwerke wurden vernichtet, die Frauen verfolgt und teilweise im Konzentrationslager umgebracht. Dieses Zerstörungswerk der Nationalsozialisten wirkt bis heute nach. Es ist mir ein Anliegen, diese herausragenden Frauen und ihre Errungenschaften wieder in unser Bewusstsein zurückzuholen. Noch heute stellen diese Frauen Vorbilder dar. Von ihrem Mut zur Selbstbestimmung, ihrer Toleranz und ihrem Zusammenschluss in fruchtbaren Netzwerken lässt sich noch heute lernen.
Das Interview führte Roland Spahr
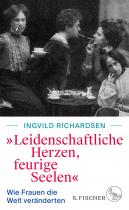
Wie Frauen die Welt veränderten
Die Entdeckung des Selbst: Ein ungeschriebenes Kapitel der Frauenbewegung.
In den 1890er Jahren entsteht in München eine Frauenbewegung, die das Fenster zur Moderne aufstößt. Neue Rollen von Frau und Mann werden ausgetestet, neue Formen der Sexualität gelebt. Im Zentrum stehen Künstlerinnen, die sich von Naturalismus und Jugendstil inspirieren lassen und wirkungsvoll an die Öffentlichkeit treten. Sie vernetzen sich deutschlandweit – auch mit progressiven Männern – und kämpfen für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. »Es lebe die Freiheit … wir schaffen uns selber unser Recht.«
Ingvild Richardsen stellt die Protagonistinnen dieses euphorischen Aufbruchs vor und erzählt ein zentrales Kapitel deutscher Emanzipationsgeschichte.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /