Nachdem ich über Hexen geforscht hatte, war ich an Psychologie und Fantasie interessiert. Ich wollte Luthers innere Welt verstehen, die so anders zu sein schien als die der Hexenjäger. Luther würde sagen, der beste Weg, den Teufel loszuwerden, ist ihn anzufurzen – und sein wundervoll derber Humor schien meilenweit von den düsteren Obsessionen der Hexenjäger entfernt. Immer wurde davon gesprochen, wie wichtig der Teufel für Luthers Weltbild sei – doch wenn das stimmte, wie konnte er sich dann auf diese Weise über den Teufel lustig machen, fragte ich mich.
Je mehr ich über Luthers innere Welt und seine Beziehung zu seinen Anhängern las, desto überzeugter war ich, dass sie ein Angelpunkt war, um die Reformation selbst zu verstehen.
Sie haben alles gelesen, was Luther der Nachwelt an schriftlichen Zeugnissen hinterlassen hat – Tischreden, Briefe, natürlich seine theologischen Werke. Sind Sie anders an diese Quellen herangegangen als frühere Biographen? Wenn ja, worin unterscheiden sich dann Ihre Haltung, Ihre Fragen, Ihre Zugänge?
Ich habe versucht, zu lesen so viel ich konnte, einschließlich der Dinge, die keine offensichtliche theologische Bedeutung haben wie Luthers parodistische Reliquien-Liste, die er für seinen Erzfeind Albrecht von Mainz zusammenstellte. Oder ein Flugblatt gegen einen seiner Gegner, das plakatiert werden konnte wie ein Steckbrief und eiskalt erklärte, der Mann verdiene es, hingerichtet zu werden. Am lehrreichsten waren jedoch Luthers Briefe, die ich der Reihe nach las. Ich wollte ein Gefühl für seine Beziehungen entwickeln, um all die Ideen und Ereignisse in einem persönlicheren Zusammenhang zu sehen. Mich interessierte, welche Wörter er wiederholt benutzte – Wörter wie Neid zum Beispiel – und was er NICHT sagte. Die Briefe sind auch grundlegend für das Verständnis von Luthers Haltung zur Körperlichkeit und seinem eigenen Leib – er hat viel zu berichten über seine Kopfschmerzen, seine Darmträgheit und die offene Vene am Bein. Dazu geben uns seine Briefe Auskunft über seine Sexualität. Dass er mit beiden Beinen voll im Leben stand, diese Erdung, die aus seinen Briefen hervorgeht, ermöglicht es, frappierende Verbindungen zu seiner Theologie zu ziehen, besonders zu seinem Beharren darauf, dass Christus wirklich körperlich in der Eucharistie gegenwärtig ist.
Martin Luther ist ein Symbol, eine Ikone, aber er war auch ein Mensch. Haben Sie etwas Neues, vielleicht Überraschendes über Luthers Charakter, über seine Träume, Ängste und Leidenschaften herausgefunden?
Ich fand seine Träume sehr faszinierend. Zum Beispiel träumte er kurz bevor sein Vater starb, ein großer Zahn falle ihm aus. Der Zahn sei so groß gewesen, dass er sich nicht genug darüber habe wundern können. Ein Zahn ist wie ein Knochen ein Teil von einem, und doch kann er verloren werden.
Als die Lutheraner ihr Glaubensbekenntnis während des Reichstags in Augsburg 1530 Kaiser Karl V. vorstellten, saß Luther in Coburg fest, während die anderen alle in Augsburg waren. Ein wiederkehrendes Thema in den Briefen, die sie sich schrieben, waren ihre Träume: Luther erfasste sehr schnell den emotionalen Subtext dieser Träume, und er wusste, wie er andere damit ärgern konnte.
Ich fand seine Beziehung zu seiner Frau Katharina von Bora schwer zu fassen. Seine Briefe an sie sind herzlich und liebevoll; Luther neckt sie gerne, redet sie scherzend als seine Dame an und erfindet Titel für sie (sie kam aus einer höheren gesellschaftlichen Schicht). Er lässt häufig ihre Stimme sprechen, wenn es darum geht, etwas zu umgehen, das er nicht gerne tut: Als er zum Beispiel nicht zur Hochzeit eines Freundes gehen konnte, sagte er, sie würde es nicht erlauben. Ihre sexuelle Beziehung war offensichtlich wichtig, und gegen Ende seines Lebens schrieb Luther ihr einen Brief, in dem er sich für seine Impotenz entschuldigte. Es ist schwierig, sich ein deutliches Bild von Katharina zu machen: Sie besaß ein eigenes Landgut und managte das Haus und verschiedene Bauernhöfe, die das große Anwesen in Wittenberg mit allem Lebenswichtigen versorgten. Doch ob ihre Beziehung gleichberechtigt war, weiß man nicht.
Wichtig ist in Ihrem Buch auch die Welt, in der Luther lebte. Welche Bedeutung hatten Freunde und Familie, aber auch die Obrigkeiten und seine Widersacher für Luther, für sein Denken und Handeln?
Luther wuchs in einer Bergbaustadt auf, das prägte sein Leben. Es war eine raue Lebenswelt, in der Auseinandersetzungen mit Fäusten ausgetragen wurden und ein Mann seine Ehre verteidigen musste. Es war auch eine sehr unsichere Welt. Luthers Vater, der Hüttenunternehmer Hans Luder, war sehr viel reicher, als wir einst dachten. Doch er brauchte Glück, um Erzadern zu finden, und letzten Endes ging Luders Unternehmen bankrott. Luthers Mitgift aus dieser Welt waren Selbstbewusstsein und Angriffslust; er hatte gelernt, wie man sich für seine Sache einsetzt.
Ich glaube, Luthers Angriffslust lässt sich auch daran erkennen, wie er seine Theologie entwickelte. Bestimmt hatte er sie noch nicht ausgearbeitet, als er die 95 Thesen verfasste. Man kann beobachten, wie seine Ideen Gestalt annahmen, während er sich in Augsburg gegen den päpstlichen Legaten Cajetan verteidigte, dessen »väterliche« Art ihn zum Wahnsinn trieb. Luther gehörte zu den Leuten, die ihre Ideen formten, während sie mit anderen stritten, und er liebte die ritualisierte Form des akademischen Gefechts, die Disputation.
Wenn Sie durch die Zeit reisen könnten, in welcher Lebensphase würden Sie Luther dann am liebsten begegnen? Was würden Sie ihn fragen wollen? Glauben Sie, Sie würden ihn eher mögen oder eher als schwierigen Menschen empfinden?
Ich glaube, ich würde Luther gerne 1525 treffen. Da war er bereits 41 Jahre alt, frisch verheiratet und entdeckte den Sex. Zu dieser Zeit sind seine Briefe von einer neuen Leichtigkeit und voller Humor. Er scherzt darüber, dass ihn sein Mädchen in ihre Zöpfe einflechte, eine hübsche Bemerkung über die Bindung an eine andere Person, wie sie durch die Ehe entstand, und in der nichts von einem männlichen sexuellen Auftrumpfen liegt. Trotzdem war ihm vor der Heirat bange: Er sorgte sich, es könnte eine Josefsehe werden, und Sie können sich vorstellen, wie erleichtert er war, als sie miteinander geschlafen hatten. Er scherzte, dass ein männlicher Freund bezeugen könne, wie sehr er sich als Mann erwiesen habe. Das war eine Zeit, in der Luther wirklich in Festtagsstimmung war, es gibt [aber] nur wenige Briefe aus diesem Zeitraum.
Wenn ich ihn etwas fragen könnte, dann würde ich gerne von ihm wissen, warum er so beharrlich an der Vorstellung festhielt, dass Christus bei der Kommunion wirklich in Brot und Wein gegenwärtig sei, eine Vorstellung, die viele seiner Zeitgenossen fallen ließen und die letztlich zur Spaltung zwischen Lutheranern und Anhängern Zwinglis und später Calvins führte. Doch ich weiß, ich würde keine Antwort erhalten. Eine solche Frage hätte ihn einfach nur wütend gemacht, denn für ihn war das eine Evidenz, eine Wahrheit, etwas, das wir einfach glauben müssen, auch wenn es in rationalen Begriffen keinen Sinn ergibt.
Ich glaube, ich würde Luther lieben und zugleich hassen. Seine Herzlichkeit und sein Charisma, seine Großzügigkeit gegenüber Freunden und sein anarchischer Zug – Luther war kein Mann, der sich Vorschriften machen ließ – würden mich anziehen. Doch seine unnachgiebige Bitterkeit gegenüber allen, mit denen er gebrochen hatte, würde mich abschrecken – und er hat eine lange Reihe von zerbrochenen Freundschaften aufzuweisen, darunter Freundschaften mit Männern, die einst zu seinen engsten Vertrauten zählten. Sein Antisemitismus, der tiefer, eingefleischter und extremer ist, als ich erwartet hatte, wäre mir unerträglich. Er unterscheidet sich auch von seiner Haltung gegenüber dem Islam, die weit aufgeschlossener war; tatsächlich hat er sich dafür eingesetzt, dass der Koran in einer Übersetzung veröffentlicht wurde. Wenn Luther hingegen über Juden schreibt, tut er das mit einem solchen körperlichen Abscheu, dass ich es einfach nicht ertragen oder vergeben kann.
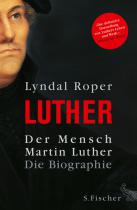
Die renommierte Oxford-Historikerin Lyndal Roper, eine der wichtigsten Expertinnen für die deutsche Geschichte des 16. Jahrhunderts, präsentiert in ›Der Mensch Martin Luther‹ ein neues Bild des berühmten Theologen, eine tiefgehende und einfühlsame Biographie, die uns Luther so nahe bringt wie nie zuvor. Sie zeigt, wer Luther wirklich war und warum gerade er zum großen Reformator wurde, der die Welt aus den Angeln hob.
Lyndal Roper hat sich aufgemacht, Luthers ganze Persönlichkeit zu verstehen, seine innere Welt und die Beziehungen zu seinen Freunden nachzuvollziehen. Dafür hat sie seine Schriften und vor allem seine Briefe noch einmal neu gelesen und in den Archiven vor Ort (u.a. Wittenberg, Mansfeld, Leipzig, Eisenach) über zehn Jahre hinweg zahlreiche Dokumente über Luther und sein Umfeld zusammengetragen und ausgewertet.
Sie schildert den Reformator als Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand, als Menschen aus Fleisch und Blut. Für Luther waren der Körper und die Sexualität Teil des Mensch-Seins, er wollte den Körper vom Makel der Sünde befreien. Sein Glaube an die Einheit von Körper und Geist führt zum Kern seiner Theologie, der zu einem der großen Streitpunkte des Christentums werden sollte: Luthers unumstößliche Überzeugung, dass Christus bei der Eucharistie leibhaftig anwesend ist. Erst durch die lebendige Darstellung von Luthers innerer Entwicklung wie auch der Entwicklung seiner Beziehungen wird deutlich, warum und wie es zur Reformation kommen konnte. Eine großartige Lektüre, ein Lesevergnügen für alle, die Luther und die Reformation neu entdecken oder erstmals kennen lernen wollen – eine neue Luther-Biographie für unsere Zeit. Opulent ausgestattet mit mehr als 100 Abbildungen in Schwarzweiß und farbig.
»Ein brillanter Blick auf Luther als Mensch.« Professor Dr. Karl-Heinz Göttert
»Lyndal Roper bürstet Luther gegen den Strich und legt neue, bislang unerkannte Facetten des großen Reformators frei.« Professor Dr. Thomas Kaufmann






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /