Mich interessiert diese Zeit vor allem aus zwei Gründen, einem persönlichen und einem allgemeinen. Zum einen bin ich in dieser Zeit aufgewachsen, und Vieles von dem, was mir damals passiert ist, gehört zum Wichtigsten, was ich bis jetzt erlebt habe. Zum anderen hat sich Spanien damals sehr verändert, wir haben eine blutige Diktatur gegen eine mittelmäßige Demokratie eingetauscht, die sich aber verbessern lässt (wie alle Demokratien - eine perfekte Demokratie ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur). Kurz: Damals entstand das heutige Spanien. Für mich, und das spiegelt sich auch in meinen Büchern wider, vor allem in den letzten, lassen sich das Persönliche und das Allgemeine nicht trennen. Das Allgemeine ist eine Dimension des Persönlichen, und das Persönliche eine Dimension des Allgemeinen. Deshalb finde ich diese Zeit also interessant: Sie ist der Ausgangspunkt für meine Gegenwart und für die Gegenwart Spaniens, ohne sie bin ich nicht in der Lage, irgendetwas davon zu begreifen.
Die Hauptfiguren von ›Outlaws‹ sind Quinquis beziehungsweise Charnegos – können Sie diese beiden Begriffe ein wenig erläutern? Und was machen bzw. wo sind die Quinquis und Charnegos heute? Was ist aus ihrer Welt geworden?
Charnego und Quinqui sind Begriffe der Umgangssprache. Ein Charnego ist jemand, der aus einem anderen Teil Spaniens nach Katalonien zugewandert ist, und ein Quinqui ist ein jugendlicher Krimineller und zugleich fast immer auch ein Charnego. Im Spanien des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie wurden die Quinquis zu einem Mythos – zu dem sich ein eigenes subkulturelles Genre bildete: Filme, Schallplatten, Bücher, Zeitungsreportagen usw. –, im Grunde sind sie aber nichts anderes als eine Variante oder ein Avatar eines universellen Mythos, der an verschiedenen Orten in unterschiedlicher Gestalt auftritt: Der Mythos des Räubers als junger Mann, des Geächteten, Billy the Kid. Davon abgesehen gibt es heute keine Charnegos mehr, und auch keine Quinquis, beide sind in der katalanischen Gesellschaft aufgegangen. Mein Roman beginnt zum Zeitpunkt der Geburt der Quinquis (Ende der siebziger Jahre) und endet mehr oder weniger heute, wo es keine Quinquis mehr gib. Iin gewisser Weise ist er ihre kollektive Biographie – und auch eine Elegie auf die Quinquis.
Wie ist es mit der Jugend im Spanien von heute, was ist anders – und was ist unverändert – im Vergleich zu den Jugendlichen in ›Outlaws‹?
Die Jugendlichen in Spanien befinden sich heute in einer sehr schwierigen Lage, aber in den siebziger Jahren war die Lage noch viel schwieriger. In den siebziger Jahren war Spanien schlichtweg ein Dritte-Welt-Land, während es jetzt zur ersten Welt gehört. Außerdem ist das, wovon die fortschrittlich denkenden Spanier seit mehr als zweihundert Jahren träumten, inzwischen Wirklichkeit geworden: Heute sind wir nicht nur ein Teil Europas, sondern eines vereinten Europa, das seinerseits die einzige vernünftige politische Utopie darstellt, die wir Europäer uns ausgedacht haben. Die Jugendlichen von heute gehen auf die Straße und protestieren, völlig zu recht. Die Jugendlichen in den siebziger Jahren hatten noch viel mehr Gründe, um zu protestieren, aber ihnen fehlten die Worte und die Begründungen, weshalb sie, so wie die Jugendlichen in meinem Roman, in Form von Gewalt protestierten – sie stahlen Autos und überfielen Banken. Für die Jugendlichen von heute ist das kein Trost, aber so war es damals.
Eine wichtige Rolle im Leben der Romanfigur Zarco (wie auch im Leben von dessen historischem Vorbild Juan José Moreno Cuenca, genannt El Vaquilla (1961 – 2003)), spielt der Mythos, der sich um dieses Leben rankt – was genau ist ein Mythos und wie sollte man mit Mythen umgehen?
Ein Mythos ist eine Mischung aus Lügen und Wahrheiten, und – wie jeder Journalist oder Schriftsteller weiß – eine Mischung aus Wahrheit und Lüge ist eine Lüge. Eine solche Lüge sagt allerdings häufig viel mehr über die Gesellschaft aus, die diese Lüge hervorbringt, als so manche Wahrheiten – über die Hoffnungen dieser Gesellschaft, ihre Enttäuschungen, ihre Ängste. In meinen letzten Büchern habe ich, auch wenn es vielleicht gar nicht von vornherein so beabsichtigt war, große Mythen untersucht – den spanischen Bürgerkrieg, den Vietnam-Krieg, den Putsch vom 23. Februar 1981, der für uns Spanier in seiner Bedeutung dem Attentat auf Kennedy gleichkommt. Ich wollte sie entmythologisieren, herausfinden, was sie bedeuten und wie sie funktionieren, was sich in ihrem Inneren befindet. Und in ›Outlaws‹ habe ich mir den Quinqui-Mythos vorgenommen, unseren Billy-the-Kid-Mythos, und dabei bin ich nicht auf die legendären Geächteten und Gesetzesbrecher gestoßen, die die Filme und Lieder aus jener Zeit uns vorspiegeln, sondern auf arme Jungs aus den Vorstädten, aus Elendsvierteln, die, wie Bob Dylan sagen würde, nichts hatten und folglich auch nichts zu verlieren hatten und deshalb zur Gewalt griffen. Und dabei ausgelöscht wurden.
Das literarische Erfolgsmodell seit mindestens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist zweifellos das realistische Erzählen angelsächsischer Prägung. Ähnlich stilbildend war jedoch, einige Zeit davor, auch einmal der französische Realismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Kann man es als Besonderheit der Romane von Javier Cercas bezeichnen, dass sich in ihrem Fall beide Einflüsse mehr oder weniger die Waage halten?
Kann sein, allerdings habe ich nicht das Gefühl, der Erbe der einen oder anderen dieser beiden Arten von Realismus zu sein. Ich fürchte, ich bin vielmehr, was heutzutage niemand mehr sein möchte, nämlich das, was man bis vor kurzem einen postmodernen Schriftsteller genannt hat, wobei ich unter postmodern Folgendes verstehe: Eine Ästhetik, deren Ursprung zum Einen – in weiter Ferne – im zweiten Teil des Don Quijote gründet, zum Anderen – in der umittelbaren Vergangenheit – im Werk von Jorge Luis Borges. Diese Ästhetik verbindet die totale Freiheit aus den Anfängen des Romans – also die Freiheit eines Cervantes, Sterne, Diderot, das heißt, die des Romans vor dem Triumph des Realismus, für die der Roman eine große Wundertüte ist, in der alles Platz hat, ein Genre, das alle Genres umfasst beziehungsweise sich alle Genres einverleibt –, diese totale Freiheit also und die formale Strenge des realistischen Romans, der mit Flaubert beginnt. Ungefähr dort verorte ich mich, soll heißen: Ungefähr dort würde ich mich gerne verorten.
Wie ist Ihre Beziehung zu den von Ihnen selbst geschaffenen Figuren – die im Leser, nebenbei gesagt, nach der Lektüre noch lange weiterleben – ?
Meine Figuren sind so wie die Figuren eines jeden Schriftstellers stets »hypothetische Ichs« – wie Milan Kundera es einmal bezeichnet hat –: nicht verwirklichte Möglichkeiten meiner selbst. Sie alle leben Leben, die ich hätte leben können, aber nicht gelebt habe oder nicht zu leben gewagt habe. In diesem Sinne sind sie alle ich. Zugleich – und das ist das große Wunder der Literatur – sind sie aber alle auch sie selbst, alle folgen sie irgendwann ihrer eigenen Logik und führen ihr eigenes Leben (oder sollten das zumindest). Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihnen das gelingt. Wie ich das mache? Indem ich sie mir gründlich vorstelle, ihnen aufmerksam zuhöre, intensiv mit ihnen zusammenlebe, aber auch, indem ich sie liebe und hasse. Die meisten von ihnen kenne ich besser als meinen Vater.
›Outlaws‹ erzählt auch – oder vor allem – eine Dreiecks-Liebesgeschichte: Wird der dritte im Bunde, der Anwalt Ignacio Cañas, je erfahren, wer hier - falls überhaupt - wen wann geliebt hat?
Damit ist natürlich die Beziehung zwischen Tere und Ignacio gemeint, die vielleicht das zentrale Element des Romans darstellt. Außerdem ist diese Beziehung unmittelbar mit der zentralen Frage des Romans verbunden: Wer hat Zarcos Bande verraten? Also gut, in diesem Roman – wie in all meinen Romanen und wie in allen Romanen, die für mich wichtig sind – gibt es etwas Unbestimmtes, Offenes, das von entscheidender Bedeutung ist. Ich nenne es auch den blinden Fleck. Irgendwann möchte ich einmal einen Essay darüber schreiben. Gemeint ist damit jedenfalls, dass es im Zentrum jedes Romans einen blinden Fleck gibt, soll heißen: eine Stelle, die, theoretisch, undurchschaubar bleibt. Genau durch diesen undurchschaubaren, blinden Fleck blickt jedoch in der Praxis der Roman. Genau durch diese Dunkelheit wirkt der Roman erhellend. Genau durch dieses Schweigen wird der Roman beredt. Dieses Paradox ist eine Grundvoraussetzung meiner Romane (beziehungsweise einer ganzen Richtung des modernen Romans, die selbstverständlich mit dem Don Quijote beginnt). Wir werden nie erfahren, ob das, was Mario Rota, der Hauptfigur meines Romans ›Der Mieter‹, widerfährt, Traum oder Wirklichkeit ist. Und wir werden nie erfahren, wer der Soldat in ›Soldaten von Salamis‹ war, der Rafael Sánchez Mazas das Leben gerettet hat, oder warum er das getan hat. Ebenso wenig werden wir in ›Anatomie eines Augenblicks‹ erfahren, warum Adolfo Suárez, der Architekt des Übergangs Spaniens von der Diktatur zur Demokratie, im Parlament auf seinem Präsidentensessel sitzen blieb, während ihn die Kugeln der Putschisten umschwirrten. Wie wir auch in ›Outlaws‹ nie erfahren werden, wer Zarcos Bande verraten hat. Aber gerade dieses Nichtwissen stellt das Zentrum dieser Romane dar, es enthält alles, was diese Romane zu sagen haben, in ihm liegt ihre Weisheit und in seiner Dunkelheit ihr Licht. (So wie in den Romanen Franz Kafkas, um auf ein offensichtliches Beispiel zu verweisen: Nie werden wir erfahren, wessen man K. in ›Der Prozess‹ beschuldigt, so wie wir auch nie wissen werden, warum K. in ›Das Schloss‹ eben dieses Schloss nicht betreten darf, aber gerade in diesem Nichtwissen steckt alles Wissen dieser beiden erstaunlichen Romane.) Und die blinde Klarsicht oder Unbestimmtheit oder Zweideutigkeit dieses blinden Flecks strahlt auf den Rest des Romans aus – oder sollte wenigstens darauf ausstrahlen. In jedem Fall handelt es sich um eine Zweideutigkeit, die nur der Leser aufklären kann, der seinerseits die andere Hälfte des Buches verkörpert (abgesehen davon dass, wie Paul Valéry gesagt hat, erst der Leser manche Bücher zu Meisterwerken macht). Anders gesagt: Für Romane gilt: Je zweideutiger, desto besser. Und diese Zweideutigkeit erhält der Roman durch seinen blinden Fleck. Kurz: Nur der Leser kann entscheiden, ob Tere wirklich und von Anfang an in Ignacio Cañas verliebt war, oder ob sie nie in ihn verliebt war und ihn von Anfang an bloß ausgenutzt hat – von dieser Entscheidung hängt die Bedeutung des Romans allerdings im Wesentlichen ab.
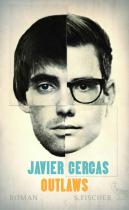
Sie kiffen, klauen, hängen ab. Der Anführer Zarco, der allen Angst einjagt, die verführerische Tere mit den grausam grünen Augen, und all die anderen, die kein Zuhause haben. Als Ignacio dazustößt, werden aus Kleinkriminellen bewaffnete Gangster. Banküberfälle, Nutten und harte Drogen sind jetzt ihr Alltag. Dann gibt es den ersten Toten, und Ignacio weiß: wenn er leben will, muss er aussteigen, auch wenn er die schöne Tere nie wiedersehen wird. Jahre später treffen sie sich vor Gericht wieder: Zarco als Angeklagter und Ignacio als Strafverteidiger. Aufwühlend und sehr einfühlsam erzählt Javier Cercas von den zerrissenen Freundschaften einer verlorenen Jugend in Spanien.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /