Aus seiner eigenen Sicht ist wahrscheinlich jedes Tier zufrieden mit sich selbst. Eine Schnecke ist liebend gern eine Schnecke. Sie sieht in einer Giraffe wohl nicht viel mehr als die Unbeholfenheit, die Hässlichkeit in einer Spinne und die übertriebene Geschwindigkeit und Verschlagenheit in Klauentieren. Wenn man mich also fragt, welches Tier ich gern wäre, denke ich daran, welche Projektion mir am besten gefällt. So gesehen wäre ich am liebsten ein Faultier. Das Faultier hat eine sehr eigene Art im Kampf ums Überleben: Statt Geschwindigkeit wählt es Langsamkeit, statt Wildheit Tarnung, statt Verfressenheit übt es Zurückhaltung. Ich sehe in diesem Tier, das wenig frisst, sich wenig bewegt und viel schläft, einen buddhistischen Mönch der Natur. Während es von seinem südamerikanischen Ast baumelt, wird es langsam von Flechten überzogen, bis es sich immer mehr dem Baum selbst angleicht. So stelle ich mir wahres Meditieren vor, und hätte man ausreichend gute Ohren, würde man inmitten eines tropischen Regengusses den Gesang hören: Om, om, om …
Woher kommt dein großer Respekt für Tiere?
Einfach aus gesundem Menschenverstand. Wir teilen nicht nur diesen Planeten mit Tieren, wir teilen auch einen gemeinsamen Vorfahren. Wir alle stammen von einer einzelnen spektakulären Amöbe ab. Von ihr ausgehend ist die Familie gewachsen. Manche von uns sind weitergekommen als andere – ein paar zweifelhaften Maßstäben zufolge, vor allem wenn man bedenkt, dass die Zivilisation dabei ist, den Planeten zu zerstören –, aber es ist eben die gleiche Großfamilie. Und Familie ist Familie. Außerdem sind Tiere interessant: die Art, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten. Sie zu betrachten, über sie nachzudenken ist wie eine Entlastung vom Menschsein. Auf eine seltsame Art verbinden Tiere uns wieder mit unserer Menschlichkeit.
Haben Tiere den Menschen etwas voraus?
Ja, langfristig betrachtet sind sie klüger. Mit unserer vielgepriesenen Intelligenz sind wir verantwortlich für Klimawandel, Umweltverschmutzung, Versteppung, Abholzung, das Aussterben von Tierarten usw. Tiere dagegen leben im Gleichgewicht. Ein Raubtier, das seine Beute bis zu deren Ausrottung jagt, zahlt irgendwann den Preis: den Hungertod. Eine übergroße Menge an Beutetieren lockt den Jäger an, der sie dezimiert. Das Ergebnis sind Gleichgewicht und Fortbestand. Wenn wir Menschen nicht auf diesem Planet lebten, würde es ewig so gehen (abgesehen von Katastrophen der Art, die die Dinosaurier zum Aussterben brachte).
Woher glaubst du rührt die menschliche Faszination für Tiere?
Von der Tatsache, dass sie sind, dass sie existieren, aber dass sie nicht wie wir sind. Das ist doch merkwürdig. Warum gibt es so viele Formen, auf diesem Planeten zu sein? Wäre Homogenität, Gleichheit, nicht eine bessere Form? Sollte die Welt nicht sein wie die Europäische Union, sich allmählich angleichend, mit den gleichen Geschäften, den gleichen Standards, den gleichen Ideen, wo die unterschiedlichen Sprachen nicht mehr sind als Streifen auf einer nahverwandten Spezies? Warum so viele Unterschiede? Ich glaube, in die Augen eines Tiers zu blicken ist wie ein existentieller Blick in den Spiegel.
Hattest du jemals eine prägende Erfahrung mit einem Tier?
Nicht wirklich. Als Kind hatte ich die gleichen Haustiere wie viele westliche Mittelschichtkinder sie haben. Domestizierte Tiere sind vor allem Leinwände, auf die wir unsere Wünsche projizieren: Gesellschaft, eine gemeinsame Sprache, Zuneigung zu denselben Dingen. Echte Tiere, wildlebende Tiere habe ich durch Bücher kennengelernt, durch die mir klarwurde, dass da draußen, in den Urwäldern und Meeren, Wesen leben, die so gar nicht wie wir sind und doch auch ein wenig wie wir. Bücher kluger Naturforscher haben mir dafür die Augen geöffnet.
Die Interviews zu ›Schiffbruch mit Tiger‹ wollten viele Journalisten in Zoos führen. Was hältst du von Zoos?
Gute Zoos (mit Betonung auf »gut«) sind wie diplomatische Vertretungen der Wildnis. Jede Spezies ist ein Botschafter, und die Hoffnung ist, dass gute Zoos wie echte Botschaften mithelfen, respektvolle Beziehungen zur Wildnis zu bewahren. Gäbe es keine Zoos, hätten die meisten von uns kaum die Gelegenheit, Wildtiere zu sehen. Und wenn man ein wildes Tier nie leibhaftig gesehen hätte – warum sollte es einen dann interessieren? Wir interessieren uns meistens nur für das, was wir kennen.
Ist es denkbar für dich, einen Roman zu schreiben, in dem Tiere keine wesentliche Rolle spielen?
Im Moment nehme ich gerne Tiere. In meinem nächsten Roman, der während des Trojanischen Kriegs beginnt, wird es auch Tiere geben. Tiere in Romanen sind vielseitige Charaktere. Sie können einfach die sein, die sie sind – ein Tiger oder ein Schimpanse –, aber sie können auch dieses großartige Andere sein: ein Symbol. Ein Symbol ist etwas Mächtiges. Es öffnet der Vorstellungskraft alle möglichen Türen. Wir projizieren viel in Tiere hinein, auch in wilde Tiere. Wir glauben, sie seien schön und frei, um nur zwei Merkmale zu nennen, und wir alle streben nach Formen von Schönheit und Freiheit. Meiner Meinung nach wirkt fast jede Geschichte, in der Tiere eine Rolle spielen, auf einer Ebene, die über das Banal-Realistische hinausgeht und sich etwas an annähert, das ich mystisch nennen würde.
Was ist das Tierische in dir?
Da muss ich nachdenken. Ich empfinde mich vor allem als Mensch. Hunger ist natürlich etwas Tierisches, aber ich sehe selbst das durch die menschliche Linse: Mein Hunger konzentriert sich auf eine leckere, aufbereitete Mahlzeit. Aber wahrscheinlich hält man »Natürlichkeit« für etwas Tierisches. Tiere leben nun mal in der Natur, und dort bewegen sie sich auch auf eine Weise, die wir für natürlich halten. Wenn ich also natürlich bin, bin ich auch tierisch. Aber wann bin ich natürlich? Und was mache ich, wenn ich mich natürlich fühle? Da sieht man es, über Tiere nachzudenken führt mich wieder zum Mysterium.
Die Antworten wurden von Corinna Santa Cruz aus dem Englischen übersetzt.
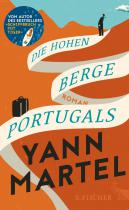
Lissabon, Anfang des 20. Jahrhunderts: In einem sogenannten Automobil begibt sich der junge Tomás auf eine abenteuerliche Expedition in die Hohen Berge Portugals. Damit beginnt ein tragikomischer Roadtrip, der ein unvorhergesehenes Ende nehmen soll. Doch das ist erst der Anfang einer phantastischen Geschichte, die die Hohen Berge Portugals noch Jahrzehnte später umweht wie ein tragischer Zauber.
In seinem neuen großen Roman verknüpft Yann Martel verschiedene Fäden eindrucksvoll zu einem literarischen Wunder: ein unglaubliches und doch absolut glaubhaftes Meisterwerk über das Leben, den Tod und die Liebe – voller Weisheit und Witz.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /