Wie konnte es so weit kommen? Und wie erzählt man von einer Katastrophe, die so schrecklich, so apokalyptisch, unfassbar und unberechenbar ist? Wie von der unsichtbaren Bedrohung? Gleich zwei Autoren versuchen sich in diesem Jahr an der Rekonstruktion dieses monströsen Ereignisses – in zwei unterschiedlichen Medien.
Emotional und intensiv: Chernobyl
Der US-amerikanische Drehbuchautor und Regisseur Craig Mazin hat die fünfteilige Mini-Serie Chernobyl produziert, die im Mai 2019 auf dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO lief (in Deutschland bei Sky Atlantic) und für viel Aufsehen sorgte. Chernobyl ist intensiv und detailtreu, hat ausgezeichnete Darsteller. Das Drehbuch ist auf den Punkt geschrieben und die Wucht der Bilder ist atemberaubend. Eine gelungene Rekonstruktion, die bei interessierten Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat – aber selbigen auch ein wenig ratlos zurücklässt.
Denn eine Serie muss verdichten, reduzieren, sich auf wenige Handlungsstränge beschränken, den Zuschauern Bezugspunkte bzw. Personen geben, die sie durch die Katastrophe begleiten können. Sie kann nicht jeden der Beteiligten beim Namen nennen und ihre persönliche Geschichte erzählen.
Umfassend, detailgetreu und faktenreich: Mitternacht in Tschernobyl
Higginbotham stellt die ganze Bandbreite an Beteiligten vor, all die Wissenschaftler, Ingenieure, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Architektinnen und Lehrerinnen, all die Bewohner von Prypjat, die von der Reaktorkatastrophe unmittelbar betroffen sind. Personen wie die Architektin Maria Protsenko, die ursprünglich aus China stammt, und bei der Evakuierung Pripyats (die aus ideologischen Gründen viel zu spät durchgeführt wurde) eine entscheidende Rolle gespielt hat. Oder die Ärztin Angelina Guskova aus dem Hospital 6 in Moskau, die eine Expertin für Strahlenkrankheiten war und eine der wenigen Frauen, die weit oben in der sowjetischen Hierarchie standen. Über die Gesamtstrecke erzählt Higginbotham die Katastrophe aus der Makroperspektive, geht sie aus allen möglichen Blickwinkeln an, zoomt aber immer wieder in die Mikroperspektive hinein.
Chernobyl und Mitternacht in Tschernobyl im Vergleich
Die Serie Chernobyl beginnt mit einem Selbstmord. Im Prolog tötet sich Waleri Legassow - der als Identifikationsfigur und Held der Serie gilt, im Buch aber durchaus kontroverser geschildert wird – drei Jahre nach den Ereignissen. Gleich darauf aber – Prologende und Zeitsprung – sind wir mitten im Geschehen, im Kernkraftwerk kurz nach der Explosion, wo Chaos und Verwirrung herrschen.
Das Sachbuch Mitternacht in Tschernobyl setzt deutlich früher ein, schildert den Bau des Reaktors und der dazugehörigen Stadt Pripyat, aber auch die Bedingungen, unter denen beides entstand: eine Dekade der Stagnation, Korruption, lähmender Bürokratie, Mangelwirtschaft und Schlampereien im Kraftwerk, vertuschter Reaktorunfälle an anderen Standorten. Higginbotham entwirft ein verheerendes Bild der damaligen Sowjetunion und der Machtstrukturen der kommunistischen Partei, in der Ideologie und Machthunger Bedingungen schufen, die auf Kosten der Sicherheit gingen und schließlich in der Katstrophe mündeten.
Autor Craig Mazin und Regisseur Johan Renck sind zwar um Detailtreue bemüht, doch es geht ihnen mit Chernobyl vielmehr darum, ein Gefühl von der Katastrophe zu vermitteln. Wenn Kraftwerksmitarbeiter ausgerüstet mit Schutzanzügen und Geigerzählern in die verstrahlten Kellergänge hinabsteigen, in das radioaktive Wasser treten, um Ventile zu öffnen, dann befinden wir uns bei Mazin und Renck in einem Horrorfilm. Es wird immer dunkler, bis man nur noch das wilder werdende Knistern der Strahlungsmesser hört. Dann: nur noch Schwärze.
Der Horror in Mitternacht in Tschernobyl besteht aus einer genauen Rekonstruktion der Strahlungsmengen und Arten, denen jeder einzelne Mitarbeiter auf den verschiedenen Abschnitten seines Weges ausgesetzt war, und welche Folgen dies für ihn hatte. Auf der einen Seite Atmosphäre, auf der anderen Seite Fakten. Beide Wege erreichen ihr Ziel, die Atmosphäre, die den Zuschauer hineinversetzt und packt, die Fakten, die in ihrer Nüchternheit nicht ihren Schrecken verlieren, im Gegenteil.
Einer der Spannungspunkte in der Serie Chernobyl bleibt die Frage, wie es überhaupt zur Katastrophe kommen konnte. Drehbuchautor Craig Mazin geht davon aus, dass die meisten Zuschauer*innen nicht vertraut mit den damaligen Ereignissen sind, und löst das Rätsel erst gegen Ende im Gerichtsprozess auf. Higginbotham hingegen legt von Anfang an alle Karten auf den Tisch, indem er nicht nur die Geschichte der Radioaktivität mit all ihren tödlichen Folgen schildert, sondern auch die Historie des sowjetischen Atomprogramms beleuchtet – insbesondere den Bau verschiedener Reaktortypen und der Übernahme eines Konstruktionsfehlers, der zum positiven Dampfblasenkoeffizienten führte.
Der Reaktor explodierte während eines Sicherheitstests, der in Kombination mit dem Konstruktionsfehler für Bedingungen sorgte, die das scheinbar Unmögliche möglich machten: die Explosion des Reaktorkerns, die unterschiedliche Arten von Strahlung freisetzte und für eine beginnende Kernschmelze sorgte.
Minutiös schildert Higginbotham in Mitternacht in Tschernobyl den Ablauf der Katastrophe, wer währenddessen wo gewesen ist, was er gedacht (wenn es Aussagen darüber gibt) und gemacht hat. Ebenso beschreibt er ausführlich die Auswirkungen in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe, als es an die Aufräumarbeiten ging. Den Zehntausenden von Soldaten und Reservisten war dabei überhaupt nicht bewusst gewesen, in welche Gefahr sie sich begaben. Allein ein startender Hubschrauber konnte die Radioaktivität durch aufwirbelnden, kontaminierten Staub um das Tausendfache erhöhen. Staub, der nicht nur in Kleidung und Haaren hängenblieb, sondern auch in den Lungen.
Was in der Serie Chernobyl ebenfalls nicht erwähnt wird, ist das Ausmaß der Falschmeldungen, der Gerüchte und die daraus resultierende Panik, die z. B. in Kiew ausgelöst wurde (alle Kinder wurden aus der Stadt gebracht). Die Figur der Physikerin Ulana Khomyuk ist rein fiktiv. In ihr wurden die Leistungen unzähliger Wissenschaftler und Behördenmitarbeiter zusammengefasst. Letztere führten die Befragungen der verstrahlten Kraftwerksmitarbeiter durch, die trotz Knochenmarkstransplantationen nicht gerettet werden konnten und starben.
Erschreckend sind nicht nur die in der Serie geschilderten Vertuschungen und Verleugnungen der Behörden, sondern auch die in Mitternacht in Tschernobyl beschriebenen Versäumnisse gegenüber den Aufräumarbeitern, Tunnelbauern, Piloten, die keine klaren Instruktionen über ein vorsichtiges Verhalten in der Gefahrenzone erhielten.
Die Serie Chernobyl endet mit dem Schauprozess, der zwar relativ detailgetreu nachgestellt wurde, in der die Rollen von Waleri Legassow und Boris Schtscherbina jedoch deutlich ins Heldenhafte überhöht wurden. Sie sind Stellvertreter für all jene, die sich damals nicht mit den Lügen und Sündenböcken zufriedengeben wollten.
Mitternacht in Tschernobyl geht darüber hinaus und erzählt, wie die Sowjetunion endete, in die Knie gezwungen von der eigenen Hybris, zu der die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl sicher ihren Teil beigetragen hat. Wir erfahren, was die fünf verurteilten Mitarbeitern nach ihrer Entlassung taten einige arbeiteten wieder in der Nuklearindustrie. Und wir erfahren, was aus dem Unglücksort wurde: vom Bau des Sarkophags, der Suche nach dem verschwundenen Kernbrennstoff und der Entdeckung des Elefantenfußes.
Higginbothams Stärke ist die Mischung aus Reportagestil und minutiöser Rekonstruktion der Ereignisse, basierend auf ausführlicher und gründlicher Recherche. Den Reportagestil setzt er behutsam ein, um den Leser*innen ein Gefühl für die Situation zu geben. Die wissenschaftlichen Erklärungen zur Geschichte und Wirkung der Radioaktivität oder der Funktionsweise von Kernreaktoren, die in der Serie Chernobyl zu kurz kommen, lesen sich trotz aller Sachlichkeit verständnisvoll, flüssig und unterhaltsam.
Mitternacht in Tschernobyl ist nicht das erste Buch über den Reaktorunfall. Aber mit seiner aufwendigen Recherche, der umfangreichen Rekonstruktion der Ereignisse und seiner sprachlichen Klarheit, die auch in der Übersetzung von Irmengard Gabler ihre ausgezeichnete Wirkung entfaltet, bietet es eine perfekte Ergänzung zur packenden Serie Chernobyl.
Die Serie Chernobyl ist bei Sky Ticket und Sky Go als Stream verfügbar, Mitternacht in Tschernobyl erscheint am 27. November auf Deutsch beim Fischer Verlag.
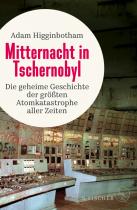
In seinem Tschernobyl-Thriller deckt Adam Higginbotham auf, was wirklich geschah. Mit großer Erzählkunst und basierend auf intensiver Recherche zeichnet er nach, wie am frühen Morgen des 26. April 1986 der Reaktor 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl explodierte und die schlimmste Atomkatastrophe der Geschichte auslöste. Seither gehört Tschernobyl zu den kollektiven Albträumen der Welt: eine gefährliche Technologie, die aus den Rudern läuft, die ökologische Zerbrechlichkeit und ein ebenso verlogener wie unachtsamer Staat, der nicht nur seine eigenen Bürger, sondern die gesamte Menschheit gefährdet. Wie und warum es zu der Katastrophe kam, war lange unklar. Adam Higginbotham hat zahllose Interviews mit Augenzeugen geführt, Archive durchforstet, bislang nicht veröffentlichte Briefe und Dokumente gesichtet. So bringt er Licht in die Geschichte, die bislang im Sumpf von Propaganda, Geheimhaltung und Fehlinformationen verborgen lag. Erschütternd, packend: »Wie ein Thriller.« Luke Harding.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /