Alessandro Pipernos Understatement hat etwas Beneidenswertes. Er sieht unbeschwert aus. Gewappnet. Gleichgültig gegenüber dem literarischen Geraune um ihn herum. Bereitwillig passt er sich den Umständen an und zeigt keine Nervosität. Das Bild des entspannten Schriftstellers wird auch nicht durch die Tatsache getrübt, dass sich sein Roman ›Inseparabili‹ (dt. ›Hier sind die Unzertrennlichen‹) vielleicht nicht so häufig verkauft hat, wie vom Verleger erwartet. Auch die Teilnahme am Premio Strega, einem Preis voller Fallen und Rückschläge, löst bei ihm keine besondere Unruhe aus. Piperno ist Pfeifenraucher. Das sprichwörtliche Werkzeug von Menschen, an deren Charakter Nachdenklichkeit und eine gewisse Langsamkeit auffallen.
Gegenüber dem letzten Mal, als wir uns sahen, kommen Sie mir heute weniger angespannt vor. Mit Verlaub, weniger neurotisch.
Obwohl alles um mich in Bewegung ist, erlebe ich keine große Anspannung. Mit den Jahren, in denen ich meine Erzählkunst entwickeln konnte, habe ich gelernt, dass es gesünder ist, sich darauf zu konzentrieren, was man schreiben muss, und nicht darauf, was man schon geschrieben hat. Deshalb habe ich mich nicht damit aufgehalten, an das zu denken, was geschehen ist. Und dann bin ich auch zufrieden mit dem Diptychon Im Feuer der Erinnerungen [Untertitel für die beiden Romane ›Die Verfolgung‹ und ›Hier sind die Unzertrennlichen‹], das ich, nimmt man den Roman ›Mit bösen Absichten‹ dazu, als eine Art Trilogie meiner Jugend betrachte. Ich bin nämlich in diesem Jahr vierzig geworden. Ein Abschnitt meines Lebens geht zu Ende.
Unter welchem Zeichen?
Nach dem, was ich geschrieben habe, unter Saturn.
Deutet das auf eine tiefsitzende Melancholie hin?
Ich glaube eher, was ich geschrieben habe, ist ein Gemisch aus Sarkasmus, Ressentiment, Nihilismus mit einer Prise Sentimentalität. Das sind die Wesenszüge, die mich beherrschen.
Die sie auf Ihre Familie projizieren?
Ja, aber wie alle, die gegen die Familie schreiben, glaube ich, dass ich ein Familienmensch bin. Die Welt, die ich inszeniere, ist die des amoralischen Familismus.
Besteht nicht die Gefahr, dass diese schonungslose Beschreibung des Bestehenden, so gut sie auch erzählt sein mag, den Lesern unangenehm ist, die dann darauf verzichten, Ihre Bücher zu kaufen?
Ernsthafte Belletristik ist, abgesehen von seltenen Ausnahmen, nie erbaulich. Und ich habe das Gefühl, dass das Problem der Vermarktung von Büchern eher ein Thema für den Verleger als für den Autor ist. Im Übrigen bin ich überzeugt, dass meine Romane sich gut verkaufen. Ich denke nicht im Entferntesten ans Scheitern.
Enzensberger hat die Bilanz seiner Flops gezogen. Das wahre Scheitern für einen Schriftsteller – so behauptet er – liegt nicht darin, dass er sich nicht verkauft, sondern in dem, was all die ungeschriebenen Bücher angerichtet haben, auf die er verzichtet hat.
Ich bin da nicht ganz einverstanden. Das Scheitern eines Schriftstellers hängt nicht von dem ab, was er nicht, sondern von dem, was er geschrieben hat und vielleicht nicht hätte schreiben sollen. Sagen wir, dass Enzensbergers Gedanke entzückend ästhetisierend ist. Das erinnert mich an Baudelaire, der sein ganzes Leben lang Pläne machte, die er nie oder nur teilweise umgesetzt hat.
Aber die Angst zu scheitern hat Sie doch nach dem Erscheinen Ihres ersten Romans schon ein wenig beeinflusst?
Das ist ein menschliches Verhalten, das nur verständlich ist. Ich habe den Druck verspürt. Aber ich hoffe, dass ich mich von dieser Wahrnehmung befreit habe.
Und der Premio Strega, an dem Sie beschlossen haben, teilzunehmen? Glauben Sie nicht, dass er gerade diesen heimtückischen Druck wiederherstellt?
Was soll ich sagen? Ich fühle mich mäßig ruhig. Ich sage mäßig, so wie das ein scheues, neurotisches Individuum angesichts des wichtigsten italienischen Literaturpreises eben sein kann. Ich kenne die Freude des Sieges und die Lust an der Niederlage und ich weiß, dass beide, Gott sei Dank, vergänglich sind. Ich bin auf jedes Ergebnis vorbereitet.
Sie wissen, der Premio Strega ist ein Preis, bei dem die Verleger ein größeres Gewicht haben als die Autoren. In Kürze wird über die letzten fünf Autoren [auf der Shortlist]entschieden. Dazu gehören Sie, von Mondadori vorgeschlagen, sicherlich Carofiglio und Trevi. Dann taucht der Name Fois für Einaudi auf. Ist es möglich, dass zwei Verlage derselben Gruppe das Risiko eingehen, sich zu bekämpfen und sich gegenseitig Stimmen wegzunehmen?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Dann tun Sie es jetzt.
Es beweist, dass die Verlage derselben Gruppe ziemlich unabhängig sind. Einaudi hat das Recht, zu präsentieren, wen er will. Und dann ist die Kandidatur ein Spiel, das ein wohlmeinender Schriftsteller mit etwas Distanz betrachten muss.
Wie kam es zu Ihrer Kandidatur?
Durch gemeinsame Abstimmung mit dem Verleger. Mondadori ist davon überzeugt, ein gutes Buch zu haben und damit den Strega gewinnen zu können. Ich wurde gefragt, ob ich daran interessiert bin, da der Preis bestimmte Verpflichtungen nach sich zieht. Ich war einverstanden.
Glauben Sie nicht, dass der Gewinn des Strega Ihr Leben nur wenig verändern, es vielleicht sogar leicht verbessern würde? Dass es Ihnen jedoch sehr schaden könnte, wenn Sie verlieren?
Es ist ein Preis mit zwölf Kandidaten. Fünf davon kommen in die Endausscheidung. Warum sollte denn eine eventuelle Niederlage für mich eine Katastrophe sein?
Wenn Piperno gewinnt, dann heißt es, es war doch klar, dass er gewinnt, dahinter steht ja Mondadori. Wenn Piperno verliert, beginnt das Spiel der Medien: dass Ihre Bücher ungeeignet, zu unmoralisch sind, dass Sie nicht sympathisch sind, dass Sie spalten usw.
Mein Verleger hat ja nicht gesagt: geh hin und gewinne. Sondern: geh hin und versuche zu gewinnen. Ich bin ein Mensch, der spaltet? Das ist meine Geschichte, ob ich nun den Strega gewinne oder verliere. Ich fürchte nämlich, ein umstrittener Schriftsteller zu sein. Nicht, dass mir der Gedanke gefällt. Denn dabei muss ich an eine etwas lächerliche Figur denken. Andere waren wirklich umstrittene Schriftsteller: Pound, Céline, heute Houellebecq. Obwohl es da bei ihm, neben dem zweifellosen literarischen Talent, etwas gibt, das wegen der mangelnden Ironie oder dem ungenügenden Entsetzen vor sich selbst leicht grotesk wirkt.
Sie können als ein von der Norm abweichender Schriftsteller erscheinen. Nehmen sie nicht auch aus einem Wunsch nach Normalisierung am Premio Strega teil?
Ich versichere Ihnen, wenn ich morgens anfange mit Flaubert‘scher Pedanterie zu schreiben, fühle ich mich alles anderes als anormal. Was Sie mir sagen, wird mir ab und zu von den anderen entgegengehalten. In Wirklichkeit bin ich ein italienischer Schriftsteller, der bei einem großen Verlag veröffentlicht, als einer der bekanntesten seiner Generation wahrgenommen wird und versucht, den Premio Strega zu gewinnen.
Aber um ihn zu gewinnen, müssten Sie da nicht etwas an Ihrem Charakter verändern?
Soll ich etwas Erbauliches sagen? Und zudem bin ich kein unternehmungslustiger Mensch. Mir ist klar, dass einer wie ich gegen seinen verheerenden Fatalismus ankämpfen muss, um am Premio Strega teilzunehmen. Ich werde aber bestimmt keinen der Freunde des Sonntags [Jury des Premio Strega] anrufen, um ihn um seine Stimme zu bitten. Ich habe keine strategischen Vorstellungen. Ich möchte aber im Rahmen des Würdevollen bleiben. Und mich allenfalls mit meinem nächsten Roman beschäftigen.
Arbeiten Sie schon daran?
Ich bin in einer embryonalen Phase. Ich glaube, ich habe eine ziemlich starke Geschichte in der Hand, und ein paar Titel schwirren mir auch schon durch den Kopf.
Welche?
Einer gefällt mir sehr, aber er erinnert mich an einen früheren Roman von Graham Greene: ›Das Ende der Geschichte‹.
Das ist auch der Titel eines berühmten Buchs von Fukuyama.
Eigentlich bezieht der Titel sich genau darauf. Aber übertragen auf einen Roman, der eine Liebesgeschichte mit ein paar zeitgenössischen, ironischen Verwicklungen erzählen soll. Und ein anderer Titel, der besonders zu den hier von uns angesprochenen Themen passt, könnte lauten: »Öffentliche Unfälle«.
Schön, das sieht Ihnen ziemlich ähnlich. Aber die Liebesgeschichte ist ein etwas heikles Genre.
Ich weiß, es ist schwierig. Mich hat der Roman ›Das böse Mädchen‹ von Vargas Llosa sehr beeindruckt, Sich heute an einen Liebesroman zu wagen, ist eine große Herausforderung. George Steiner hat gesagt, dass die einzig glaubwürdige Liebesgeschichte des 20. Jahrhunderts Lolita ist. Das denke ich auch. Es ist schwer, nach Madame Bovary und Anna Karenina etwas Packendes zu schreiben.
Sie möchten eine Geschichte ohne Zuckerguss schreiben?
Es sollte eine extreme Geschichte sein. Und vielleicht läuft sie, wie alle extremen Geschichten, Gefahr, lächerlich zu wirken. Eben habe ich schon Houellebecq erwähnt. Was ist denn das Problem seiner letzten Bücher? Die Tatsache, dass er sich als extremer Schriftsteller präsentiert. Und leider ist da außer dem Extremen oft nur etwas tendenziell Lächerliches.
Sie nennen ihn extrem und nicht grenzwertig. Gibt es da einen Unterschied?
Ich glaube, der extreme Roman ist ausweglos. Man muss ihm misstrauen.
Aber er fasziniert Sie.
Mich zieht die unpathetische Dimension an, die im extremen Gestus liegt.
Und Sie sind bereit, sich der Gefahr des Lächerlichen auszusetzen?
Das werde ich beim Schreiben herausfinden. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, die vom politisch Korrekten berauscht ist. Ich sehe eine erschreckende Menge erbaulicher Bücher und Schriftsteller, die mit erhobenem Zeigefinger Lektionen erteilen. Ich war sehr erschüttert, als in den USA ›Die Wohlgesinnten‹ von Jonathan Littell herauskam. Ein wichtiges Buch, das von der amerikanischen Kritik verspottet und lächerlich gemacht wurde. Da stimmt etwas nicht. Nabokov hätte heute größere Probleme, Lolita zu veröffentlichen, als damals.
Machen Sie sich Sorgen um ihren »extremen Roman«?
Ach, lassen Sie mich ihn doch erst mal schreiben, dann können wir darüber sprechen.
Interview von Antonio Gnoli mit Alessandro Piperno in La Repubblica am 5.5. 2012, anlässlich der Nominierung für den Premio Strega 2012.
Aus dem Italienischen von Andreas Löhrer
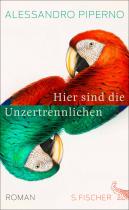
20 Jahre sind vergangen. Die Brüder Pontecorvo sind erwachsen. Doch was heißt das schon bei zwei so begnadeten Neurotikern. Wie kleine Papageienvögel sind sie unzertrennlich, auch wenn jeder nun sein eigenes Leben führt. Und während Filippo die Angst vor der eigenen Berühmtheit plagt, seit sein Comic über die Kinder in den Krisengebieten dieser Welt als Animationsfilm Furore macht, steht sein kleiner Bruder Samuel vor dem Ruin, weil er sich beim Handel mit Baumwolle verspekuliert hat. Und dann die Frauen, ach ja. Ebenso rasant wie beißend komisch erzählt Piperno, wie es erst zum Bruch der Unzertrennlichen und dann zu einer wahrhaft wunderbaren Versöhnung kommt. Ende gut, alles gut.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /