der Stapel abgetragen war. Statt sich nun über diese besorgniserregende Verschlechterung seiner Zukunftsaussichten zu grämen, schrieb er lieber diese Geschichte in der Hoffnung, andernorts einen Markt dafür zu finden. Er kann sich an eine Sommernacht erinnern, in der er spät am offenen Fenster daran schrieb, derweil eine lästige Vermieterin draußen in der Dunkelheit wegen des übermäßigen Gebrauchs ihrer Lampe mit ihm zeterte und vor der träumenden Welt ihre Weigerung ausbreitete, zu Bett zu gehen, solange diese Lampe noch brannte; zu dieser Begleitung schrieb er weiter. Und er kann sich auch erinnern, wie er die Geschichte und die ihr zugrundeliegenden Gedanken auf Spaziergängen im Knole Park mit jener lieben Gefährtin diskutierte, die in diesen abenteuerlichen Jahren schmaler Kost und hoffnungsvoller
Ungewissheit so treu für ihn sorgte.
Die Idee dazu schien in jenen Tagen seine »eine Idee« zu sein. Er hatte sie sich bis dahin aufgehoben in der Hoffnung, eines Tages ein längeres Buch daraus zu machen als die Zeitmaschine, aber das dringende Bedürfnis nach etwas Vermarktbarem nötigte ihn, sie unverzüglich auszuschlachten. Wie der aufmerksame Leser erkennen wird, ist es ein sehr uneinheitliches Buch: Die anfängliche Diskussion ist viel sorgfältiger entworfen und geschrieben als die späteren Kapitel. Eine bescheidene Geschichte treibt aus einer sehr tiefen Wurzel. Der Anfangsteil, die Ausführung der Idee, hatte bereits 1893 in Henleys National Observer das Licht der Welt erblickt. Die zweite Hälfte war es, die 1894 in Sevenoaks so eilig zu Papier gebracht wurde.
Diese eine Idee ist heute jedermanns Idee. Sie war niemals dem Verfasser vorbehalten. Andere kamen ebenfalls darauf. Im Kopf des Verfassers entsprang sie aus Studentendiskussionen in den Laboren und dem Debattierclub am Royal College of Science in den 1880ern Jahren, und schon da war sie von ihm in verschiedenen Formen ausprobiert worden, bevor er ihr diese konkrete Ausformung gab. Es ist die Idee, dass die Zeit eine vierte Dimension und die normale Gegenwart ein dreidimensionaler Ausschnitt eines vierdimensionalen Universums ist. Der einzige Unterschied zwischen der zeitlichen Dimension und den anderen liegt nach dieser Ansicht in der Bewegung, die das Bewusstsein mit ihr vollzieht, wodurch das Fortschreiten der Gegenwart zustande kommt. Je nach der Richtung, in der der vorrückende Ausschnitt erfolgt, kann es offensichtlich verschiedene »Gegenwarten« geben, was eine Art ist, den Gedanken der Relativität zu formulieren, der erst erheblich später in wissenschaftlichen Umlauf kam, und da der »Gegenwart« genannte Ausschnitt real und nicht »mathematisch« ist, muss er ebenso offensichtlich eine gewisse Tiefe besitzen, die variieren kann. Das »Jetzt« ist daher kein dauerloser Moment, es ist ein kürzeres oder längeres Stück Zeit – eine Ansicht, die ihrer gehörigen Würdigung im zeitgenössischen Denken noch harrt.
Aber meine Geschichte untersucht keine dieser Möglichkeiten weiter; ich wusste nicht im Geringsten, wie ich eine solche Untersuchung hätte anstellen sollen. Ich war auf diesem Gebiet nicht beschlagen genug, und eine Geschichte war ganz gewiss nicht der Weg, weitergehende Forschungen anzustellen. Daher rettet sich meine einleitende Ausführung mit dem Mittel des Paradoxons in einen phantastischen Abenteuerroman mit vielen Merkmalen, wie sie für die Zeit Stevensons und des frühen Kiplings, in der sie geschrieben wurde, typisch waren. Bereits früher hatte der Verfasser ein Experiment im pseudoteutonischen Stil Nathaniel Hawthornes unternommen, das im Science Schools Journal (1888 – 89) abgedruckt wurde und heute zum Glück nicht mehr zugänglich ist. Alles Gold von Mr Gabriel Wells kann diese Version nicht wiederbeschaffen. Und es gab außerdem eine Fassung der Idee, die in der Fortnightly Review von 1891 erscheinen sollte und nie zum Druck kam. Ihr Titel war dort »The Universe Rigid« (»Das starre Universum«). Auch sie ist unwiederbringlich verloren, nur ein nicht ganz so unorthodoxer Vorläufer, »The Rediscovery of the Unique« (»Die Wiederentdeckung des Einmaligen«), der auf der Einzigartigkeit der Atome besteht, erblickte im Juliheft jenes Jahres das Licht der Welt. Dann wurde sich der Redakteur, Mr Frank Harris, der Tatsache bewusst, dass er damit zwanzig Jahre zu früh dran war, machte dem Verfasser schreckliche Vorwürfe und band den Satz wieder auf. Falls ein Druckexemplar erhalten ist, muss es sich im Archiv der Fortnightly Review befinden, doch ich bezweifle, dass dies der Fall ist. Jahrelang dachte ich, ich hätte eines, doch als ich nachschaute, war es fort.
Im Unterschied zur Idee ist die Geschichte der Zeitmaschine nicht nur in ihrer Ausführung, sondern auch in ihre Anlage »von gestern«. Sie erscheint ihrem inzwischen gereiften Verfasser bei der erneuten Durchsicht als eine sehr pennälerhafte Übung. Doch sie geht so weit, wie seine Philosophie über die menschliche Evolution in jener Zeit ging. Die Vorstellung einer sozialen Differenzierung der Menschheit in Eloi und Morlocks kommt ihm heute ausgesprochen grobschlächtig vor. In seiner Jugend hatte Swift eine ungeheure Faszination auf ihn ausgeübt, und der naive Pessimismus dieses Bildes der menschlichen Zukunft ist, genau wie die verwandte Insel des Dr. Moreau, der unbeholfene Tribut an einen Meister, bei dem er tief in der Schuld steht. Überdies erzählten uns die Geologen und Astronomen jener Zeit grässliche Lügen über den »unvermeidlichen« Kältetod der Erde – und des Lebens und der Menschheit mit. Es gab keinen Ausweg, schien es. Das ganze Spiel des Lebens sollte in einer Million Jahren oder früher vorbei sein. Sie trichterten uns das mit dem vollen Gewicht ihrer Autorität ein, uns heute Sir James Jeans in seinem gutgelaunten Sterne, Welten und Atome auf Abermillionen Jahre weiterwinkt. Mit derart viel Spielraum ausgestattet, wird der Mensch alles tun und überall hinfahren können, und der einzige Anflug von Pessimismus, der einem den Blick auf die Zukunft der Menschheit ein klein wenig vergällen könnte, ist das leise Bedauern, dass man so früh geboren wurde. Und selbst aus dieser Pein eröffnet die moderne psychologische und biologische Philosophie Auswege.
Man muss irren, um zu wachsen, und der Verfasser bereut diesen jugendlichen Versuch nicht. Ja, es schmeichelt seiner Eitelkeit aufs Angenehmste, wenn seine gute alte Zeitmaschine wieder einmal in Aufsätzen und Reden auftaucht und sich immer noch als praktisch und zweckdienlich für Rückblicke oder Vorhersagen empfiehlt. Während er diese Zeilen schreibt, liegt The Time-Journey of Dr. Barton von 1929 auf seinem Schreibtisch – mit allen möglichen Einfällen darin, die wir uns vor sechsunddreißig Jahren nicht träumen ließen. Die Zeitmaschine hat sich also so lange gehalten wie das Sicherheitsniederrad mit Diamantrahmen, das um die Zeit ihrer Erstveröffentlichung aufkam. Und wo sie jetzt in dieser bewundernswerten Ausgabe erscheint, ist ihr Verfasser gewiss, dass sie ihn überleben wird. Er hat ansonsten den Brauch, Bücher zu bevorworten, schon lange aufgegeben, doch dies ist ein außergewöhnlicher Anlass, und er ist sehr stolz und glücklich, ein paar Worte des Gedenkens und der freundlichen Empfehlung für seinen mittellosen und gutgelaunten Namensvetter zu sagen, der in der Zeitdimension sechsunddreißig Jahre früher lebte.
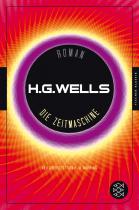
Vollständig. Neu übersetzt von Hans-Ulrich Möhring. Mit einem Nachwort zu Leben, Werk und Wirkung von Elmar Schenkel
Ende des 19. Jahrhunderts unternimmt der »Zeitreisende« – ein nicht namentlich genannter Erfinder – einen Ausflug in das Jahr 802.701, wo er zwei verschiedene Menschenrassen antrifft: die scheinbar sorgenfrei und glücklich an der Erdoberfläche lebenden Eloi und die unterirdischen Morlocks. Erst mit der Zeit findet er heraus, dass zwischen den Eloi und den Morlocks ein Anhängigkeitsverhältnis besteht, das seine schlimmsten Befürchtungen übertrifft!
Nach einem Abstecher in die ferne Zukunft, wo über der stillstehenden Erde ein riesiger roter Feuerball lodert, kehrt er in die Gegenwart zurück. Da ihm jedoch niemand Glauben schenken will, begibt er sich erneut auf die Reise …
Diese Ausgabe enthält neben einem Nachwort des Wells-Experten Elmar Schenkel die gestrichenen Passagen ›Die Rückkehr des Zeitreisenden«; drei Vorworte der Ausgaben der Jahre 1924, 1931 und 1934; den Vorläufer: ›Die Chrononauten‹ aus dem Jahr 1888 sowie die Essays aus dem Jahr 1893 ›Der Mann aus dem Jahr 1.000.000. Eine wissenschaftliche Vorausschau‹ und›Das Aussterben des Menschen. Einige spekulative Gedanken‹ von 1894.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /