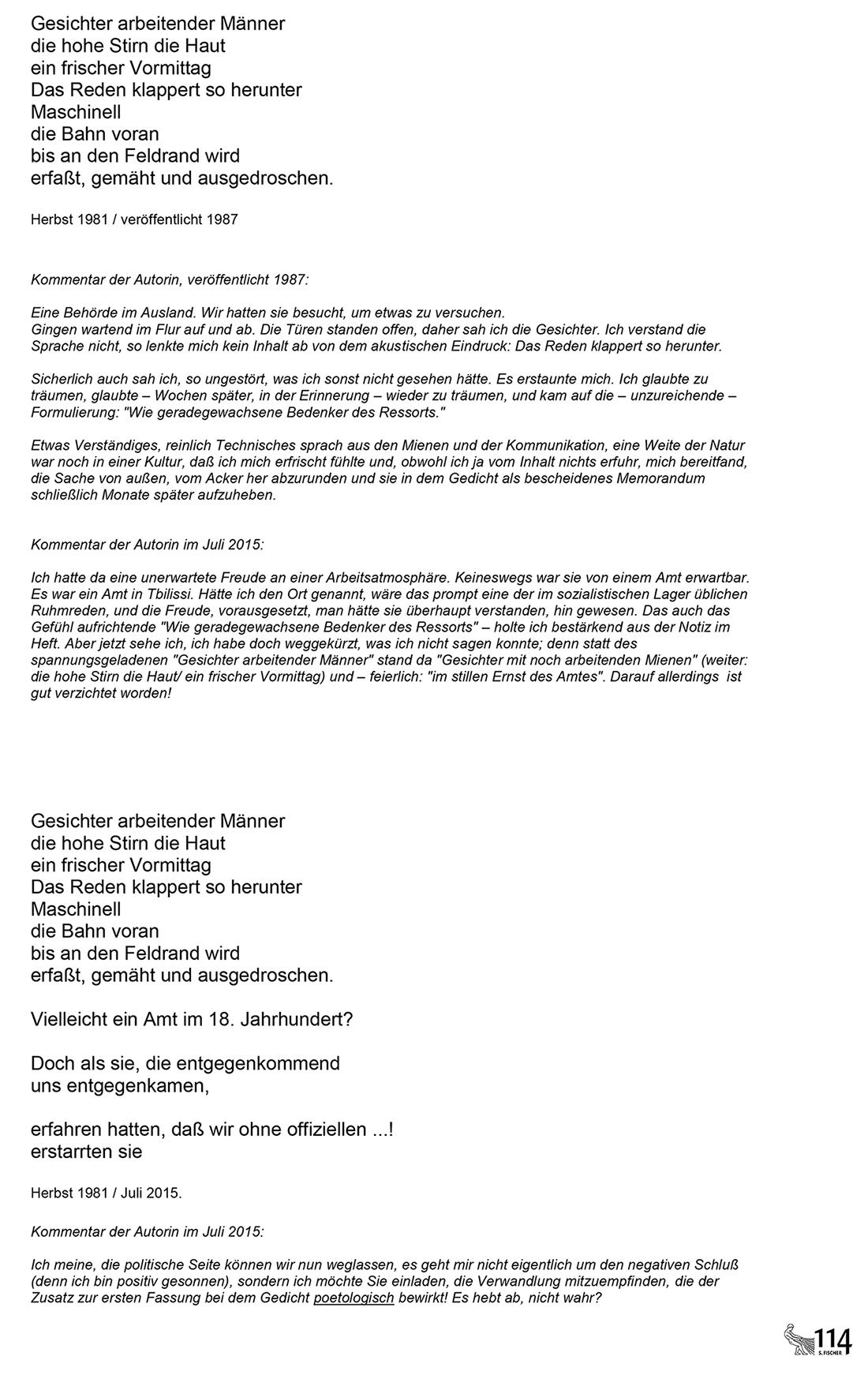
Kommentare
Ich finde, es passiert schon sehr viel von Vers 4 zu Vers 5. Die "unerwartete Freude an einer Arbeitsatmosphäre" teilt sich mir in den ersten vier Versen sofort auf eine ganz direkt und auf absurde Weise ins eigene Wohlbefinden strahlende Weise mit. Aber dann: Von "Maschinell" bis "ausgedroschen" schleicht sich ein Unbehagen ein. Der Bruch ist evident, oder? Da ist was tätig, und in der Art des Tätigseins, seiner Passivität liegt etwas latent Gewalttätiges. Das steigert sich dann noch einmal im Zusatz, das "Doch" stellt das "so" aus Vers 4 infrage. Mir kommt es vor, als würde ein Perpetuum Mobile entlarvt. Als würde eine fragile Situation gestellt. Die sachte Routine beginnt zu holpern mit den ganzen es und rs und ts und steht in der Erwartung still. Aber das meinen Sie nicht mit der Verwandlung, vermute ich.
Verwandlung ist überhaupt ein schwieriger Begriff, der gar viele Konnotationen im Schlepptau hat. Verwandlung als das Wiederaufgreifen der älteren Fassung vor neuen historischen Prämissen, Verwandlung als Transformation der Aufzeichnung in das poetische Bild, Verwandlung als Transfiguration der ganzen Büroszene in ein bäuerliches Idyll. Es ist schon spannend, wie hier von den mechanischen Reden auf die landwirtschaftlichen Maschinen geschlossen wird, auch vor dem Hintergrund der Faszination für die unverständliche Fremdsprache und ihre ganze "natürliche" Effizienz. Verwandlungen finden aber auch auf der Wortebene statt, etwa wenn das Gedicht verblasste Metaphern in die eigentliche Bedeutung zurückholt, zb. wenn die abgedroschenen, klappernden Reden im „ausgedroschen“ wiederkehren. Im Kommentar geht die pflanzliche Metaphorik dann weiter mit den "geradegewachsenen Bedenkern des Ressorts". Die Substantivierung ist sofort beklemmend, latent gewalttätig in der Tat, fast kommen einem die Bedenker wie Henker vor. Die Taubheit der Behörden für das Anliegen der Besucherin apodiktisch, keinen Widerspruch duldend. Und trotzdem ihr Festhalten an dem Vergleich mit der Feldarbeit, auch im Sinne eines Vertrauensvorschusses, mit dem unbedingten Willen, den Amtsweg "vom Acker her abzurunden" (!) - in ein poetisches Bild zu verwandeln.
Dieses Bild nun bekommt von Fassung zu Fassung einen neuen Rahmen, inwendig aber ist es von Anfang an darauf angelegt, gestürzt zu werden. Sehr beeindruckend finde ich die immense Verschränkung von Zeiträumen, die in dem Textkonglomerat, nicht nur biographisch, vollzogen wird. Das ganze "Lebewesen" des Büromenschen wird anthropologisch fassbar, der evolutionäre Weg von der Seßhaftigkeit zum Ackerbau bis hin (großer Sprung!) zur Ressortbildung und bürokratischen Entscheidungsfindung. So zumindest in der nachgereichten Fortsetzung, die den Emblemcharakter aufhebt zugunsten der auserzählten Anekdote. Auch sie mit Aussparung: ohne! ohne offiziellen! das Entgegenkommen also grundlos! Dieses Rufzeichen nach den Auslassungspunkten ist grandios. Es enthält, gewollt oder ungewollt, mehr Systemkritik als es eine ganze Abhandlung es vermocht hätte. Das Ich ist aber "positiv gesonnen" gegenüber den fleißigen Amtshandlern, denen, wie es immer so schön heißt, "die Hände gebunden sind", weil die Dokumente das so wollen. Ein ganzes Szenario von leerlaufenden Anträgen, Vorladungen, vorschriftsmäßigen Ausschlüssen usw. tut sich auf. Ohnmacht gegenüber einer Macht, die ihr Gewaltpotential hinter der ausführenden Geste verschweigt. Aber die Anklage bleibt selbst in der längeren, früher unpublizierten Tagebuchvariante nur implizit.
Als nicht ganz einleuchtend empfinde ich die Empfehlung, die "politische Seite" auszuklammern, selbst wenn ihr nicht mehr viel abzugewinnen wäre. Das Politische leiht der Rückführung des Stimmungsbilds (ursprünglich gedruckte Fassung) in die reale Ausgangssituation doch erst seine überpersönliche Tragweite. Und das „Abheben“ könnte vielleicht ebenso als ein Zurückholen auf den Boden der Tatsachen gelten. Oder hebt es ab, gerade weil es konkret wird? Ist die Verwandlung nichts Anderes als das Rückgängigmachen einer Verdichtung? Eigentlich kann ich mir "Verwandlung" und „Abheben“ nicht anders erklären als in Hinblick auf den ganzen Prozess zwischen Neuschrift und Selbstbefragung, reziproker Revision und psychologischer Reaktion auf einen Text aus einem früheren Lebensabschnitt. Das Gedicht wird seinen Varianten ausdrücklich ausgesetzt oder überhaupt durch deren Kenntnisnahme rekontextualisiert. Notiz nehmen von einer Notiz, das ist bereits das Ereignis, Aufmerken gegenüber einem fast Vergessenen. Wobei die Fortschrift offen läßt, inwieweit sie Fortschritt ist. Hier kommen einige Rezeptionsgemeinplätze ins Wanken. Wo ist die Matrix, wo das Destillat? Der Geistesblitz kann nachträglich in das Geschriebene eingreifen; die Kommentarebene ist nicht die Aufpropfung, sondern wird zum Boden, auf dem das Alte aufsitzt. Die Textkommentare lassen das Gedicht selbst als Kommentartext erscheinen und trotzdem Gedicht bleiben. Das ist sehr bemerkenswert. Daß der paratextuelle Hinweis kein Fremdkörper ist, empfinde ich als ein Privileg dieser Art zu dichten.







 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /