
Kommentare
Es ist frühmorgens/ es ist abends, man hält sich in Wien auf (»Augarten«)/ in Graz/ irgendwo wo sich der Russe Mandelstam auch mal aufgehalten hat vielleicht anlässlich seines, wie ich meine, einzigen Westeuropaaufenthaltes von 1911, aber (russische) Birken dürfen auch nicht fehlen, man erinnert einen Moment, wohl in einer fernen Vergangenheit, es ist etwas leicht glamouröses/ luxuriöses dabei (der weiße Schal, das Taxi), kleine aufgelöste Wortklümpchen werden zu einer nie abreißenden Schleife zusammengefügt (saith the Poet).
Sie muss es sein. Sie ist es. Die »nämlich-Sagerin«, die »nämlich«-Stimme. Die immer wieder mit dem »nämlich« spielt, sich da hinein- und ihren Text daran entlangspielt. Es gibt das »nämlich« allgemein und es gibt das »nämlich« im Speziellen. Wobei es sich bei Letzterem um kein Spezialisten-»nämlich« handelt. Sondern um das süße Chamäleonzüngelchen des hier sehr lyrischen Ichs. Die Selbstvergewisserung als Seelenverwandschaftsvergewisserung. Wildeste Vermutung kann sofort altes Wissen werden. Gemeinsamgrund. Es schüttelt mich, dies »nämlich«. Wie ein Liebling. Wie einen Liebling. Man erfindet und findet sich stabil darin. Aurora wie Mandelstam, na klar. Nämlich klar. Es überholt die Rekurrenz und erholt dabei das Sprechen zu Poesie.
Wenn Heißenbüttel sagt, das Poetische sei „ein Zustand der Sprache“, kommt es mir hier mitunter so vor, als würde eine sich fortwährend in einen „poetischen Zustand“ versetzen, um sprechen zu können. Aber was ist ein „poetischer Zustand“? Hier wird es heikel. Ich habe mit diesem assoziativen Schluchzen auch manchmal meine Probleme, mit diesem dauer-aphrodisierten Kreislauf aus Erbarmen-Haben und Zu-Herzen-Nehmen, mit diesem dichtenden Durch-die-Welt-Taumeln, mit diesem Sich-Aufladen an den eigenen Träumen und Tränen, mit diesem ununterbrochenen Aneinanderreihen von leuchtenden Unscheinbarkeiten.
Sehr schön wieder finde ich den Gedanken, zurückzugehen zu dem Moment, als ein „blühendes Unheil“ noch nicht ausgebrochen (ausgesprochen?) war; es abwenden, indem man es aufsucht mit einem erst nachträglich dafür geschaffenen Wort… Alles teilt sich plötzlich in ein Vorher und ein Nachher, und das Gedicht wird über die Anrufung des Geliebten hinaus zur Hommage an dieses unversehrte Leben, das neben dem beschädigten, endenden, wehtuenden geradezu gespenstisch intakt weiterbesteht. In der Erinnerung oder sogar auf den Straßen und Wegen der mit einem eigenen Gedächtnis ausgestatteten Stadt. Der letzte Vers eine Wucht, wenn die Sängerin ihre Lieder forsch aus dem Netz zieht, oder das zumindest in den Raum stellt, ohne mit dem orphischen Mythos zu brechen.
ja, ich hatte auch probleme mit all dem, was th.p. so präzis beschreibt, früher, doch als ich es jetzt so exakt formuliert fand, rief es auf einmal in mir: aber wie wunderbar, dass es so etwas gibt, so einen unbedingten glauben an das rettende wort und überhaupt jemanden noch mit solchen emphatischen und seis drum auch etwas exaltierten seelenzuständen. auf einmal flammte auch so eine dichterauffassung hoch und ich befand es für gut. aber viel wichtiger: das finden wir ja gar nicht in diesem gedicht. was wir finden, ist eine sehr lose erscheinende kette von assoziatione oder eine lose kette von als assoziationen erscheinenden wörtern. aber verrückterweise ist dies, je genauer man schaut, eben gar nicht so lose (was für mich kein mangel wäre, aber eine genreeinschränkung sozusagen, bzw eine einengung auf einen bestimmten, nicht ganz so dichten modus hin), sondern alles sehr schön gefügt, selbst mandelstam und die birken wirken nicht aufgesetzt, sondern entfalten einen poetischen raum, in dem schön offen bleibt, ob es hier nur um persönliches geht, geschichtliches (wird womöglich die deportation mandelstams imaginiert?) oder gelesenes.






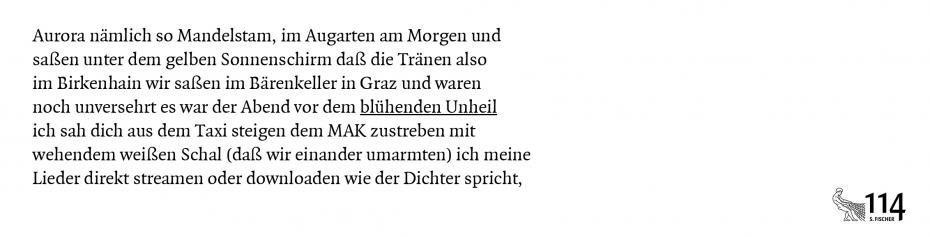
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /