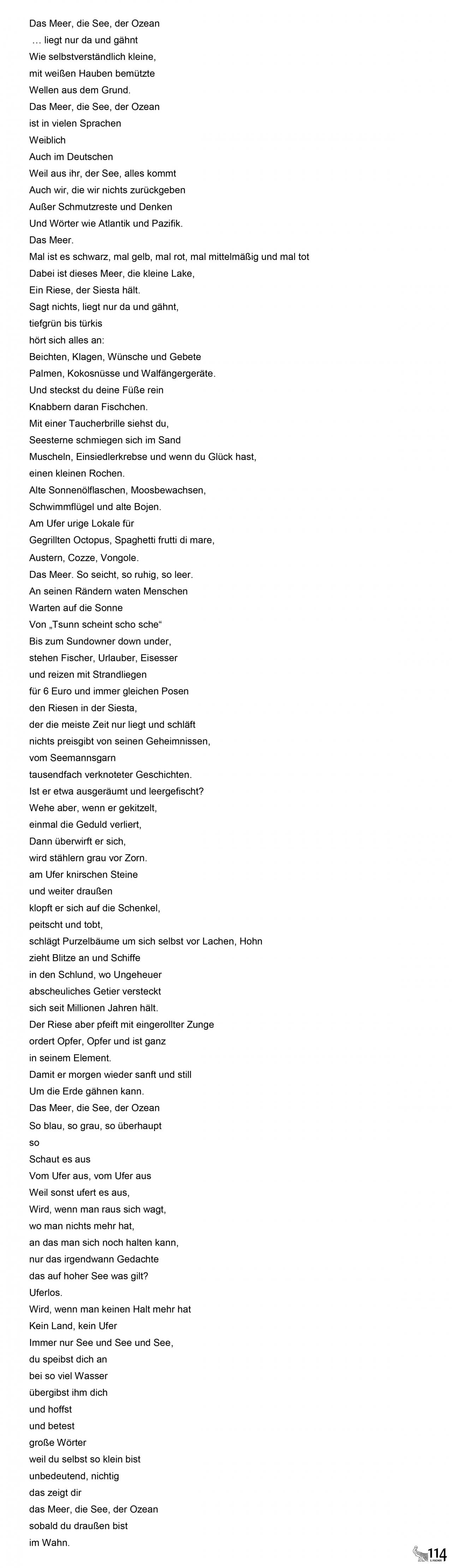
Kommentare
Ein weites Thema, ein Spielfeld für mannigfache Assoziationen. Das Gedicht greift sie auf, beginnend mit der Vokabel "Meer" (See, Ozean). Dann mutiert das Wort zum schlafenden oder zornigen Riesen, der für Sanftheit oder Aufruhr sorgt. Alles da: die Topoi von Palmenbeach und verschlingendem Element, von Seefahrt und Walfängerei, von Taucherparadies und Seekrankheit. Wo das bekannte Repertoire auszuufern droht, setzt das Gedicht ihm ein Ende. Eine Spur zu spät vielleicht, denn Epiphanien waren eh nicht in Sicht.
In den ersten fünf Abschnitten ist dieser Meeresanbeter ein Uferwesen, er blickt, er schaut, er wendet die Worte im Mund und sammelt, was ihm die Wellen anspült. Mehr noch ein Sehgedicht, als ein Seegedicht. Zuletzt erst überlässt er sich den Weiten der See und damit dem Wahn. Sinnfällig, dass der Redeschwall verebbt, während "immer nur See und See und See" die Rede überspült.
Auf der einen Seite dieses tolldreiste Auftürmen von Gegenständen, Attributen, Beobachtungen und Denkmustern - alles, was das Meer so hergibt, wird hier aufgezählt im Text verstaut. Auf der anderen Seite die stoische Wiederholung des einen, schlichten Satzes: "liegt nur da und gähnt". Die knappe Personifikation des Meeres ist ihrerseits großartig: Das Meer ein Riese, irgendwo ganz tief unten ein Grund, der Rest ist Schlund - und der steht sperrangelweit offen, da vor einem das Meer gähnt, bis man im Schlund den Ab-Grund oder auch das Abgründige zu sehen glaubt.
Das Schöne ist, dass mit der Vermenschlichung des Meeres, die ja sonst so häufig zum Erklärungsgehilfen für das Unfassbare degradiert wird, in diesem Fall so gar nichts erklärt wird. Denn ausgerechnet die allzumenschliche Eigenschaft des Gähnens ist der Forschung bis heute ein Rätsel. Jeder macht's, aber warum, das ist ungeklärt, auch die Langeweile hilft als Erklärung nicht weiter. Die jüngste Forschung zum Gähnen (ja, das gibt es) nimmt an, dass es vielleicht am ehesten eine soziale Funktion haben könnte: Gähnen steckt an. Kein Wunder, dass sich Heerscharen von Menschen dazu gemüßigt fühlen, sich beim Anblick des gähnenden Meeres hinzulegen und Richtung Meer zurück zu gähnen. Das ist nur die Reaktion auf das Gähnen des Meeres.
Das Gespür für kurioses menschliches Verhalten ist kein einmaliger Zufallstreffer. Immerhin spielt das Gedicht ebenfalls durch, dass der schlafende Riese nur dann aus seinem Schlaf erwacht, wenn gekitzelt wird und sich dann vor Lachen überschlägt. Um die Empfindung des Lachkitzels steht es in Sachen Rätselhaftigkeit genauso wie um das Gähnen: man weiß so gut wie nichts über diese menschliche Empfindung. Mit dem Gähnen und dem Kitzlig-sein wird das Verhalten genau beschrieben und bildlich faßbar gemacht, ohne letztlich irgendetwas von seinem geheimnisvollen Wesen zu entbergen - das aber überzeugt an diesem Gedicht.








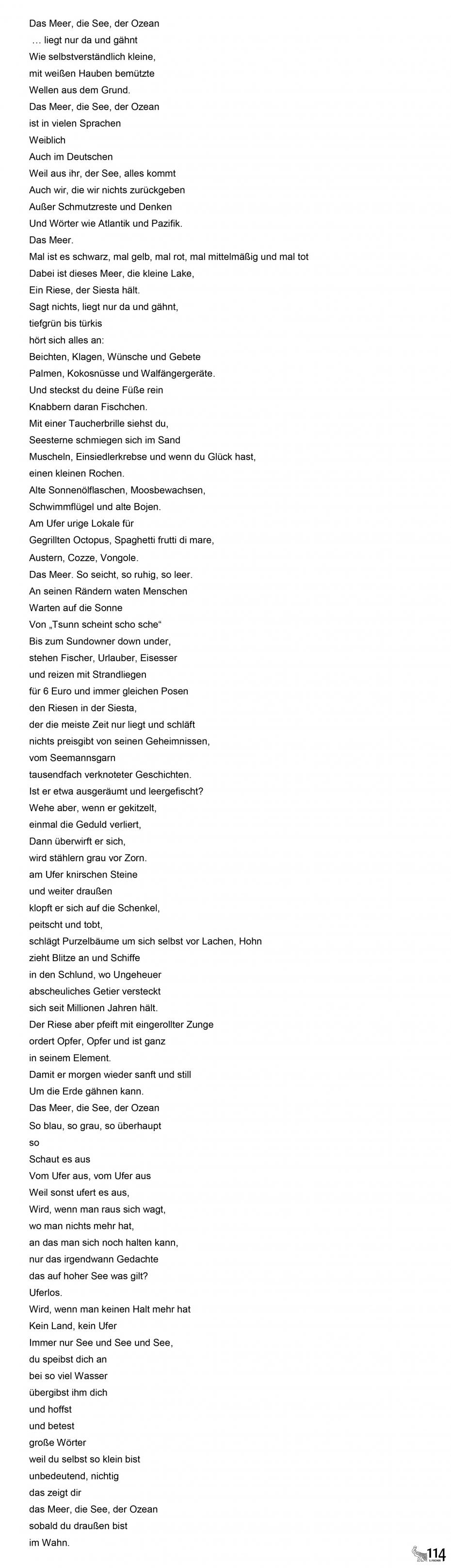
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /