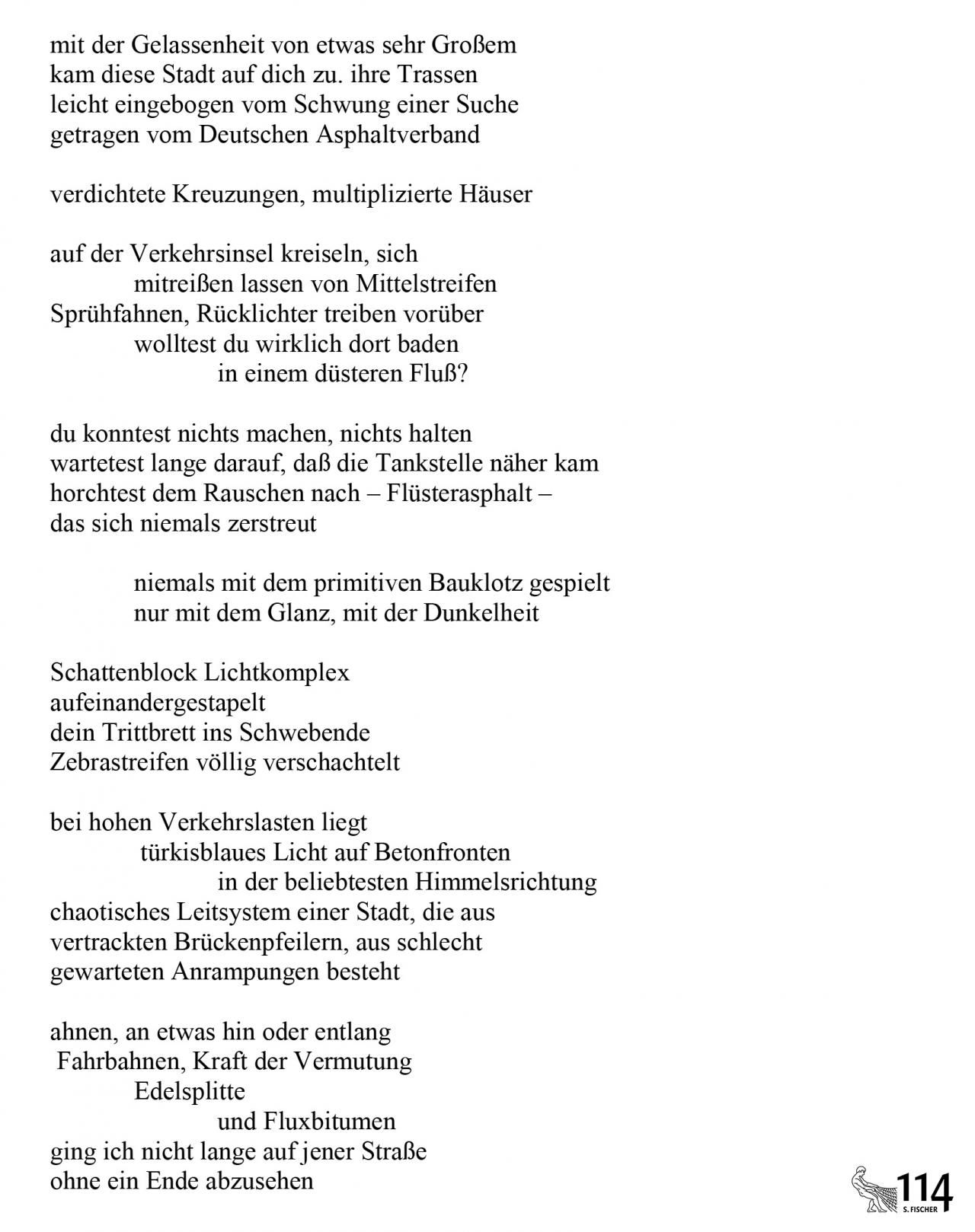
Kommentare
Gelassen mag diese Stadt dem Ankömmling erscheinen, doch wirkt sie zunehmend unheimlich. Wie ein Labyrinth aus Beton, Asphalt ("Flüsterasphalt"), Fluxbitumen und Edelsplitte, aus Straßen, Verkehrsinseln, "verdichteten Kreuzungen" und "multiplizierten Häusern", aus "vetrackten Brückenpfeilern" und "schlecht gewarteten Anrampungen". Kein Mensch in Sicht, dafür Schattenblöcke und Lichtkomplexe. Wer sich hierher verirrt, mag nicht lange bleiben, sieht ein Ende ab, weil er es sehen will. Oder weil er kraft Ahnung und Vermutung am Ende "jener Straße" sein Ziel erreicht hat. Verstörend der Gang, den die Dichterin beschreibt, nein beschwört: aus "Sprühfahnen", "Rücklichtern", Zebrastreifen und anderem urbanistischen Zubehör entsteht eine schimärische Welt.
Wie müßte ein Gedicht beschaffen sein, um die Idiomatik einer Stadt zu erfassen? „Rechts oder links abzubiegen, ist das schon ein poetischer Akt?“, fragte Walter Benjamin in seinem „Passagenwerk“. Gedichte, die wie Städte wären, genau das sah er bei Baudelaire verwirklicht, der hinter wechselnden Masken und Häuserfluchten dem „Inkognito“ als „Gesetz seiner Poesie“ verpflichtet blieb. Baudelaire selbst hatte mehr von einer „poetischen Prosa“ geträumt, „deren Rhythmus und Diktion der Großstadt nachempfunden wäre, musikalisch ohne Rhythmus und ohne Reim, geschmeidig und spröd genug, um sich den Chocks des Bewußtseins anzupassen. Dieses Ideal, das zur fixen Idee werden kann, wird vor allem von dem Besitz ergreifen, der in den Riesenstädten mit dem Geflecht ihrer zahllosen einander durchkreuzenden Beziehungen zuhause ist.“
Worauf sich, nach dem "Ende der Flanerie", der poetische Orientierungssinn noch stützen könnte; was geschieht, wenn nicht mehr die Simultaneität der optischen und akustischen Eindrücke die Gehenden bewegt, sondern die Stadt selbst es ist, die sich in Bewegung setzt, läßt sich mit diesem Gedicht vielleicht besser verstehen. "Gelassen" kommt die Stadt uns aus ihm entgegen, gelassen ist aber auch die Stimme der Berichterstatterin, die vom Mitgerissenwerden, von Verdichtung und Multiplikation, von Chaos und Vertracktheit erzählt, kurz von Dingen, fernab von der Semantik des Müßiggangs, die dem Flaneur der ersten Stunde seine selbstgenügsame Beschwingtheit verlieh.
Überhaupt scheinen diese Verse einer menschenleeren Zivilisation zu gelten, die wie zum Hohn eine gewohnte Infrastruktur aufrecht erhält. Auf das sprichwörtliche Bad in der Menge kann da nur noch verwiesen werden, ungläubig fast: „Wolltest du wirklich“? Ein ökologisches Desaster kündigt sich an oder ist bereits vollzogen. Keiner, der den Blick dieser Getriebenen noch erwidern könnte, nur die unendliche Ruhe angesichts eines Untergangs, der aus anderer Perspektive (es gibt hier nur andere Perspektiven) auch nur ein Spaziergang sein könnte, auf dem sich die Stadt von ihren Bewohnern erholt. Allein „kraft der Vermutung“ gelingt es der Passantin, sich in dieser Welt noch über Wasser zu halten, wenn ihr „Ahnen“ sich zu „Bahnen“ verfestigt, die sie hinwegtragen über fortlaufende Haltlosigkeiten. Wenn es ihr sonderbare Verkörperungen zuspielt, Wörter wie „Flüsterasphalt“, „Schattenblock“, „Lichtkomplex“, oder Erdung in verwegenen Reimen sucht wie jenem von „Vermutung“ auf „Fluxbitumen“.
Aber so wie Karl Kraus den Reim einst bestimmt hatte, als „metaphyische Notwendigkeit“, als „Worthalten“ a priori aufeinander verweisender Wirklichkeiten, so wird in dieser Welt nicht mehr gespielt. Dafür ist der Sog des Logos viel zu bedrohlich geworden, und auch hinter der endlich eingeschlagenen Richtung „jener Straße“ in der letzten Strophe verbirgt sich bestenfalls ein Umbruch, aber kein Sinn. Wo Dylan Thomas noch protestiert hatte „Do not go gentle into that good night“, tut es diese Nachtwandlerin lieber der Stadt gleich, wenn wir sie in der letzten Szene davongehen sehen wie einen am Horizont verschwindenden Filmhelden, von der Kamera noch ein Stück des Weges begleitet. Sie sieht etwas, was wir nicht sehen, ein „Ende“ nämlich, durch die simple Umkehrung der Redewendung zu etwas Absehbarem, zu einer Absicht geworden.
Mit ihren Fragmenten flottierender Wirklichkeit, mit ihrem Wirrwarr von Auf- und Abgängen, Streifen und Pfeilern, Kreuzungen und Schleifen, Schranken und Signalen erinnert diese Metropole, mehr geometrisches Muster als Lebensraum, an die optischen Ausweglosigkeiten der Escher-Zeichnungen. So dachte ich jedenfalls, bis mir das Selbstverständlichste dämmerte: Die Bilder und Konstruktionen, die dieses Gedicht gespeist haben, sind natürlich jene des Widmungsträgers, des Malers Roland Franke, der, so heißt es auf der nun verwaisten homepage, am 30. Januar 2015 nach schwerer Krankheit verstarb. Dieses Hintergrundwissen führt auch das „Trittbrett ins Schwebende“ einer anderen Lesart zu: stairway to heaven, Gebilde aus Licht und Schatten, leibhaftige Unterwanderung physikalischer Gesetze, wie sie den Werken des Malers nicht beklemmender hätte entspringen können.
Was über diesen Text hinausgeht und dennoch hierher gehört: Die Attribute, die hier die Stadt näher beschreiben, werden in einem anderen Gedicht derselben Autorin einem Naturgegenstand zugedacht: „mit der Gelassenheit von etwas sehr Großem / kam dieser Berg auf mich zu“ endet das Gedicht „Scholar's Rock“ aus „Geliehene Landschaften“. Diese Überschneidung ist zu eklatant, um als Recyclen einer gelungenen Findung abgehakt zu werden. Denn bei näherer Betrachtung von „Scholar's Rock“ zeigt sich in der Tat, daß das „sehr Große“ auch in etwas ziemlich Unscheinbares und Zerklüftetes eingelassen sein kann: in einen Gelehrtenstein zum Beispiel, der in jenem Gedicht nicht nur den See enthält, „der ihn formte“, sondern auch das ganze "subtile Shanghai" und „einen schwarzen, / schlafenden Drachen, der geistig gemeint ist“ . Diese nur geistig verfügbare Fülle, die komprimierte Anwesenheit des Abwesenden, Gewesenen, macht den "Scholar's Rock" zum Komplizen der Dichterin - ist doch das Unzerstörbare an ihm gerade das, was unsichtbar in ihm ruht.
Durch das Zusammenspiel aus dem Titel "das Unzerstörbare" mit der Widmung "für Ronald Franke" ist dieses Gedicht datierbar. Der vor allem für seine Stadt- und Flussbilder berühmte Maler Ronald Franke ist vor etwas mehr als einem Jahr, im Januar 2015 verstorben. Dieses Gedicht erinnert an den Verstorbenen, es widmet sich ihm und es ruft ihm - und dieses Dialogische ist nicht einfach nur behauptet - in Erinnerung, dass es neben dem eigenen Tod etwas als "das Unzerstörbare" zu bewahren gilt: seine Arbeiten.
Das Gedicht seinerseits ist Bildbeschreibung und Annäherung an Frankes Arbeitsweise. Es besteht aus zwei Mal 4 + 6 + 6 Versen. Über die Symmetrieachse hinweg vermitteln die Verse: "niemals mit dem primitiven Bauklotz gespielt / nur mit dem Glanz, mit der Dunkelheit / Schattenblock Lichtkomplex / aufeinandergestapelt". Treffender lassen sich Frankes großformatige Stadtkompositionen kaum fassen. Grisaille-Malerei, in Schwarz, Weiß und den Abstufungen von Grau gehalten. Die Konturen über seine Schattenwürfe erhaltend: (http://ronaldfranke.jimdo.com/werke/)
Das Gedicht ist zugleich seinerseits eine eigenständige Schwarz-Weiß-Malerei, deren Gespräch über das persönliche "Du" hinausweist, und das mit seiner Bildsprache die Schatten- und Lichtkomplexe einer Stadt entwirft. Es ist eine dreifache Annäherung an den Raum zwischen Tod und Leben, Schwarz und Weiß. Annäherung heißt hier, das Erahnen der Stadt, des Vor-Bildes, aber auch des künstlerischen "Ahnen". Dieses Ahnen wird dem Griffsicherheit vortäuschenden "Begreifen" vorgezogen. Daher beginnt das abschließende Sextett mit: "ahnen, an etwas oder entlang"
X






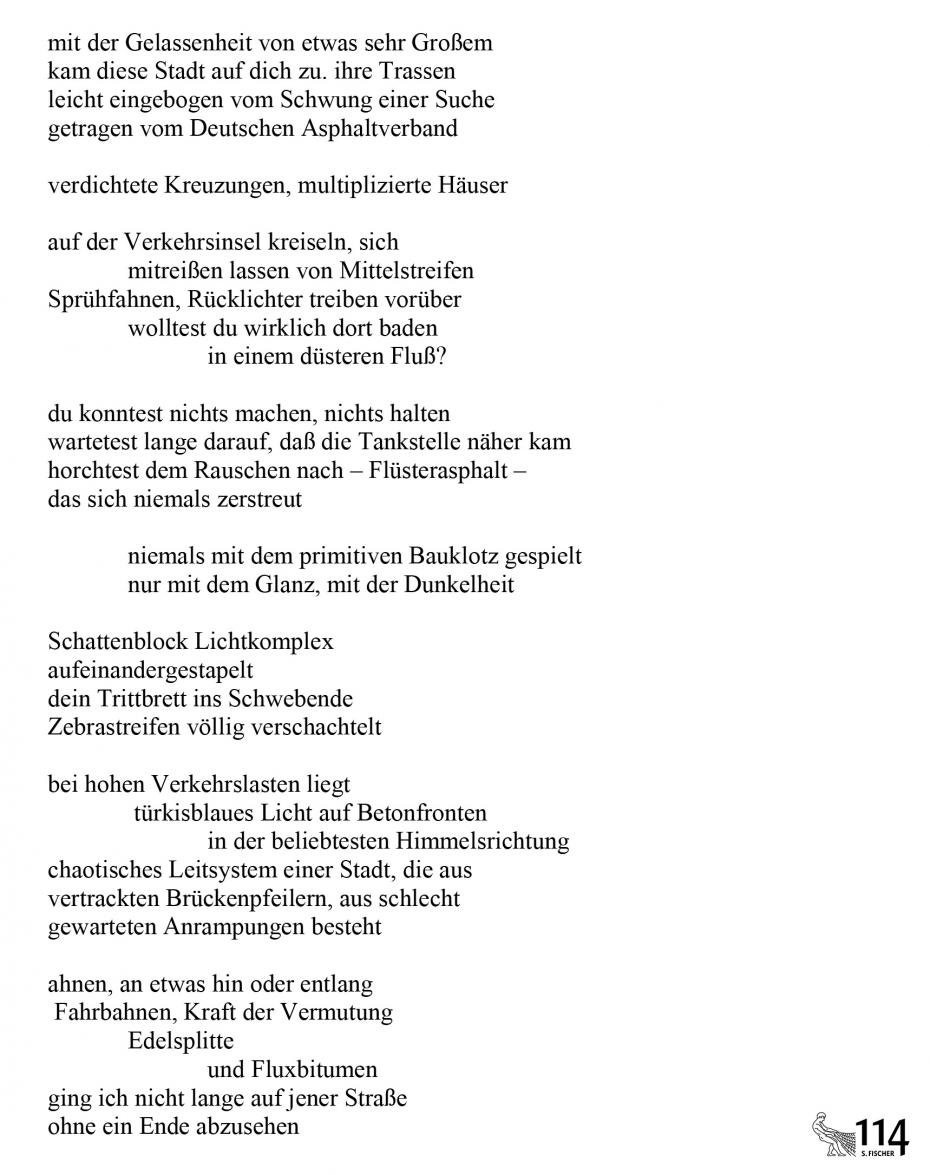
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /