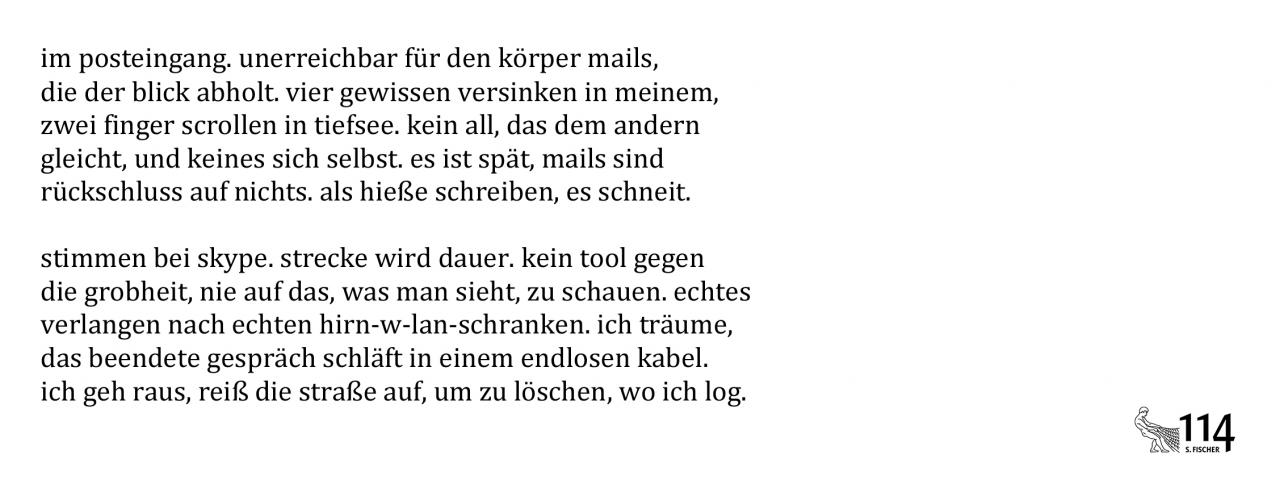
Kommentare
das gedicht ist erst blass wie ein gesicht, das nur vor dem pc sitzt. sein schlaffes erwehren macht es noch lang nicht bärig. dann aber gehts endlich raus und raftt sich zusammen, reißt gar strasse auf. das tut gut. und ist nicht mal gelogen.
Aber was macht es dir blass? Weil es zunächst nur Grundstufe ist für etwas, das erst noch Poesie werden muss? Das ist doch gut. Statt Eskapismus Inkapismus.
Schöne digitale Welt. Virtuelle Tiefsee, Schneegestöber, jeder Vergleich passt, der das Unfassbare ausdrückt. Denn hier sind wir - und sind nicht. Unkörperliche Kommunikatoren, deren Botschaften oft "rückschlüsse auf nichts" zulassen. Und so meldet sich der Drang nach Echtheit, nach "echten hirn-w-lan-schranken". Im Traum imaginiert das Ich eine reale Intervention: das beendete Skype-Gespräch schläft "in einem endlosen kabel. / ich geh raus, reiß die straße auf, um zu löschen, wo ich log." Prima. Nur ist der geträumte Wunsch des Digitalen Bruder. Nicht zu greifen, es sei denn als realisierte Metapher. Als Sprachkonstrukt.
ich sehe den letzten satz als beschreibung einer realie, nicht mehr als metapher. ob einer realie der realität oder der gedankenwelt ist dann fast egal (im czerninschen sinne)
Was ich hier mag, ist die 2x5zeilige wie beidhändige Form. Als habe sich in der 10-Finger-, Zehnzeilenübung jemand wieder selbst bemächtigt – eben das Gedicht in den wirren Wortwelten des Netzes noch nicht von einem Algorithmus oder von Bits und Bots verfasst. Sondern (dort, "wo ich log") ringt und erlangt Persona Sprache eigenständig wieder zurück und schafft aus eigenen Händen? Weshalb die Form konsequent im Widerspruch zu seinem Erscheinungsort, im Netz nämlich, und der Unerreichbarkeit von Mails für den Körper; den nicht zugriffigen Gesprächen, die in endlosen Skype-Kabeln versacken, usw., steht.
Und im Widerspruch auch zum Titel "im posteingang" – dort lediglich gefunden vom Verfasser, haha, der somit keiner mehr ist; im Spam-Ordner womöglich.
Als Titel wird es nur hier ausgezeichnet, es ist einfach der Textanfang.
Was ich nicht verstehe: "unerreichbar für den körper / mails, die der blick abholt." Ist gemeint, man schaut die Mails an, oder liest sie, und der Körper ist sozusagen unbeteiligt? Aber etwas anschauen, etwas lesen, ein Blick - ohne Körper, in dem die Augen sitzen und die Nerven verlaufen usw., geht das doch nicht. Es ist so allgemeingültig formuliert (es heißt ja nicht "für meinen körper"), dass ich recht nicht weiß, was ich mit dieser Stelle anfangen soll.
Was ich nicht verstehe: "unerreichbar für den körper / mails, die der blick abholt." Ist gemeint, man schaut die Mails an, oder liest sie, und der Körper ist sozusagen unbeteiligt? Aber etwas anschauen, etwas lesen, ein Blick - ohne Körper, in dem die Augen sitzen und die Nerven verlaufen usw., geht das doch nicht. Es ist so allgemeingültig formuliert (es heißt ja nicht "für meinen körper"), dass ich recht nicht weiß, was ich mit dieser Stelle anfangen soll.
Liebe Martina, ich bin nicht sicher, ob du mit deiner Frage, was "gemeint ist", auf eine Antwort, eine Erklärung aus bist, die das zum Resultat hätte, was intelligibles "verstehen" meint. Die kann ich nicht geben, aber nicht aus Unbeholfenheit oder Geheimniskrämerei. Denn mich interessiert im Gedicht nicht so sehr, 'wie es ist', im Sinne einer bio-physikalisch korrekten Benennung davon, was mit dem Körper passiert, wenn ich Mails lese. Mich interessiert es, dass eine solche Erklärung doch oft herzlich wenig damit zu tun hat, was die Wahrnehmung da macht, als körperliche. Produktive Unverständlichkeit. Nie kann der Blick etwas abholen, aber ständig holt er etwas ab. Der Blick als Instrument des Körpers, das innerhalb von ihm außerhalb von ihm agiert. Verbindungsfehler. Diagnose starten. Den Laptop aus dem Fenster werfen, nachdem man ein Fenster geöffnet hat, indem man gesehen hat, was man nie wieder sehen will. Usw. "Nicht verstehen", nicht wissen, was man damit "anfangen soll". Usf.
Und allgemeingültig formulieren muss ich es, weil es doch mindestens genauso viel Gültigkeit darin hat, wie es ist.
Lieber Tristan, kann sein, jede/r hat seine eigene Weise, was zu verstehen. Mich hätte eine, wie du es nennst, bio-physikalische Benennung vielleicht angesprungen, wer weiß. Es ist auch nicht so, dass deswegen für mich das ganze Gedicht (das mir ansonsten echt gut gefällt) nicht verstehbar ist, ich bin ja auch nicht auf Verstehen aus - aber eine Art in sich geschlossener Logik mag ich schon, bzw. brauche sie - nur für mich, nicht im Sinne einer allgemeinen Forderung - um eben manche Sachverhalte durchdringen zu können.
ich finde das Gedicht spannend als Bilanz oder besser Beispiel für ein Betrogenwerden um Welt, das ebenso ein Massenphänomen ist, wie es sich vielleicht noch nicht in seiner ganzen Tragweite gezeigt hat; spannend als Nachdenken über Körperlichkeit, die aus der Wahrnehmung verschwindet; als nicht wertendes Bewusstwerden eines gewandelten Nähebegriffs usw. Ich bin keine digital native, ich kann mich noch an die Wählscheibe unseres cremeweißen Telefons erinnern, das Klacken bei jedem Einrasten, an eine selbst gekaufte elektrische Schreibmaschine, an das endlose Vor- und Zurückspulen auf der Suche nach dem einen Lied, an mühsam am Leben erhaltene Brieffreundschaften, und schließlich den ersten Rechner, und wie außerirdisch die ersten Mails darauf anmuteten. Am Anfang war man ja unheimlich begeistert von dem neuen Medium, es war nicht zu glauben, es fühlte sich an wie eine Überlistung des Wartens, Präsenz, die erneuerbar aber niemals lästig war, Dauer-Verbindung ohne Verbindlichkeit. Mit der Zeit wurde das so selbstverständlich, dass die Irrealität nicht auffiel, es gab sie als Option, schwarze Löcher und weißes Rauschen, täuschend echte Erfahrungen, die sich erst nach ihrem Verebben sonderbar taub anfühlten. (Gerüche lassen sich immer noch nicht googlen.) Dann plötzlich, und dennoch unbelehrbar, der Schock: Ständig klicken wir auf „Aktualisierung“ und verpassen dabei unser Leben! (Kinder helfen dagegen.)
Das ist es, was mich aus dieser letzten Zeile anspringt, ein Aufwachen, Hellwerden, den Vorhang-Beiseiteziehen; das virtuelle Erlebnis, das sich anschickt, in der „realen Welt“ Wirkung zu werden, real oder nur gedanklich real, was auch immer; wer hier spricht, hat von beiden Welten Kenntnis, kann sie aneinanderhalten und sehr wohl auseinanderhalten, ja besteht geradezu auf dieser Praxis. Die Simulation hat einen Reiz erzeugt, aber der Reiz reißt nichts auf, oder besser, er reißt etwas auf, aber es zeigt sich keine Verletzung, was vielleicht der noch größere Horror ist. Wo sind die Kabel, mit denen wir uns noch strangulieren konnten? Und könnte ein wohlprogrammierter „Lego-Mindstorm“-Roboter vielleicht keine Straße aufreißen? Die Frage ist aber vielleicht auch, welche Metaphern für diese Zwischen-Befindlichkeiten noch taugen, die Tiefsee, das Netz usw. haben ihre Zeit gehabt, wenig neue sind in Sicht. Und auch der Schneefall, so sehr er die Leserin einwickelt, ist kein Bild von ausgesuchter Frische. Dabei ist die Form des Gedichts an sich schon ein körpergewordenes Gegengewicht zu anderen Netzwerken, ein Signale-Empfangen, das Signale zurückgibt, ein Versuch, sich dem Fließtextzeitalter entgegenzustemmen mit dem Beharren auf einer Erfahrung, die als Währung in der Welt der Datenbanken zunehmend verfällt.
Aber ist das der Punkt? Ich kann mir vorstellen, dass Gedichte kommen werden, die auf schwindelerregende Weise mit Wischungen arbeiten, auf mehreren Ebenen oder tabs zugleich spielen und trotzdem von einer individuellen Stimme getragen sind. Wäre das dann ein Teilerfolg der konstatierten hirn-w-lan Schrankenlosigkeit, in der Erreichbarkeit und Manipulierbarkeit so bedenklich eng beinanderstehen? Oder ein Beweis dafür, dass unsere Skepsis völlig unbegründet ist? Der Wunsch nach solchen Schranken ist jedenfalls ein sehr verständlicher Wunsch, denn wenn beispielsweise die Leserinnen und Leser aus „Fahrenheit 451“ noch sicher sein konnten, dass die Schranken ihres Kopfes für die zensurierenden Feuerwehrmänner ein echtes Hindernis waren, ihr besonderes Wissen also geschützt wähnten, wissen wir, wandelnde Posteingänge, zunehmend weniger, was es überhaupt zu bewahren gilt. Wo ist Durchlässigkeit Fortschritt, wo Dichtung vonnöten??
Selbst mich, einen der Old School-Hausmeister hier, spricht das Gedicht an. Es ist gedacht (es denkt noch immer), und es klingt. Die Klänge wandern (her, zu mir). Musik (aus Bedeutungen). Erstaunlich, wie körperlich das Ganze mich sein lässt, selbst wenn ich mich da nur hineinerfinde.









 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /