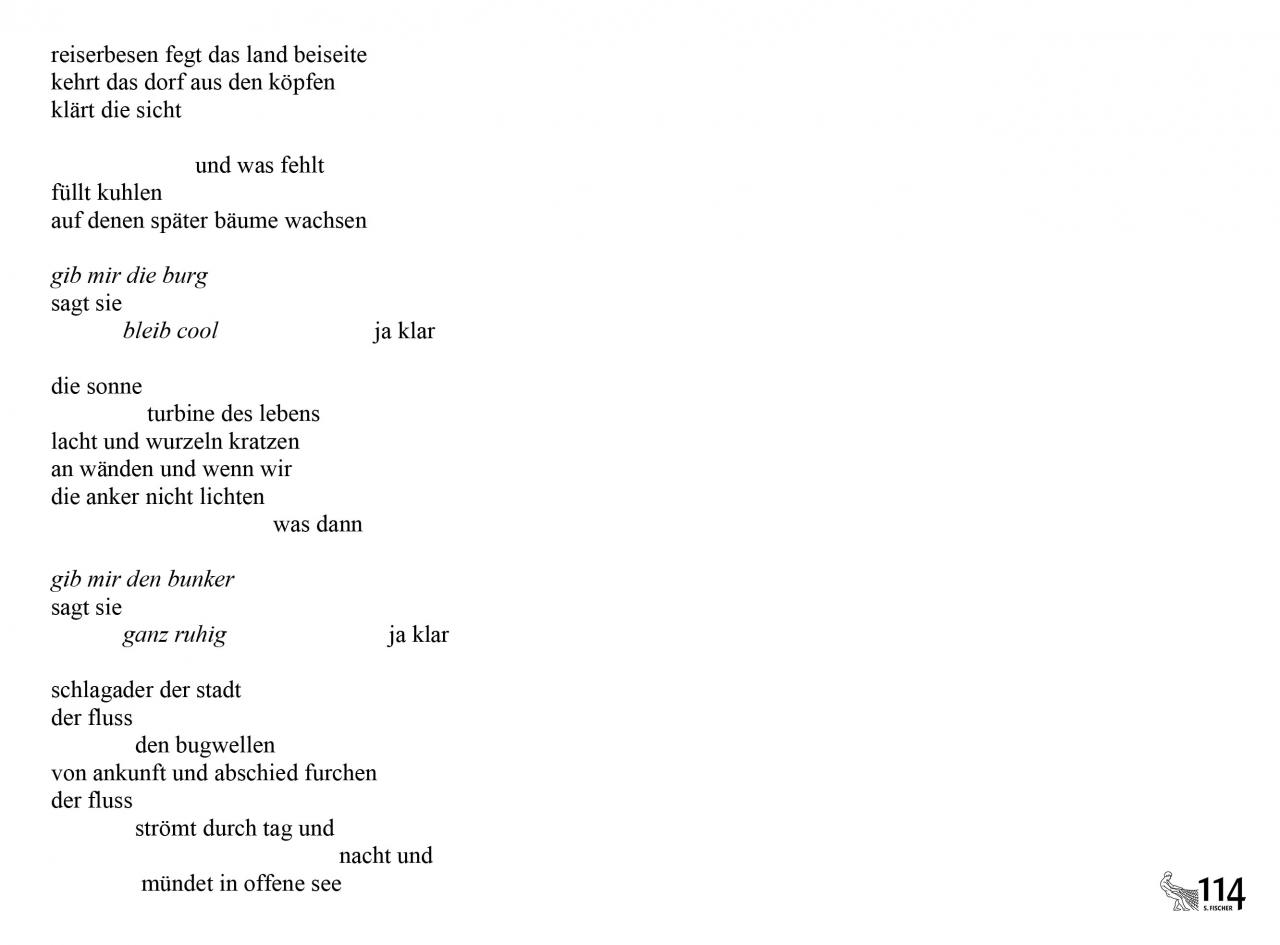
Kommentare
"ja klar" - von wegen. Zwei Lebensformen: das Dorf und die Stadt, das Land und die See. Die Frage: Muss man denn die Anker lichten? Und was passiert, wenn man es nicht tun? Die Stadt als Fluß von Menschen, die kommen und gehen, nirgends fester Halt, aber die Wurzeln kratzen innerlich. Sie fordert Sicherheit, sie schenkt Beruhigung. Wer seine Wurzeln ausreißt, verlagert sie nach innen. Die Löcher des Verlustes sind der Humus, auf dem Neues wächst. Das scheint das einzig Positive zu sein in diesen Versen. Das Phantasma des Offenen als Utopie wird hier infrage gestellt. Thomas Braschs "Sindbad" als Parallellektüre könnte aufschlussreich sein.
Die Bewegung vom Dorf in die Stadt sehe ich auch. Allerdings befindet sich das Dorf, als es ausgekehrt wird, nur noch in den Köpfen. Die räumliche Bewegung ist also schon abgeschlossen. Es geht um eine Veränderung im Kopf, um eine Klärung des Verstandes. Es ist demnach nicht die Reise vom Dorf zur Stadt, welche den Text strukturiert.
Aber was dann? Zum einen der Wechsel zwischen den Beschreibungs- und den beiden Gesprächsszenen, welche das Fluide der Veränderung mit den Beharrungskräften kontrastieren (Burg und Bunker, bleib cool, ganz ruhig - ja klar - das sind die Elemente der Beharrung). Zum anderen ist es die Abfolge der vier Elemente: die Erde (das Land) in den ersten sechs Versen, das Feuer (die Sonne) im zweiten sechsversigen Abschnitt und zuletzt das Wasser (der Fluß, der im Rückgriff auf die Erde seinerseits wie ein Feld gefurcht wird.). Fehlt noch die Luft: Die Luft, das ist die Imagination der gesamten Szenerie, ein Luftgespenst der Einbildungskraft, gesprochen ins Luftige, "ins offene". Also ein makrokosmisches Gedicht, kein Reisegedicht.
Der Fluss zuletzt wird als Schlagader imaginiert, das heißt, die Stadt ist in diesem Bild als Blutkreislauf oder als Körper gedacht. Irgendwo gibt es offenbar auch ein Herz der Stadt und es müssten sich auch Vorhöfe, Venen etc. der Stadt finden lassen. Das merkwürdige an diesem Bild ist, dass der Fluss gerade nicht in einem Kreislauf zirkuliert, sondern mündet. Auch das ist zwar in der Metaphorik des Körpers gehalten, denn wahrscheinlich mündet der Fluss mündlich im Mund des Stadtkörpers. Doch schief, absichtlich disparat bleibt die Metaphorik von Kreislauf und Mündung.
Noch eine zweite disparate Metapher weist der Text auf. Nachdem ich bei "Wochen ankern in Rümpfen" (19) eine Genitivmetapher verteidigt habe, muss ich zugeben, diese hier irritiert mich sehr: die sonne lacht ja nicht nur, was sich aus demselben Fundus von toten Metaphern bedient, wie sie auch der Fluss als Schlagader der Stadt ist (findet sich in jeder Reisebeschreibung einer Stadt am Fluss), nein, hier ist die lachende Sonne auch noch die "turbine des lebens". Turbinen aber wandeln ja eine schon vorhandene fluide Energie in eine andere um - aber das macht die Sonne? Die Turbine passt in das Bildfeld des Gedichts, aber geht sie mit der Sonne zusammen? Und warum wählt dieses Gedicht solche Störmomente gezielt aus? Um mit dem Reiserbesen die Köpfe zu kehren, umzukehren?







 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /