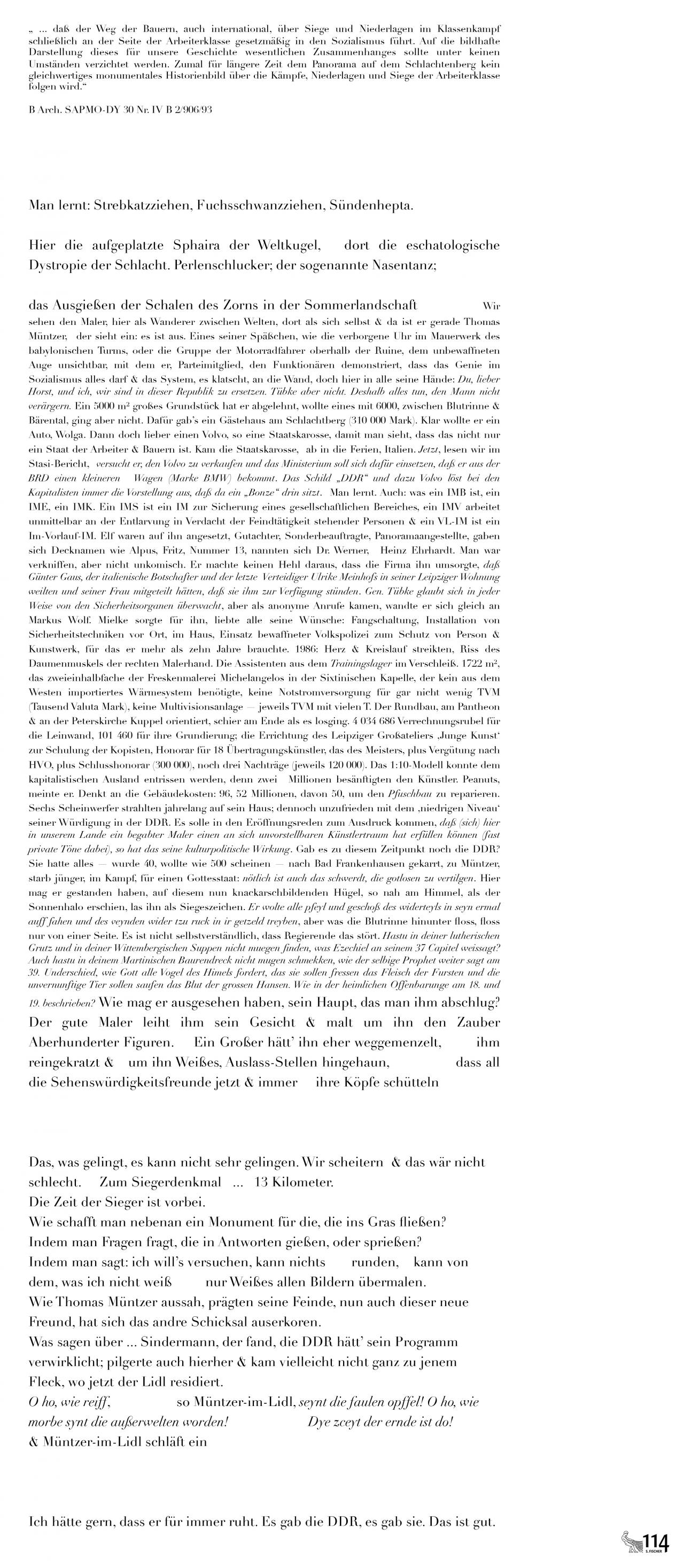
Kommentare
Ausgezeichnet. Auf nach Bad Frankenhausen!
eine unverhoffte Begegnung oder besser Wiederbegegnung. wir nannten dieses Ding damals Elefantenklo. ABER eine merkwürdige Anziehungskraft ging von Tübkes Werk aus, geht noch immer und nicht nur vom Panorama. ich vermag sie auch in diesem Text finden, und das äußerst Spannende für mich (der sich vom Titel zuerst etwas abschrecken ließ, weil aufgewachsen unter Bauernkriegsideoologie, gern hätte ich auch eine Zeitlang Bundschuhe getragen)ist diese Ungleichzeitigkeit. als gingen Technik und Vollendung parallel, träfen sich erst in der Unendlichkeit.
Die merkwürdige Anziehungskraft ist - glaube ich - überhaupt kein "Aber". Die Faszination besteht darin, gleichzeitig angetan und abgestoßen zu sein. Diese Ambivalenz, die an einem zu kleben scheint, inszeniert der Text. Müntzerzitat, Stasi-Akte, Kommentar - erhellendes Konglomerat. Oder etwa nur die Inszenierung eines aufklärerischen, ideologiekritischen Duktus?
Wie dringlich die Frage im Raum steht, unter welchen Bedingungen Kunst entsteht. Wie nennt man das, was Tübke in der DDR genoss, "künstlerische Freiheit"? Das kann schon weh tun. Ebenso wie die einseitigen Narrative, die noch heute eine Museum wie das "Panaroma-Museum" entspinnt. Kein Hauch von Skepsis oder gar Kritik, nirgendwo.
Die Bedingungen werden doch genauestens geschildert aus den Akten heraus. Oder ist die Frage, wie heute Kunst entsteht? Die stellt das Gedicht allenfalls indirekt. Ganz ähnlich, schätze ich, nur dass andere Interessenten – ebenfalls sehr viel – zahlen. Aber weder Tübke noch heute sagen wir Richter taugen zur Beantwortung dieser Frage, das sind Extremfälle, Perversionen. x Ebenen "darunter" kann es jeweils ganz anders laufen und läuft ja auch.
"Die einseitigen Narrative" hätte ich dann doch gern etwas genauer dargelegt – welche sind das genau, und wie klingt die andere Einseite?
Erzeugt eine Formulierung wie "jetzt lesen wir im Stasi-Bericht" nicht eine Unschärfe? Denn "wir" lesen ja nicht im Stasi-Bericht, sondern der Leser sitzt nun einmal vor diesem einen Text, der ankündigt, jetzt würde ein Originalzitat folgen. Nur weil da was kursiviert ist, sagt das doch nichts über den Status des Textes aus. Vielleicht bin ich da zu skeptisch, aber aus meiner Sicht ist das eine Schwierigkeit, die sich aus der Art der Textproduktion ergibt. Und das finde ich bedenkenswert.
Zu den einseitigen Narrativen: Wenn ich mir beispielsweise auf der Homepage des Panorama-Museums den Lebenslauf von Werner Tübke anschaue (http://www.panorama-museum.de/de/werner-tuebke-153.html), dann fehlt in dieser Biographie jede noch so kleine Andeutung über jene - sagen wir mal - "staatsgetragene" Dimensionen von Tübkes Arbeiten. Der einzige Kommentar, der überhaupt in diese Richtung zielt, lautet: "Schon 1957 als unbequemer Querdenker politisch bedingt wieder entlassen, arbeitet er bis zu seiner Wiedereinstellung als Oberassistent im Grundlagenstudium an der HGB im Dezember 1962 erneut annähernd fünf Jahre freischaffend in Leipzig." Tübke der Querdenker? Da entwirft der hier vorliegende Text doch ein anderes Bild. Es geht mir nicht um irgendeinen Aufdeckungsfuror, aber wäre es nicht angemessen, diese künstlerische Biographie samt der "Perversionen" darzustellen? Stattdessen wird ein "einseitiges Narrativ" vom großen Künstler vorgetragen, der sich gegen die widrigen Umstände zur Wehr gesetzt habe. Ich würde also für die Ergänzung der Biographie auf der Homepage um das vorliegende Gedichte plädieren. Das würde zwar eine Ambivalenz erzeugen, aber die würde es doch interessant und Tübkes Panorama keinen Deut weniger faszinierend machen.
Bei jedem belletristischen Text gibt es diese Unsicherheit, ob eine Aktenangabe, ein Dokumentenverweis im wissenschaftlichen Sinn verwertbar ist oder Fiktion. "Unschärfe" würde ich das nicht nennen. Auch nicht "Schwierigkeit". Da der Text mit einem präzise bestimmten Dokument aus dem Bundesarchiv beginnt, das auszugsweise vorangestellt ist, würde ich als Leser annehmen, dass das dem Aktenzeichen entspricht und die anderen Angaben ebenso zu handhaben sind. Das muss freilich nicht so sein. Wäre dem nicht so, sähe ich immer noch nicht das Problem (es sei denn, ich würde diesen Text wissenschaftlich anführen wollen).
Wie wären diese Stellen sonst zu benennen, wenn nicht als "Unschärfen" oder gar "Schwierigkeit"? Die Bruchstellen sind ja nicht nur eingebildet. Und der Text arbeitet ja ausdrücklich damit, dass die eine Textsorte einen anderen Status hat als der poetische Text selbst, und als Stasi-Akte an einem anderen, ja auch an einem Evidenz behauptenden Diskurs partizipiert.
Um es klar zu sagen: Das ist ein sehr starker Text, aber diese Bruchstelle treibt mich um.
Das verstehe ich gut: Was mich an dem Text von der Form her interessiert, ist sein Changieren zwischen Gedicht und Nicht-Gedicht, wichtige Passagen würde ich nicht der Dichtung zuordnen, sie schafft sich innerhalb des Textes erst Kraft, kommt erst hoch und wird gerade dadurch erfahrbar? Was die anderen Bestandteile nicht abwerten soll, obgleich sie in ihrer Ausführlichkeit strapazieren. Das scheint mir für den Text nötig zu sein. Ich habe in der Kunsttheorie nur sehr eklektizistische, rudimentäre Kenntnisse, aber da gibt es ja das Spannungsverhältnis von Kunst und Nicht-Kunst, was dort freilich weiterführender ist als es in der Literatur sein kann. Den Kunstbereich verlässt der Text nicht, aber ist das ein Gedicht? Ja und Nein: Jein. Darin kann man einen Mangel sehen, ich sehe just darin eine Qualität.
Hier ein individueller Leseeindruck von mir: Vor der Sperrigkeit dieses Textes stehe ich ein wenig ratlos. Ist sie unterlaufen, oder soll es so sein, und wenn ja, warum? Weil das, worüber es spricht, sperrig ist? Finde ich selbst das sperrig? Genauso wie ich bei diesem Text nach Lesbarkeit im physischen Sinn frage, ich verstehe den Grund nicht, weshalb es mir so schwer gemacht wird, innerhalb des Teils mit der kleinen Schrift mehr als die ersten drei, vier Zeilen mühelos zu lesen. Und ich vermisse vor allem im Teil mit der kleinen Schrift Dynamik, Melodie (die muss nicht tonal sein, aber ich würde gern etwas hören), und ich vermisse auch Freude im Umgang damit. Da bonkert und klonkt für mich sehr vieles, aber ich kann den Grund dafür nicht finden. Heißt es vielleicht, man muss sich eben quälen für, na ja, Erkenntnis? Und so muss ich gestehen, alle Vorurteile gegenüber “schwieriger Lyrik”, gegen die ich sonst immer gern anreden möchte, habe ich hier selber, und dieser Konflikt (mit mir selber) ist mir schon auch unangenehm. Den Eindruck, das Gedicht sei ein bisschen egoman, es stelle in einer auf interessant gemachten, aber nicht erfahrbar begründeten Form sein (Kunst-)Geschichtswissen aus, anstelle interessiert daran zu sein, dieses zu vermitteln und in ein Gespräch mit einer möglichst allgemein gehaltenen Vorstellung von Leserinnen und Lesern zu kommen, den mag ich mir selber gar nicht gern eingestehen, und ich überprüfe ihn wieder und wieder. Was ja dann vielleicht doch für das Gedicht spricht.
(Da ich in den nächsten Tagen selten am Rechner bin, kann ich erst mal nicht weiter mitdiskutieren, entschuldigung).
sehr viel dokumentiert und launig dazu addiert, aber eher wustig, zusammengeklaubt, kein panorama. das scheint absicht. das gegegnteil von tübke. und viele fragen offen.
dabei könnte das thema ja so schön tragen und brausen und in thesen seine bulgen erheben. nur mal als antwort auf kommentare, die das spieglein an der wand befragen.







 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /