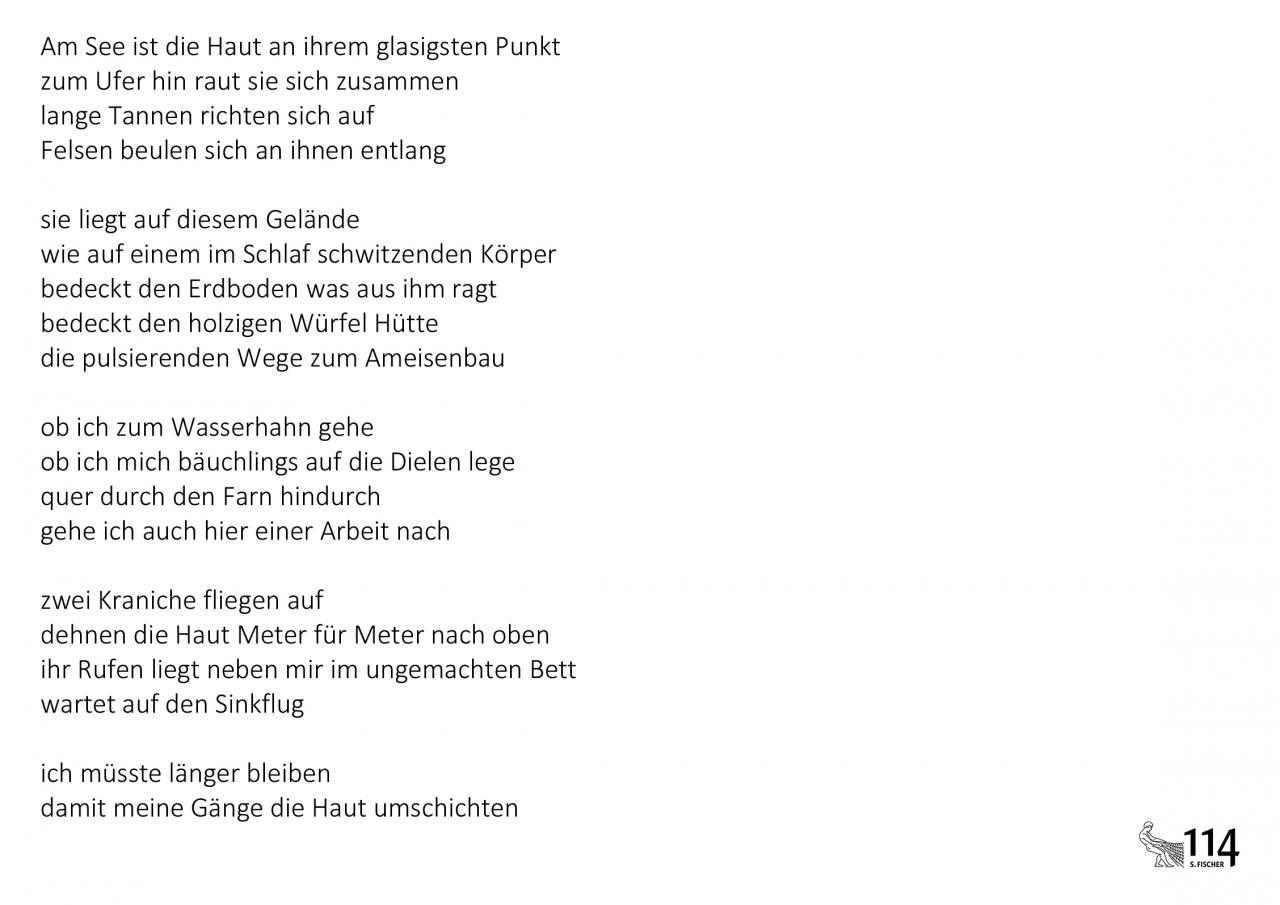
Kommentare
Warum gerade 114? Weil auch der Koran 114 Suren hat? Oder wegen der lüsternen Quersumme?
Wenngleich nicht Kommentar zu obigem Gedicht – die 114 ist, laut Info auf der Webseit’ hier, Hausnummer in der Frankfurter Hedderichstraße, vom S. Fischer. Da blieb man wohl der Anzahl treu oder mietete das Haus schon damals wegen der Suren gar.
dieses gedicht ist so im erdigen, im unbestimmten jetzt eines gangs durch eine partikular auftretende natur, dass es einen dünkt, man könne nichts weiter dazu sagen. nur die kleine, leise frage: wann geschah dies und wohin führts?
Rätselhaft schon der Titel. Als Adjektiv will er nirgends hinpassen. Ob es sich um einen Ortsnamen handelt? Und dann diese Haut, diese imaginäre, scheinbar unendlich dehnbare Haut, die Dinge und Tiere, Gelände und See umhüllt. Die Arbeit des Ichs besteht offensichtlich darin, durch seine "Gänge die Haut umzuschichten". Wie soll das bloß gehen? Oder steht die schützend-poröse Haut hier für den Atem, die Aura der Dinge? Dann würde ein Blick, eine Berührung genügen, um Veränderung zu bewirken. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Der Titel. Wie schön waren die Gedanken so schnell auf falscher Fährte. Das »morsch« von Thomas Kling, Jan Wagners »giersch« und selbst Bert Papenfuß mit »mors ex nihilo«. Das Gedicht jedoch dann etwas ziemlich anderes.
Gewisse Beulen im Text, aber auch sinnliche Spannung, weite Atmosphäre trotz der überschaubaren Szenerie. Das ist nicht einfach so dahingebaut, sondern sehr nachvollzogen, genuin. Ich und Außen sehr durchdrungen und so gut rau, dass die Verweildauer noch nach dem Lesen anhält.
Der so wunderbar irritierende Zusammenhang zwischen der Landschaft und der Haut in diesem Gedicht entsteht, weil die Landschaft als Silhouette wahrgenommen wird. Von ihr bleibt nur der Umriss. Der Umriss konturiert die Welt wie die Haut den Körper umspannt. Die Welt ist ein umhäuteter Raum, sie ist ein (umrissener) Körper. Hat man das Bild der Haut um die Welt abstrahiert, erscheint die Spiegelfläche des Sees daher als "glasiger Punkt", dort strafft sie sich, wird spiegelglatt. Zu den Bäumen, Bergen hin wirft der Umriss Falten. Das "Ich" befindet sich innerhalb dieses Umrisses, ebenso wie die Kraniche, deren Flug die Haut ausbeult, der Rufe von der Hautwand wie ein Echo zurückgerufen werden. Durchbrechen die Kraniche den Umriss nicht, wird dessen Spannung den erwarteten Sinkflug einleiten. Aus diesem Bildentwurf erklärt sich, warum man länger bleiben müsste, um mit jedem einzelnen Gang die Haut quasi von Innen umschichten zu können. Warum man länger bleiben müsste, aber nicht bleibt - denn das "morsch" im Titel gibt den Zustand im Umrissinneren an: bettlägrig, morsch, haucht die Welt ihr Leben aus. Schon Döblin hat mit der Doppeldeutigkeit von "modern" gespielt. Das Modern der Moderne mag noch nicht vorbei sein, aber im Zeitalter des "Morsch" hat das modern jetzt deutliche Spuren hinterlassen. Dafür eine so prägnante Bildwelt finden, das ist Poesie.
Habe gerade den Gedanken, dass »morsch« in dem Fall das Gegenteil von »forsch« sein könnte. Das Innehalten als letztverfügbarer Impuls. Ja, quasi Umriss. Substituier-Loop. Irgendetwas wird zu Arbeit, und ist doch keine. Nur Silhouette, Morscherie.






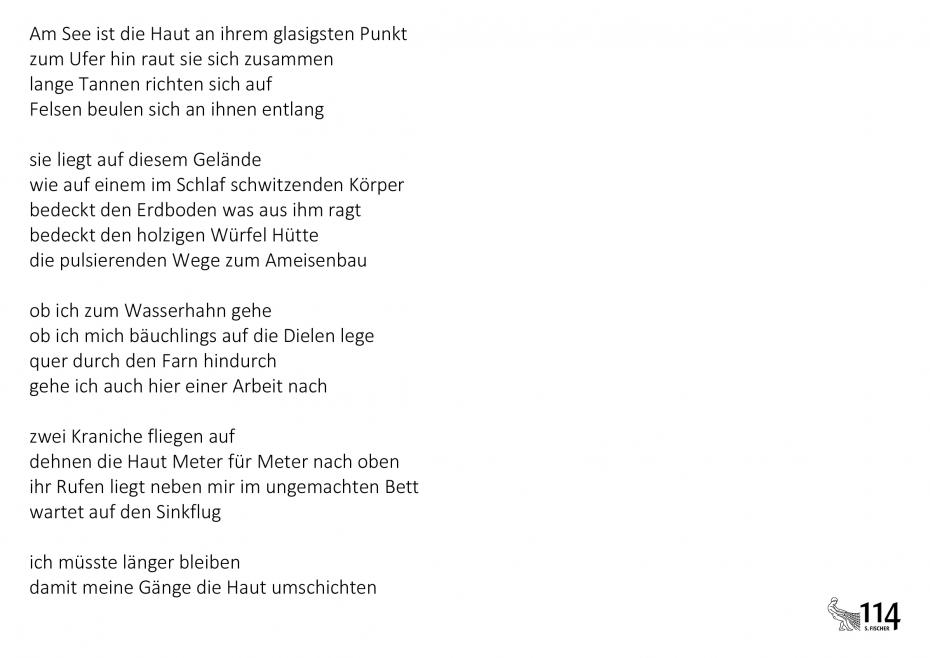
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /