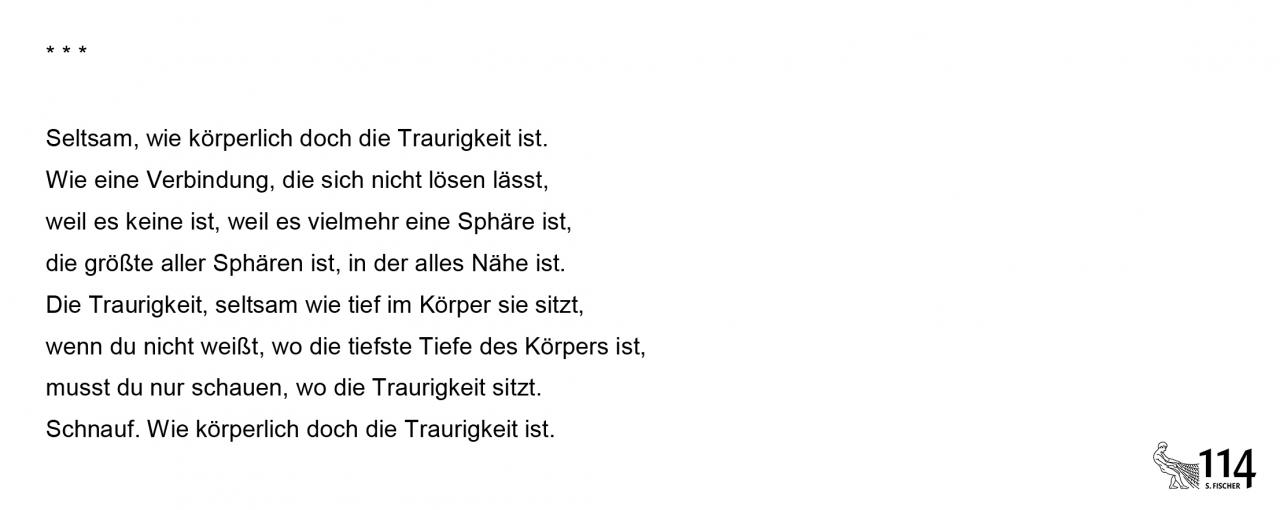
Kommentare
Zwei Gestalten: Ein Raum, der sich undurchlässig dehnt. Und ein kleiner, runder, harter Stein. Die unantastbare Einsamkeit des Gedichts und sein sanftes Maultier, das durch die Zeilen bricht mit weichen, warmen Nüstern.
So kurz, so rondohaft, so traurig. Nun ja, es handelt von Traurigkeit und nichts anderem. Genauer von ihrer Beschaffenheit und ihrem Ort. Körperlich sei sie, sitze "tief im Körper". Wolle man die Tiefe des Körpers ausloten, müsse man foglich nur schauen, "wo die Traurigkeit sitzt". Ein bisschen verheddern darf man sich vor soviel Nähe schon, denn wo beginnt das eine, wo das andere. Seien wir ehrlich: sie sind ununterscheidbar. Körper und Traurigkeit bilden eine große Sphäre, bis es der Traurigkeit einfällt, das Weite zu suchen. Sie will ja auch mal Auszeit haben, die Traurigkeit. Das steht nicht im Gedicht, aber in unseren Wünschen. Von Zeit zu Zeit.
Die Tücke der Anonymität hat mich erfasst, es tut mir leid, ich bin dafür anfällig. Anfangs konnte ich das Gedicht nicht lesen, es lag am Wissen. "…weil es vielmehr eine Sphäre ist / die größte alle Sphären ist, in der alles Nähe ist." Die Behauptungen wussten mir zu viel; ich durfte nicht selbst empfinden, was mir gehört. Ein Hinweis (Danke dafür!) brachte mich dahin, obiges Schnauf-Gedicht als eine echte Elke Erb zu lesen. Plötzlich gelangen die Behauptungssätze, weil Erb die Welt nicht weiß, sondern sich erlaubt, die Welt zu staunen. Getragene / gehobene Endsilben! Mit Erbs Stimme dazu, gelang Lesbarkeit! Inzwischen (wie gesagt, ich bin dafür anfällig), hab ich dann doch nachgeschaut, von wem das Gedicht ist (Achtung, Heckspoiler!) – es ist nicht von Elke Erb. Womit ich vermute, obige Erfahrung ist ein Wissen, das mir sagt, wie der Sachverhalt sich verhält – statt Möglichkeit eines Wunders.
Gedichte, die mit »Seltsam, wie« anfangen, sind für mich seit Grünbein eigentlich verbrannt. Da muss ich drüber, nach der Mühe der Schwelle kommt vielleicht die Süße der Ebene. Aber ach, »Traurigkeit«. Die ist natürlich keinesfalls körperlich, aber ich bin drin hier, im Schnaufkörper, finde mich von einer wegen ihrer Konzentriertheit interessanten Intensität schnaufgegriffen. Wie wenn ein guter Traum Gedichte schreiben würde. Den Traum erhaltend. Die größte aller Sphären und dennoch: alles Nähe. Das be-wow-t mich. Und das »Schnauf«, nicht nur Ventil des Traurigseins, ist ein toller Konterzipfel auf das Thema dieses Texts.
Alle Kommentare zeigen, dass Traurigkeit nicht teilbar, nicht vermittelbar ist. Das ist furchtbar, denn genau davon handelt das Gedicht (auch). Die Sphäre, in der alles Nähe ist, schottet ja ab gegen die Sphäre, die Nähe nicht zulässt, und das ist die alltägliche. Die Traurigkeit ist nicht kompatibel mit anderen Zuständen, nicht einmal mit denen, die es gut meinen. Sie bildet ihren eigenen Körper. Und ob die Traurigkeit Auszeit haben will? Das scheint mir ein großes Missverständnis zu sein. Die Traurigkeit sucht nur sich selbst. Auszeit von ihr wollen die anderen haben, die drum rum stehen, so wie wir um dieses Gedicht. Die Traurigkeit hat nur sich allein.
Um den Rhythmus des ersten Verses inetwa aufzunehmen: Wie musizierend das Gedicht doch ist. Wie sich Verse aufeinander türmen, aufeinander bauen, ineinander fallen, irgendwie erinnert mich das auch an eine Fuge - ich könnte und mag es aber jetzt nicht an Beispielversen belegen. Ich bin versucht, das alles zu singen, oder auch, (Vorsicht, ich will nicht das Gedicht tanzen, nur versuchen, meine körperlichen Reaktionen auf es sichtbar zu machen): Ich stelle mir immer größer werdende Schwünge dazu vor, und dann, bei "Schnauf", könnte alles in einem Release innehalten und dann nochmal von vorn beginnen. Außerdem hab ich noch gedacht: Noch nie dachte ich drüber nach, ob die Traurigkeit körperlich ist - vielleicht empfand ich es bisher als selbstverständlich und hab mir nie Gedanken dazu gemacht, wie schade. Insofern ist das Gedicht wie ein Reminder, oder so eine Art stellvertretendes Denken für mich - die ich den Sachverhalt von allein nicht denken konnte. (Darin liegt ja eh der Sinn aller Kunst, dass die anderen das für einen denken, was man eben selbst nicht hinbekommt).
der letzte Vers ist natürlich unschlagbar.
Die Behauptung der Sphäre schien mir am Anfang ein bißchen zu wackeln, gerade weil sie so selbstbewußt daherkommt, verstärkt durch das vorausgeschickte „vielmehr“. Aber es ist eben auch ein Versuch, die Worte so hinzubiegen, daß sie in das Gefühl hineinwachsen. Sphäre ist das, womit man nicht abschließen kann, weil es einen einschließt, die Begrenzungen sind nicht zu greifen, auch sprachlich nicht, sonst könnte man ja herausschlüpfen. Es gibt nichts, was die Traurigkeit nicht ist, wenn man traurig ist. Sie kommt von innen und umgibt einen zugleich. Horvath: Nichts gibt einem so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit. Gilt das für die Traurigkeit auch? „Ich bin unendlich traurig“, sagt man, weil das Ungefähre der Sphäre auch eine Unendlichkeitsanmutung heraufbeschwört, blind macht für das Außerhalb, manchmal auch willentlich, weil man der Größe des Schmerzes die Kohärenz der Untröstlichkeit schuldig ist.
Eine Glocke z.B. wäre keine Sphäre, sie drückt von oben, man kann sie nicht atmen. Anders als die gespannte und dennoch durchlässige Räumlichkeit der Sphäre, hellhörig und ganz dicht an der Gereiztheit gebaut. Schauplatz für ein phantasmatisches Forschen, in dem die Traurigkeit zu einer Art Vorhut für das Unermeßliche wird. Wo „sitzt“ die Traurigkeit, wo ist die tiefste Tiefe des Körpers? Müßig die Frage, ob dieses Wissen einen weiterbringt. Das Gedicht bleibt jedenfalls ganz in der Logik des Bildes. Der Raum ist eigentlich nur die Annahme und trotzdem wird er geradezu konkret ausgelotet. Wo es kein Oben und kein Unten gibt, wird dennoch Vertiefung in Aussicht gestellt und gleichsam an den Orientierungssinn der Sprache appelliert. Sofort denkt man an Phrasen wie: „Laß dich nicht unterkriegen, es geht weiter, es geht aufwärts, tiefer kann man nicht sinken, das Leben hat Höhen und Tiefen“ usw. So verfährt die Sprache mit der Traurigkeit, und die Trauernde leuchtet tapfer da hinein, wo das Signal herkommt und wo die Selbstverständlichkeit schon droht, den Anlaß zu verraten. In den redensartlichen Metaphern (zb. in der Formulierung vom „Gipfel der Verzweiflung“) steckt im Übrigen auch schon ein Körperliches, denn ein Aufstieg kann gar nicht anders als körperlich sein, er kostet schließlich Kraft. Das lautgemalte „Schnauf“ weist dann auch eher auf die Bergsteigerin als auf die Schluchzende hin, ist sozusagen Dekompression, wo der „Ausdruck“ versagt. Wäre „Schnauf“ auch durch „Seufz“ ersetzbar? Auf keinen Fall, auch weil sich das Schnaufen in das Konzert der „Aus“ einreiht, das für sich gelesen schon ein Gedicht ergäbe, in dem nur noch der Schmerzlaut übrig bleibt.
Das Ineinanderfallen der Verse, ihr fragiles Aneinander-Angelehntsein, das habe ich auch so empfunden. Die Stabilisierungsübung, die das Gedicht ist. Es ist ja auch aus lauter verschiebbaren Elementen gemacht, aus Wörtern, denen etwas aufgebürdet wird: 4x Körper, 2x seltsam, 4x Traurigkeit, 2x Sphäre, 2x sitzt, 5 x ist, plus eine gleitende Reihe von Sies, Wies, Weils, Wenns und Wos, aber mit jeder Verschiebung wächst auch die Gefahr des Einstürzens, ein Luftzug oder ein Antippen reichen aus. Wo alles Nähe ist, bietet nichts mehr Halt. Ganz dünnes Eis der Vergleiche. Trotzdem ist, denke ich, mit dem Benennen der Sphäre der erste Schritt in die Objektivierung gemacht, die in eine Form hineinführt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten... Schon in der Definition der Traurigkeit scheint das Gedicht als Möglichkeit auf. Macht ihr zwar nicht den Garaus und schon gar nicht den Prozeß, aber setzt ihr etwas entgegen, was nicht Traurigkeit ist und auch nicht Rettung, sondern „schlicht“ Realisierung. Das Beharren, gegen den Druck der Wirklichkeit einen eigenen Druck aufzubauen. Kein Ventil, das wäre zu wenig, dann wäre es mit dem „Schnauf“ bereits getan. Aber doch etwas, das der Traurigkeitssphäre, in der Verbindung und Auflösung miteinander ringen, als neue Verbindung abgetrotzt ist, über die Chemie des Traurigseins einerseits und über das einsame Beisichsein des Trauernden andererseits hinaus. Tröstlich (?) ist außerdem, zumindest für mich, daß aus dem, was da wie ein tastendes „definition poem“ beginnt, am Ende so etwas wie eine Hymne wird, in die man auch einstimmen könnte, ein Chor der Traurigen, die aus vollen Kehlen schnaufen und dabei einen Resonanzkörper bilden. Was auch die Einsamkeit aufhebt, aber eben nur für die Dauer der Sammlung im Text…
ps. Noch drei Traurigkeitsgedichte von nicht trauriger Gestalt:
Christine Lavant
Erlaube mir traurig zu sein
unter deinen Augen, den Sternen.
Vielleicht sehen sie nicht, daß ich traurig bin,
denn die Muschel des Mondes ist abgewandt
und hört nicht auf meine Gespräche.
Bei Tag denkt sicher die Sonnenstirne
niemals über mich Dämmernde nach –
erlaube mir, gänzlich verloren zu gehen
in den Büschen der Schwermut.
Dieter Roth
Wer manchmal in der Ecke sitzt und heult
Weil ihm das Leben sich äußerlich verbeult
Und oftmals daneben sitzt und brüllt
Weil ihm das Leben sich innerlich zerknüllt
Nur der weiß was er hat zu leiden
Und was er gerne möchte vermeiden
Der immer in der Ecke sitzt und heult
Wobei sich die Hand und das Herz
der Himmel und die Erde der Mensch und das Tier
Gänzlich zerknüllt bzw weitgehend verbeult
Und das Gedicht von Priessnitz mit den hereinwehenden dunklen Wolken, das ich gerade nicht finde, wo die Traurigkeit diesen Quellquotienten erzeugt, wenn aus „mehrere“ am Ende „mehrerere“ wird. (Vielleicht wegen Weinen auf Österreichisch: rean [rärrn, rearn, rern]?)
(irgendwie kann man hier keine Leerzeilen einfügen, Strophenenden wären eigentlich nach "hände", "fahnen" und "puders". Und das zweite "-den" bei "wehendenden" müsste leicht hochgestellt sein)
Reinhard Priessnitz - trauriges pudern -
mehrere dunkle wolken wehen herein
die sind so mehrere und so allein
selbst in einem dunkel
und das könnte nicht dunkler nicht sein
als ich in meinem alleinverein
meine füsse und meine hände
da dunkeln sie mich gleich wehend ein
auf meines schminktisches schwarzer wolke
mit den wehendenden fahnen
mehrere dunkle wolken wehen herein
ich schau schon dunkler und weher 3n
wie eine wolke traurigen puders
immer mehrererere
Ist es nicht seltsam, was dieses Gedicht "seltsam" findet? " Im Diskurs über die Traurigkeit ist die hier behauptete Seltsamkeit common sense. Demmerling, Landweer, Philosophie der Gefühle, z.B.: "Das Gefühl der Traurigkeit ist durch Schwere und einen Druck nach unten bestimmt, sie verengt und verschließt. Der Traurige fühlt sich von seinem Gewicht niedergedrückt, er fühlt sich schwer und belastet, was sich in seiner körperlichen Haltung dokumentiert. Er lässt Kopf und Schultern hängen, senkt den Blick und geht gebeugt. Trauer und Traurigkeit lassen denjenigen erschlaffen, der diese Gefühle verspürt."
Seltsam doch auch die darauf folgende Erklärung. Nicht unbedingt wegen der Anbindung an das Modell von Sphären (Sloterdijk-Alarm). Aber in der dritten Zeile heißt ES plötzlich, "weil es keine, weil es vielmehr eine Sphäre ist." (Es ließ sich sogar noch das "es" aus "allES" (V. 4) hinzunehmen). Dieses "Es" bleibt grammatikalisch ohne Bezug: "es", - die Traurigkeit, "es" - die Verbindung"? Doch wohl eher nicht. Wo das Erstaunliche angeblich erklärt wird, tut sich ein grammatikalischer Riss auf. Der lädt dazu ein, dieses "Es" im Freudschen Sinne zu lesen. Dann wären wir aber genau wieder an der psychosomatischen Verbindungsstelle ankommen, wo der Körper verrät, was psychisch los ist, aber verdrängt wird. Auch dort also: alles andere als seltsam, wie körperlich die Traurigkeit ist.
Auch das Wort "seltsam" fällt auf: In der Ästhetik gibt es immer wieder Bemühungen das "Seltsame" bspw. vom "Sonderbaren" zu unterscheiden. Während das Sonderbare, jenes Unerwartete sei, das allen Regeln widerspreche, gilt das Seltsame als das Unerwartete, das weder zur theoretischen noch zur praktischen Vernunft in Widerspruch trete. Seltsam passt, denn das Ausgeführte entspricht exakt der Theorie. Unmittelbare Wahrnehmung und Diskurs in Einklang. Seltsam ist hier also, dass das Erwartbare als seltsam ausgestellt wird und alle dennoch sagen: o, ja merkwürdig, da habe ich noch nie darüber nachgedacht.
Was macht man damit, mit der Distanzierung zur eigenen Aussage. Tritt damit nicht ein ironischer Ton in dieses Gedicht? Ironisch ist doch auch die Vorstellung, dass gerade mal jemand wissen will, wo die tiefste Tiefe des Körpers liegt und da sitzt dann die Traurigkeit wie das Häschen in der Grube. Und gibt es nicht sogar das Phänomen des "verächtlichen Schnaufens"? Das scheint mir, den Ton des letzten, rahmenden Verses, der "seltsam" durch "schnauf" ersetzt, zu bestimmen.
Mag sein, dass das ein Holzweg ist. Aber wenn man die Ironie und die Distanzierung von der eigenen vermeintlichen Erkenntnis ernst nimmt, dann stellt der Text etwas anderes als die Traurigkeit in den Fokus: nämlich die ständige Behauptung des "Seltsamen", und "Unerwarteten" und "AchsoNeuen" sowohl in der eigenen unvermittelten Wahrnehmung als auch im theoretischen Feld, obwohl ein einziger Blick zurück zeigen, würde das daran "doch" so gar nichts neu ist: "Schnauf. Wie körperlich doch die Traurigkeit ist", rundet die Kritik der nur behaupteten Erkenntnis ab.
Lieber Christian Metz, "da habe ich noch nie drüber nachgedacht" habe hier doch nur ich gesagt, und nicht alle? Ich habe nur deswegen nie drüber nachgedacht, genau, weil ich das Körperliche der Traurigkeit bisher für selbstverständlich hielt, das ist in der Tat nichts Neues, und mir ist die Ironie auch nicht entgangen. Aber das Gedicht funktioniert für mich auf beiden Seiten, ironisch und nicht ironisch. Seltsamerweise find ich auch, es ist ein ziemlich trauriges Gedicht. Das zugleich witzig ist.
Liebe Martina Hefter, ja, das stimmt. Entschuldigung! Da bin ich dem voreiligen Pauschalurteil aufgesessen, einerseits. Andererseits denke ich, dass Sie mit Ihrem Satz am prägnantesten formuliert haben, was die Rhetorik des Gedichts einfordert, nämlich genau diese eben nicht nur individuelle Reaktion auf die Inszenierung eines vermeintlich neuen Blicks. Damit beginnt - aus meiner Sicht - das Spiel mit der Behauptung des Neuen.
Ob beide Lesarten versöhnt nebeneinander bestehen? Ausschließen würde ich es nicht wollen, aber für die ironiefreie Lesart muss man die Risse im Text ausblenden und zumindest auf die Existenz dieser Risse wollte ich hinweisen. Witzig bleibt das Gedicht in beiden Fällen, aber traurig?
Lieber Christian Metz, das Traurige meine ich im Klang zu hören - das Gedicht hat für mich was sehr Liedhaftes, und der Charakter der Melodie, wie ich sie höre, ist eher nicht beschwingt. Ich kann es schwer mit Wörtern beschreiben, aber das ganze Ding ist von einer milden, nachdenklichen Traurigkeit im Ton bestimmt - nicht melancholisch!
das gedicht dünkt mich eine bankrotterklärung des dichters gegenüber der körperlichkeit der traurigkeit, die alle komplexität und alles denken-können verschluckt. ein einziges wort dann, das aus diesem nur mühsam ausgedrückten nicht-ausdrücken-und-nicht-denken-können der depression in comichafter überzeichnung ein wunsam wuchtiges tier macht, das ordentlich durchschnauft und brunftet, widerlegt dann den bankrott






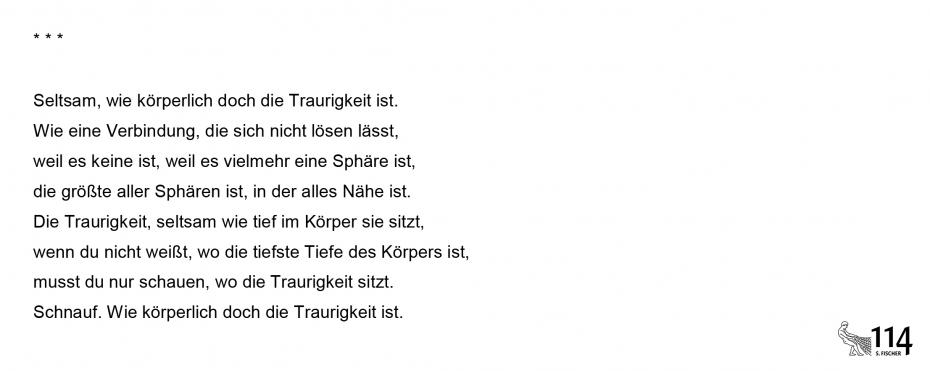
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /